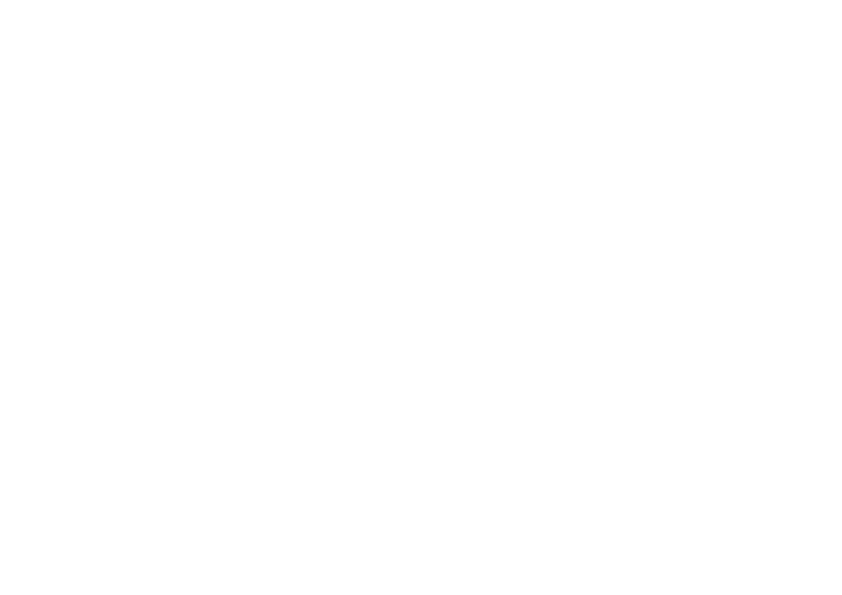Recht grusel-grauselig geht es in dem Kinderbuch „Ein Hund mit Namen Dracula“ von Klaus Möckel zu.
Eine internationale Raketenexpedition steht im Mittelpunkt des für junge Leserinnen und Leser von 10 Jahren an gedachten Märchenbuchs „Die Reise nach dem Rosenstern“ von Herbert Friedrich.
Einen wahren historischen Hintergrund hat dagegen das hier präsentierte zweite Buch von Herbert Friedrich: „Der Vogel Eeme. Die Ostindienreise des Holländers Cornelis de Houtman 1595-1597“
Und damit sind wir wieder beim aktuellen Beitrag der Rubrik Fridays for Future angelangt. Jede Woche wird an dieser Stelle jeweils ein Buch vorgestellt, das im weitesten Sinne mit den Themen Klima, Umwelt und Frieden zu tun hat – also mit den ganz großen Themen der Erde und dieser Zeit. Heute lassen wir wieder einen Jahrhundertzeugen und großartigen Reporter und Schriftsteller zu Wort kommen, der von vielen schrecklichen Dingen erzählt, die er während seines fast 100-jährigen Lebens überstanden hat, aber auch von Zeichen der Menschlichkeit und Solidarität, die ihm halfen zu überleben. Und trotz allem Ungemach seines Jahrhunderts hat ihn der Glaube an die Hoffnung und vor allem an die Liebe nicht verlassen …
In deutscher Sprache erstmals 1958 erschien im Verlag Neues Leben Berlin der Band mit Erzählungen „Der Fluch von Maralinga“ von Walter Kaufmann: Es sind nicht nur Erzählungen aus Australien, wo der Autor, dem als 15-jährigen jüdischen Jungen mit viel Glück die Flucht aus Nazi-Deutschland geglückt war, 17 Jahre seines Lebens verbracht hatte, sondern auch an seine Kindheit und Jugend in Deutschland vor 1939. Erinnerungen an Hass und wenig Hoffnung, an schreckliche Dinge, aber auch an Zeichen der Solidarität. In vielen anderen Erzählungen verarbeitet Walter Kaufmann seine Erfahrungen und Erlebnisse in Australien, seine Begegnungen mit Eingeborenen und mit Seeleuten und – mit der Liebe. Hier der Beginn der Erzählung von Eva.
„Eva
Wir von der Arbeitskompanie waren im Spätsommer dieses Jahres nördlich von Melbourne stationiert, außerhalb einer blühenden australischen Kleinstadt inmitten von Eukalyptusbäumen und flachen braunen Hügeln. Unsere Beteiligung am Krieg beschränkte sich darauf, dass wir Tag für Tag Munition aus Lagerschuppen holten, sie auf Lastwagen verluden und von diesen auf Eisenbahnzüge, die ihre für die Front auf Borneo bestimmte explosive Fracht in den Hafen von Sydney brachten. Wir waren alle Europäer, hauptsächlich Deutsche, ein paar Österreicher, ein paar Griechen, einige wenige Italiener – mehrere Hundert aus ihrer Heimat vertriebene Männer, die durch die Wechselfälle der Geschichte erst in alle Winde zerstreut und dann, wie durch eine Laune des Schicksals, auf diesen abgelegenen Vorposten in einem fremden Kontinent zusammengewürfelt worden waren.
Eine breite Hauptstraße durchquerte die Stadt, die sich unterhalb unseres Lagers ausbreitete, eine Straße mit Geschäften und Bürohäusern und soliden Hotels, gerade und glatt vom Bahnhof bis zum Fluss. Zwischen der Methodistenkirche und der Stadtbibliothek war aus Geldspenden eine Baracke für Soldaten errichtet worden, der einzige Ort, an dem einzukehren unsere Mittel uns erlaubten.
An unseren freien Tagen, wenn wir lange genug ziellos durch die Stadt gelaufen waren, saßen wir oft an den einfachen Holztischen, beobachteten den Verkehr, der draußen im Sonnenlicht vorüberzog, oder die Frauen, die im Schatten der Markisen an den Geschäften vorbeihasteten. Manchmal, wenn ihn die Lust überkam, versuchte einer von uns, dem Klavier in der Ecke einen Wiener Walzer zu entlocken, eine italienische Weise oder ein Lied aus dem Rheinland. Es hörte sich sonderbar an in einem Raum, wo an der Holzwand über dem Tisch mit den Schachbrettern ein übergroßes Bild von Schafscherern hing.
Zuweilen, wenn es sich gerade mit den Ruhetagen unserer Einheit traf, bediente Schwester Norwood, eine Privatpflegerin, in ihrer Freizeit hinter der Theke. Sie war eine ergrauende Frau mittleren Alters, ein wenig beleibt und langsam. Sie behandelte uns mit der Liebe, die sie ihren zwei Söhnen zurzeit nicht schenken konnte, da beide als Infanteristen in Neuguinea waren. Für sie, das spürten wir, waren wir Menschen, Persönlichkeiten, und nicht, wie für viele Einwohner der Stadt, bloß eine Gruppe unbegreiflicher Ausländer.
Von uns allen schien sie mich am meisten zu mögen, vielleicht, weil ich sie an ihren jüngsten Sohn erinnerte. Mit der Zeit fasste ich Vertrauen zu ihr. Ich erzählte ihr Einzelheiten aus meinem Leben, die ich normalerweise für mich behielt – wie die Nazis meine Eltern verschleppt hatten und wie ich vor vier Jahren, mit fünfzehn, aus unserem zerstörten Heim durch das Rheinland über die Grenze nach Holland geflohen war. Schließlich sprach ich sogar davon, dass ich ein Adoptivkind war, nichts von meinem richtigen Vater wusste und von meiner Mutter nur, dass sie in ihre polnische Heimat zurückgekehrt war – eine Schuhmacherstochter, die mich geboren hatte, als sie, ein junges Mädchen noch, in einem Warenhaus in Berlin arbeitete. Ich erwähnte das, so beiläufig ich nur konnte, denn Mitleid war mir verhasst. Aber Schwester Norwood reagierte mit tiefem Verständnis.
„Vor siebzehn Jahren“, sagte sie, „haben wir unsere Eva adoptiert, deren Mutter damals dort drüben in Maxwells Warenhaus beschäftigt war.“ Sie lenkte meine Aufmerksamkeit auf ein Gebäude auf der anderen Straßenseite. „Ich kannte sie schon, bevor Eva geboren wurde, denn sie hatte keine Eltern mehr und kam mit ihren Problemen zu mir. Evas Mutter war ein lebhaftes, fantasievolles, feinfühliges Mädchen, das sich immer einbildete, die große Liebe gefunden zu haben, und das immer betrogen wurde. Als der Vater des Kindes sie verließ, warf sie sich jedem Mann an den Hals, bis das Gerede in der Stadt so gemein wurde, dass sie floh, ohne eine Spur zu hinterlassen.“ Nach kurzem Nachdenken fuhr Schwester Norwood fort: „Ich habe Eva niemals etwas davon erzählt. Vielleicht hätte ich es tun sollen, denn jetzt habe ich Angst, ihr könnte durch andere etwas zu Ohren gekommen sein. War das bei Ihnen auch so?“
In dem Augenblick trat aus dem Sonnenlicht, das draußen über dem heißen Straßenpflaster flimmerte, eine Gruppe Soldaten lärmend in die Baracke. Einer von ihnen klopfte mir auf die Schulter und fragte: „Wie wär’s, wenn wir noch was Kräftigeres trinken als Tee, bevor die Kneipen zumachen? Ich geb heut einen aus.“
Ich sah Schwester Norwood an. „Ja, bei mir war das auch so“, antwortete ich. „Unser Dienstmädchen hat mir’s mal erzählt, als sie wütend auf mich war. Es war ein harter Schlag.“
Ich wandte mich ab, da ich nicht weiter darüber reden wollte. Der Soldat, der heute einen ausgeben wollte, schlug immer wieder die gleichen drei Töne auf dem Klavier an. Die Männer lachten. „Ich geb heut einen aus, trala …“
Schwester Norwood ergriff meine Hand. „Ich werde versuchen, mit Eva zu sprechen“, versicherte sie mir. „Danke, dass Sie so offen zu mir waren.“ Dann fügte sie nach kurzem Schweigen noch hinzu: „Wollen Sie uns nicht mal besuchen? Wir würden uns beide freuen, Sie bei uns zu sehen, Eva auch, das weiß ich.“
Seit ihr Mann vor ein paar Jahren gestorben war, erklärte sie mir, lebte sie mit ihrer Tochter in einer kleinen Wohnung im Stadtzentrum.
Der Soldat schlug laut den Klavierdeckel zu. „Wer geht mit?“, rief er. „Heute zahle ich!“
Mich zog es zu den Männern, mit denen mich die tägliche Schufterei draußen zwischen den kahlen Hügeln verband, und ich bedauerte jetzt, dass ich über so persönliche Dinge mit Schwester Norwood gesprochen hatte.
„Kommst du mit?“, fragten sie.
„Klar“, erwiderte ich.“ Und damit zu den ausführlicheren Vorstellungen der anderen vier Sonderangebote dieses Newsletters.
1998 erschien im Hinstorff Verlag Rostock „Spuk auf Spyker. Wundersame Geschichten“ von Heinz-Jürgen Zierke: Schritte, tapp tapp, tapp tapp. Nicht laut, aber deutlich vernehmbar, vierfüßig, wenn er sich nicht täuschte, und ganz in der Nähe, vielleicht hinter der Bohlenwand. Ein unverständliches Wispern begann, mal dumpf, mal glucksend, dann stöhnend, als würgte der Teufel seine Großmutter, und löste sich in einem verhaltenen Schrei!
Unheimlich, gespenstisch, Schauder erregend, aber nicht ohne Humor und Ironie geht es zu in diesen wundersamen Geschichten. Pommern und die Uckermark haben da allerhand zu bieten: Ein Teufel macht in der Gestalt eines hübschen Mädchens dem starken Geschlecht ganz schön zu schaffen, Ferdinand lässt sich von einem Männchen mit einem großen Hut helfen, eine Frau ohne Kopf erscheint und ein uralter, steingrauer Wels, dem Merkwürdiges widerfährt, taucht auf. Aber nicht nur in der Vergangenheit spukt es, auch die Gegenwart ist nicht frei von makabren Ereignissen, lässt uns Zierke wissen. Eine Äbtissin macht einem Dienstreisenden Angst, auf Schloß Spyker stören dunkle Gestalten eine Schulung, und schließlich geht es um viel Geld, einen Besenbinder und – um Spucke in einer Spuk- und Spuckgeschichte an einem nicht näher bezeichneten Ort. Manche Stadt und manches Dorf allerdings finden deutliche Erwähnung. Und so kann der geneigte Leser überprüfen, ob dergleichen Un-Heimlichkeiten auch heute noch stattfinden in: Stralsund, Tribsees, Voigdehagen, Rom, Lübz, Parchim, Abtshagen, Gornow, Wildenbruch, Jamund, Torgelow, Saal, Damgarten, Putgarten, Sagard, Arkona, Jatznick, Kölzow, Stolzenburg, Pasewalk, Greifenberg, Prenzlau, Woldegk, Neubrandenburg, Fürstenwerder, Ueckermünde und auf Schloß Spyker. In der folgenden Geschichte hat der Teufel höchstselbst seine Hand im Spiel – sogar mehr als diese, wie man gleich lesen kann:
„Der Teufel als Mädchen
Nicht weit von Stralsund, in südliche Richtung geschaut, lag ein Gütchen, das nicht eben sehr groß war, aber seinem Besitzer ein sorgenfreies Leben gestattete, wenn auch kein solches, wie es in seinen Kreisen üblich war. Der Herr gab weder Bälle noch rauschende Feste; er trank auch nicht, spielte nicht und wettete nicht auf Pferde, ja, nicht einmal im Lotto. Dafür plagte ihn eine andere Leidenschaft, für die er freilich kaum Geld aufwendete: Er stieg den jungen Mädchen nach, die er mit feurigen Augen und sanften Worten leicht zu gewinnen wusste.
Wie gesagt, diese Leidenschaft kostete ihn wenig, da er sie nicht an Damen oder solche, die sich dafür ausgaben, verschwendete. Er suchte sein Vergnügen lieber bei prallen Bauerndirnen. Da er aber mit den Jahren die Mädchen seines Hofes und die des nahen Dörfchens nur allzu gut kannte, dachte er eines Tages daran, sich in der Umgebung umzuschauen. Mädchen sind ja wie Unkraut, sie wachsen immer wieder nach. Pflückt man eine Blüte, sprießt schon die nächste Knospe. Er befahl also seinem Leibknecht Franik, das Coupé im Schatten der uralten Eiche bereitzustellen.
Franik – ein seltsamer Name für unsere Gegend. Der Herr hatte ihn aus der Kaschubei mitgebracht, wie er sagte. Er war einige Zeit in der fernen Stadt Bütow in Garnision gewesen, bevor er seines angegriffenen Herzens wegen den Abschied nehmen durfte. Franik – seinen Burschen, der ihn unermüdlich mit geübtem Blick auf die Schönheiten der Landschaft aufmerksam gemacht hatte, löste er beim Regiment aus und behielt ihn als Knecht.
Franik bürstete die Polster der Kutsche, denn sein Herr bekam vom Staub leicht das Niesen, spannte an und fuhr vor. Der Junker stieg ein und prahlte: „Das erste Weib, das uns über den Weg läuft, ziehe ich mir in den Wagen.“ Sprach’s, lehnte sich genüsslich zurück und nickte ein.
Sie waren kaum eine Viertelstunde gefahren, als ihnen eine Frau entgegenkam. Die Jüngste war sie wohl nicht mehr. Herbe Falten kerbten das Gesicht, und ein grünes Kopftuch versteckte die grauen Fäden in dem aschblonden Haar. Sie zog am Strick eine braunbunte Ziege hinter sich her, mit der sie zum Bock wollte.
Franik weckte den Schlafenden: „Herr, die erste Frau.“ Der Angesprochene schreckte hoch , rieb sich die Augen, sah die Alte, schlug beide Hände vors Gesicht und schrie: „Pfui, die alte Hexe! Gib den Pferden die Peitsche, Franik!“
„Frau ist Frau, Herr.“
„Für dich vielleicht. Hast selber keine Zähne und magst am Gepökelten lutschen. Ich aber will Frischfleisch, Frischfleisch.“ Wieder lehnte er sich zurück.
Sein Wunsch erfüllte sich. Ein junges Weib mit flatternden Haaren, geröteten runden Augen und prallen Lippen kam den Weg entlang. Ihr Atem ging schwer; sie hatte eine gehörige Last zu schleppen, die ihres eigenen Körpers.
„Herr, eine Frau! Frischfleisch, Frischfleisch, und gleich die doppelte Portion. Da lohnt sich das Kauen.“
Wieder schreckte der Junker hoch, steckte den Kopf aus dem Fenster und zog ihn gleich wieder ein. „Keine Frau. Ein Mehlsack, Franik, ein Mehlsack. Lass die Zossen laufen!“
„Frau ist Frau“, gab Franik zurück und knallte mit der Peitsche.
„Wenn ich mir die in die Kutsche ziehe, bricht mir das Achsholz.“
Sie zuckelten weiter über den ausgefahrenen Landweg. Die geteerten Achsen ächzten; die rindslederne Federung hielt den Kutschkasten mühsam im Gleichgewicht. Vom nahen Kiefernwald wehte ein strenger Harzgeruch herüber.
Da trat hinter einem Gebüsch aus wuchernden Rotdornsträuchern, das die Biegung des Weges verdeckte, ein wunderhübsches Mädchen hervor, rank und schlank wie eine Erle, biegsam wie eine Haselrute, die Augen leuchteten wie glimmende Kienspäne, die Haut war glatt wie Buchenrinde.
Diesmal brauchte Franik seinen Herrn nicht zu wecken. Der riss beim Anblick des Mädchens die Augen weit auf, das Wasser lief ihm im Munde zusammen; er schnalzte mit der Zunge und leckte sich die Lippen.
„Halt an, Franik! Die ziehe ich mir auf den Schoß und fahre mit ihr in die Jagdhütte.“ Er öffnete den Schlag weit.
Franik, dieser nüchterne Kerl, verspürte ein brenzliches Kitzeln in den Nüstern. Er konnte gerade noch rufen: „Dat Gesicht is söt, awer de Föt, de Föt!“, da setzte die hübsche Fremde auch schon den Fuß auf das Trittbrett, wobei sie den Rock etwas anheben musste. So sah auch der Herr den gespalteten Huf.
Hastig schloss er den Schlag und klemmte dem Teufel den linken Mittelfinger ein.
„Zum Teufel mit dem Teufel!“, rief er schreckensbleich. „Fahr zu, Franik, fahr zu! Wende auf dem Rübenacker und dann nach Hause, an der Voigdehagenschen Kirche vorbei! Ich hab genug von dem Weibsvolk!“
Franik riss an der Leine und drosch auf die Tiere ein. Fast wäre der Wagen bei der jähen Wende umgestürzt. Der Teufel fiel in eine Furche, sprang aber gleich wieder auf. Es gelang ihm, einen Federträger zu packen. Er machte sich klein und ließ sich in seinem schwankenden Versteck in voller Karriere gutswärts kutschieren, wobei er wütend an dem verletzten Finger lutschte.
Kurz vor der Hofeinfahrt verwandelte er sich in eine Pferdebremse und setzte sich auf den Rücken des fahlen Wallachs. Das gequälte Tier schlug wütend mit dem Schwanz; da ihm aber der Herr die Schwanzhaare hatte kürzen lassen, konnte er den Peiniger nicht verscheuchen. Franik hatte Mühe, ihn in seine Box zu bringen.
Der Herr schlich mit schlotternden Knien in seine Kammer, ließ sich eine Kanne Richtenberger bringen und trank, bis er besinnungslos aufs Bett fiel.
Racheschnaubend trieb nun der Teufel im Stall sein Unwesen. Er kroch den Tieren in die Ohren, stach sie unter dem Schwanz und machte keinen Unterschied zwischen Acker- und Kutschpferden. Verzweifelt donnerten die Hufe gegen die Wände. Das wütende Schnauben und das ängstliche Wiehern drangen bis ins Herrenhaus hinüber.
Freilich, wenn einer der Knechte den Stall betrat, ganz gleich, ob es Franik war, der Kleinknecht oder auch nur der Schweinehirte, hörte das Rumoren auf. Betrat aber eine der Mägde den Stall, was selten vorkam, denn Pferdedienst ist Männersache, dann fuhr ihnen der Teufel unter die Röcke und setzte ihnen so zu, dass sie schreiend davonliefen und sich nachher stundenlang kratzen mussten.
Das ging drei Tage lang so. Dann sagte der Leibknecht zu seinem Herrn: „Das ist die Rache für den Teufelsfinger. Wir müssen den Paster holen.“
Der Voigdehäger Pastor kam, schlug in der offenen Stalltür drei Kreuze, betete ein Vaterunser und das lutherische Glaubensbekenntnis, sang das schöne Lied „Freu dich sehr, o meine Seele“ und schlug noch einmal drei Kreuze. Solange der Geistliche auf dem Hofe blieb, und das währte einige Stunden, denn nach seinem anstrengenden Tun musste er ein stärkendes Mahl zu sich nehmen und ausgiebig dazu trinken, vernahm selbst die Großmagd, die sonst das Gras wachsen hörte, keinen Laut aus dem Stall. Kaum aber hatte der würdige Herr die Gemarkung des Gutes verlassen, ging ein Gepolter los, dass man meinen musste, die Pfeiler trügen den Stall nicht mehr und wollten einstürzen.“
2003 veröffentlichte Klaus Möckel in der Edition D. B. Erfurt „Ein Hund mit Namen Dracula. Grusel-Grauselgeschichten“: Tina, in eine Höhle verschlagen, muss eine Nacht mit angriffslustigen Gespensterfischen verbringen; Steffen, der von Mitschülern Schutzgeld erpresst, wird vor ein Geistergericht zitiert, wo ihn der gefährliche Hund Dracula in Schach hält; Annika soll einem Toten helfen, die ewige Ruhe zu finden, und Karli setzt sich verzweifelt gegen blutsaugerische Skelette zur Wehr. Neun grusel-grauselige Geschichten sind in diesem Band vereinigt. Sie führen auf spannende und oft humorige Weise in Vergangenheit oder Zukunft, in verborgene jenseitige und doch auch wieder sehr nahe abenteuerliche Welten. Hören wir, was Tina widerfuhr:
„Die Nacht mit den Fischen
Tina glaubte alle Zeit der Welt zu haben, um unbeschadet ans Ufer zu gelangen, sobald die Flut kam. Zwar hatte sie sich weit hinaus in die Steine gewagt, doch sie konnte ja gut schwimmen und schnell laufen. Nur deshalb hatte sie so lange nach Muscheln gesucht und in der Sonne auf dem kleinen Plateau gelegen. Auch als die Wellen schon an ihren Zehen leckten, hatte sie noch keinerlei Bedenken.
Sie zog das T-Shirt und die Jeans über, nahm Schuhe und Handtuch in die Hand, rollte ihre Matte zusammen und sprang zum nächsten Stein. Da fuhr ihr ein stechender Schmerz ins Bein. Sie hatte nicht richtig hingeguckt und war abgerutscht.
Das Mädchen schrie auf und hockte sich hin. Die Oberfläche des Steins war noch trocken und sie versuchte erst einmal, den gestauchten Fuß zu bewegen. Nein, auftreten konnte sie nicht, da war etwas verrenkt oder gar gebrochen. Wie sollte sie jetzt ans Ufer kommen?
Weit und breit keine Menschenseele! Das war auch klar, denn hierher verirrte sich niemand so leicht. Die Eltern waren nie mit ihr zu dieser Stelle gegangen und gerade das hatte sie gereizt. Heute, wo sie ihre blöde Busfahrt machten, hatte sich endlich die Gelegenheit ergeben, diese geheimnisvolle Bucht in Augenschein zu nehmen. Und nun dieses Pech!
Tina raffte ihre Kräfte zusammen und humpelte los. Auf einen Stock gestützt, der im Schlick lag. Es ging schlecht, nach zehn Schritten schon musste sie sich hinsetzen. Dabei hatte sie wirklich keine Zeit mehr. Es war schon erstaunlich, wie schnell das Wasser stieg.
Am besten, sie lief zur vorgeschobenen Landspitze mit ihrer Steilküste! Das konnte sie schaffen – der Weg war nicht so weit. Humpelnd und heulend vor Schmerz arbeitete sich Tina voran. Das Wasser umspülte ihre Füße und schaffte etwas Linderung, gleichzeitig aber wurde das Gehen mühevoller und die Kräfte ließen nach.
Sie erreichte erschöpft das Steilufer. Die Wellen rollten bereits in Kniehöhe heran und Tina blieb keine Zeit zum Ausruhen. Die Springflut kam, sie musste einen Weg nach oben finden. Doch eine Kletterkünstlerin war sie nie gewesen.
Als sie den Höhleneingang in etwa drei Metern Höhe entdeckte, atmete sie etwas auf. Ob das Wasser bis dorthin kam? Egal, sie hatte nur diese Möglichkeit. Zum Glück gab es hier genügend Vorsprünge, so dass sie sich, samt Bündel und Stock, hinaufhangeln konnte.
Ein Gang führte ins Berginnere, doch das interessierte Tina im Moment nicht. Die kleine Plattform vorn genügte ihr, dort konnte sie sogar noch in der Sonne sitzen. Allerdings war es mittlerweile später Nachmittag. Heute würde sie bestimmt nicht mehr von hier wegkommen.
Tina dachte an ihre Eltern, die in der Nacht ins Urlaubsquartier zurückkehren würden. Wenn sie die Tochter nicht antrafen, würden sie sich mächtig aufregen und Angst um sie haben. Doch daran konnte sie nichts ändern. Erst Stunden später würde die Flut wieder zurückgehen, vorläufig stieg sie noch. Sie würde bald die Plattform erreicht haben. Das Mädchen schaute einige Zeit zu, dann beschloss sie, sich für alle Fälle in der Höhle umzusehen.
Sie humpelte durch einen engen Gang, der leicht anstieg. Schauerlich war es hier, feucht und voller unerklärlicher Geräusche. Es gluckste und rauschte, Tropfen fielen von den Wänden, glitten Tina den Rücken hinunter. Dann war der Gang zu Ende und sie stand zu ihrer Überraschung in einer weit gedehnten Grotte. Eine hohe Decke und zu ihren Füßen Wasser. Hinter einer Art Graben aber lag erhöht eine kleine Insel.
Tina wollte zum Plateau zurück, da kam ihr bereits Wasser entgegen. Kein Zweifel, es war besser, hier drin abzuwarten, am besten auf der Insel. In der Grotte war es nicht gerade warm, doch einige Stunden würde sie schon durchhalten.
Tina zog die Jeans aus und begann durch den Graben zu waten. Vorsichtig und in der Hoffnung, dass er nicht allzu tief war. Ein grünliches Licht kam von oben, drang offenbar durch irgendwelche Felsspalten. Viel konnte sie nicht erkennen, aber sie kriegte mit, dass das Wasser klar war. Der Boden war fest, nur ab und zu tappte sie in Schlamm.
Sie war in der Mitte des etwa zwanzig Meter breiten Grabens, stand fast bis zur Hüfte im Wasser, als ihr etwas ans Bein glitschte. Gleichzeitig gab es einen Platsch hinter ihr, so dass sie erschrocken zusammenzuckte. In dem Wasser waren Fische und sie mussten groß sein. Der an ihrem Bein hatte sich wie ein schlabbriger Schwamm angefühlt.
Tina erstarrte und bemühte sich, das Wasser auszuforschen. Hoffentlich keine Schlangen oder Echsen, die womöglich noch an Land kamen. Sollte sie zum Höhlenausgang zurück? Doch das ging nicht, die Flut überspülte bereits den Gang.
Plötzlich sah Tina einen der Fische. Er schwamm genau vor ihr und glotzte sie an. Er war fast einen Meter groß und hatte so etwas wie ein Gesicht. Als sie eine Bewegung machte, glitt er träge zur Seite. Und nun erblickte das Mädchen auch die anderen. Ganze Scharen umringten sie, waren neben, hinter und vor ihr. Wo kamen die auf einmal alle her?“
1963 erschien im Kinderbuchverlag Berlin „Die Reise nach dem Rosenstern. Ein Märchenbuch“ von Herbert Friedrich, gedacht für junge Leserinnen und Leser von 10 Jahren an: Der Stern des Drachen soll das Ziel der internationalen Raketenexpedition sein, die sieben mutige Wissenschaftler und Forscher aus sieben verschiedenen Ländern der Erde unternehmen wollen. Zehn Jahre sind eine lange Zeit, deshalb soll jeder eine Geschichte zum Besten geben, damit sie sich besser kennenlernen. Unvorhergesehene Dinge komplizieren die Reise: Der sowjetische Wissenschaftler erkrankt, das Raumschiff weicht aus geheimnisvollen Gründen vom Kurs ab, und ein blinder Passagier taucht auf. Doch alles nimmt ein gutes Ende. Aber dazu muss die Reise erstmals losgehen:
„Die Reise nach dem Rosenstern
Wer von den Lesern kennt nicht jenes Gefühl, das sich einstellt, wenn man sich auf eine längere Reise begibt: das Gemisch aus Abenteuerlust und Erwartung, durchdrungen von dem Bedauern, liebe Menschen zurücklassen zu müssen, und von der Angst, etwas Entscheidendes vergessen zu haben. Die Bahnhöfe der Welt wissen ein Lied davon zu singen, und dies ist sehr lang und abwechslungsreich.
Der Bahnhof, auf dem sich der Kasache Ali Kassim von Frau und Kind verabschiedete, war der Himmelsbahnhof in der Wüste Gobi, und seine Reise sollte nicht mehr und nicht weniger als zehn Jahre dauern. Sein Sohn, der wenige Wochen vorher die ersten Schulbücher bekommen hatte, würde bei seiner Rückkehr das Fest der Schulentlassung begehen. Während Ali Kassim dem Jungen übers Haar strich, dachte er weniger daran, vielmehr dachte er an die Expedition, denn er war deren Leiter. Die Expedition sollte geradewegs zum Stern des Drachen im tiefschwarzen All führen, und ihre Rakete würde so schnell fliegen, dass sie mit jedem Augenzwinker tausend Meilen vorankam, fünfmal zwölf Monate lang. Und die Wissenschaftler hofften, dass sich nach dieser Zeit die Beobachtungen bestätigten, nämlich dass der Stern des Drachen von menschlichen Wesen bewohnt sei. Was für Wunderdinge, die reinsten Märchen, hatte man in den letzten Jahren von jenem Stern geschrieben, gemalt, behauptet und erfunden. Ali Kassims Expedition war dazu ausersehen, die Wahrheit zu ergründen.
Nicht zu übersehen war die Menschenmenge, die den Startplatz vor der turmhohen Rakete Fliegender Drache belebte. Alle Sprachen der Erde konnte man hier vernehmen. Scheinwerfer zuckten, Lautsprecher brüllten, Zeitungsreporter, Radioreporter, Fernsehreporter hasteten, redeten, notierten. Ein warmer Regen fiel sacht, als wollte er die Menschen erfrischen, damit sie umso mehr jubeln, schreien, lachen konnten.
Inmitten dieses Menschenwirbels gab es eine ruhige Insel. Dort standen jene Männer, die die Reise antreten wollten, sieben an der Zahl und ausgerüstet mit dem höchsten Wissen, das ihnen die Erde zu geben vermocht hatte. Ein jeder zählte für fünf, so vielseitig waren sie. Ein jeder stand für zehn, die die Aufgaben genauso gut wie sie gemeistert hätten.
Ali Kassim, der Leiter, Chemiker aus der Stadt Karaganda, winkte ihnen, und sie traten von ihren Familien zurück. Der türkische Astronom Tschelebi küsste seinen Sohn, den siebenjährigen Ahmed, und streichelte den weißgefiederten Hund Miramara, der sich an den Beinen des Knaben rieb.
Der Filmoperateur Dolezal aus Praha machte die letzten Aufnahmen von seiner jungen Frau Jana. Er schwenkte mit der Kamera über Frau Tschelebi und Ahmed und den wolfsstarken Federhund Miramara und hielt noch einmal auf dem Filmstreifen fest für die langen Tage im Fliegenden Drachen, für die zehnjährige Reise: die Eltern des jungen Konstrukteurs und Mechanikers Fischer aus Dresden, die wunderschöne Mona, Frau des Biologen Molo aus dem Kongo, und ebenso die Frau des Arztes Matsumoto aus Tokio, deren Söhne ihr schon bis zur Schulter reichten.
Einzig und allein der Moskauer Boris Stepanowitsch Minajew stand ohne Angehörige auf dem Feld. Es schien Kassim, da er so seine Freunde musterte, als fühle sich der russische Geologe einsam. Zehntausend Menschen hier, doch niemand gehört zu Boris, begleitet ihn zum Abschied – ja, das kann man wohl Einsamkeit nennen.
Mit schnellem Schritt ging Kassim auf Minajew zu und hakte den Freund unter. „Komm, Boris, die Sterne warten!“
Ein Mikrofon wurde ihnen vorgehalten, und ein Reporter keuchte: „Schnell noch einige Worte für die Hörer des Weltfunks.“
Und Ali Kassim sagte, ruhig, wie es seine Art war: „Wir werden den Menschen, gleich wo wir sie im All treffen mögen, eure Grüße und eure Geschenke bringen; und mitbringen werden wir euch ihre Freundschaft.“
Und Boris, der Einsame, rief in das Mikrofon: „Ich grüße Lida und die kleine Galotschka.“ Dann zog ihn Kassim zum Fahrstuhl.
Jeder der sieben wandte sich noch einmal um auf dem erhöhten Podest, bevor er den Fahrstuhl betrat, und grüßte die Menge.
Als der Astronom Tschelebi winkte, geschah ein Zwischenfall. Sein Sohn Ahmed winkte selbstvergessen zurück, da riss sich plötzlich der Federhund Miramara los, so dass der Junge zu Boden geschleudert wurde. Der Hund bellte sein hohes Bellen und stand mit einem Sprung auf dem Podest. Durch den Anprall verlor Vaclav Dolezal den Boden unter den Füßen, und über ihn hinweg huschte das Tier in den Fahrstuhl.
Ahmed weinte, das Knie böse zerschrammt, doch umso mehr, da er den Hund nicht hatte halten können. Die Menge schrie auf.
„Noch fünf Minuten bis zum Start!“, schnarrte der Lautsprecher. Der Absperrdienst drängte die Menschen zurück. Ahmed schaute sich schluchzend nach dem Podest um, wo sich sein Vater befand und sein Hund.
Tschelebi sprang in den Fahrstuhl, um den Hund herauszuzerren, flog aber selber heraus, da sich das Tier wehrte. Dolezal rappelte sich hoch, schaute nach der empfindlichen Kamera und hoffte, dass der Film nicht verdorben sei.
„Noch drei Minuten bis zum Start!“, dröhnte der Lautsprecher.
Kassim schrie: „Einsteigen in den Fahrstuhl!“
Mit vereinten Kräften versuchten sie, den Hund hinauszuwerfen. Der fletschte die Zähne und knurrte und sträubte die Federn. Es war ein sonderbares Schauspiel. Minajew riss einen Riemen aus der Tasche. Kameraleute aller Erdteile filmten mit Teleobjektiven aus der Ferne den Kampf.
Ein Zweirad durchbrach die Absperrkette. Im Nu stand es vor der Plattform. „Telegramm für Boris Minajew!“
Betroffen ließ der Russe den Hund fahren und hetzte die Treppe hinunter.
„Noch zwei Minuten bis zum Start!“, tönte die Stimme unbarmherzig aus dem Lautsprecher. Desungeachtet riss am Fuß der Treppe Boris Minajew den Umschlag auf. Er erbleichte, wankte. Der riesige Kongolese Molo schleppte ihn in den Fahrstuhl.
„Alles da!“, schrie Kassim. „Ab!!“
In der Ecke saß Tschelebi und klopfte den Hals des Hundes. Sekunden später erreichten sie die Rakete.
Alle stiegen sofort durch die Schleuse, während der Türke seinen Hund hielt und liebkoste. „Es hat keinen Zweck, Miramara, du treues Tier. Es hat keinen Zweck, du musst zurückbleiben. Achte auf Ahmed, Miramara, und auf seine Mutter Fatma.“ Verständnisvoll blickten ihn die Hundeaugen an. Das Tier schlug mit der Rute, doch entging ihm keine Bewegung. Als Tschelebi tollkühn aus dem schon abwärts sinkenden Fahrstuhl in die Rakete springen wollte, war der Hund schneller. Tschelebi fiel zurück, fluchte auf türkisch und sauste mit dem Fahrstuhl nach unten, indes der Federhund Miramara zwischen den Männern durch in den Steuerraum der Rakete stob.
Sofort wurde Tschelebi wieder nach oben gefahren. Als er zu seinem Platz wankte, blinzelte der Hund listig.
„Fünf … vier … drei …“, zählte Kassim. Tschelebi blickte den Hund grimmig an, während er sich festschnallte.
„… zwei … eins … los!“ Eine ungeheure Faust schien sie in die Sitze zu pressen.
Draußen zuckten die Triebwerke, die Menschen winkten und schrien, die Kameras hielten jeden Augenblick des Starts für kommende Zeitalter fest. Dann war der Fliegende Drache in den Wolken verschwunden.
Als sie ruhig flogen, als der Blauhimmel der Weltraumnacht gewichen war, schnallten sie sich los und schauten nach dem Hund. Miramara lag zufrieden hingestreckt. Keiner Mücke schien er ein Leid zufügen zu können, nun, da er seinen Willen durchgesetzt hatte. Und er lag zu Minajews Füßen, als wolle er ihn wegen der zerbissenen Hand um Entschuldigung bitten. Jetzt erst entdeckten die anderen, dass die Hand des Geologen blutete. Er hatte es wohl selbst kaum bemerkt, da er wie abwesend schien, nachdem er das Telegramm gelesen hatte.
Der Astronom Tschelebi tadelte seinen Hund heftig, was dieser zähneknirschend über sich ergehen ließ. Die beste japanische Heilsalbe trug der Arzt Matsumoto herbei, um Minajews Schmerzen zu lindern.
„Das war ein überstürzter Aufbruch“, sagte Ali Kassim in seiner weichen Sprache. „Wir haben einen Mitreisenden mehr an Bord. Das soll uns nicht stören. Stärken wir uns in den langen Monaten, die vor uns liegen, für die Aufgaben auf dem fremden Stern.“
Sie nickten freudig, und der lustige Vaclav Dolezal erzählte einen Witz, worüber alle lachten. Allein Boris Minajew saß bleich und nachdenklich mit verbundener Hand, wie er von Anbeginn gesessen hatte.
Langsam gewöhnten sie sich an das Leben im Fliegenden Drachen, und sie arbeiteten wie besessen. Fischer kontrollierte die Geräte, Kassim saß im Laboratorium. Der Kongolese Molo betreute den botanischen Garten, der Türke Tschelebi durchforschte die schweigende Sternenwelt, in die sie sich hineinbohrten.
Eine lange Woche flogen sie bereits, als Dolezal sie in den Klubraum bat, und während die Steuermaschine den Fliegenden Drachen auf dem richtigen Kurs hielt, schaltete der Filmoperateur aus Praha geheimnisvoll lächelnd das Licht aus.
Auf einmal schwebten vor der getönten Wand greifbar nahe die schöne Jana und Fatma Tschelebi aus Istanbul mit dem kleinen Ahmed, der den Federhund Miramara hielt. Mona, die Kongolesin, lächelte, und Fischers Eltern winkten. All dies war so getreu in Farbe und Ton, so plastisch und lebendig, dass es schien, als befänden sich jene Personen unter ihnen.
Sie saßen stumm, als Dolezals Zauberfilm erlosch, und Minajew seufzte. Keine Frau, kein Kind waren in diesem Zauberspiegel aufgetaucht, die sich von ihm verabschiedet hätten.
In die Stille hinein sprach Kassim: „Vor langer, langer Zeit, da meine Väterväter als Nomaden durch jene Hungersteppe zogen, die heute längst blühendes Gefilde ist, als die Karawanen aus Persien nach Taschkent und Buchara wanderten, monatelang, da pflegten die Männer am abendlichen Lagerfeuer ihre Kinnbärte zu streichen und Geschichten zu erzählen.
So überstanden sie besser die Plagen und Entbehrungen, und die Reise verging ihnen wie im Flug. Auch wir sollten es so halten. Lasst uns erzählen! Wir erfreuen uns an den Geschichten und lernen uns kennen, und wenn die Zeit unsere Kraft braucht, werden wir stark sein.“
Die Männer bekräftigten die Worte des Kasachen Ali Kassim, und sie beschlossen, regelmäßig in freien Stunden zusammenzukommen und reihum zu erzählen. Und mit jeder ihrer Erzählungen verstrichen auf Erden sechs Monate.
„Sicher“, begann Murad Tschelebi, der Astronom aus Istanbul, „begehrt ihr zu hören vom Hund Miramara, der bei uns eingedrungen ist. Ihr habt gesehen, meine Freunde, er ist klug und stark. Ich wusste von vornherein, dass es vergeblich sei, ihn aus dem Fahrstuhl zu werfen. Es hätte nur ein Mittel gegeben, ihn zurückzuhalten, nämlich ihn zu töten. Ja, ich hätte ihn töten müssen, um die Expedition nicht mit ihm zu belasten. Aber ihr wisst nicht, was Miramara für mich getan hat. Darum lasst euch erzählen.“
Da setzten sich die Männer zurecht, zündeten Zigaretten an und lauschten der Geschichte …“
1980 veröffentlichte Herbert Friedrich im Verlag Neues Leben Berlin „Der Vogel Eeme. Die Ostindienreise des Holländers Cornelis de Houtman 1595-1597“. Für das E-Book wurde die 4. Auflage von 1989 verwendet. Der Vogel Eeme, ein riesiges schwarzes Tier mit langem Hals, kleinem Kopf und mächtigen Füßen, wird dem Schiffer der „Amsterdam“ von einem javanischen Fürsten als Geschenk überbracht, Wenige Tage später wird die „Amsterdam“ von Javanern überfallen. Als sie sich zurückziehen, gleicht die Kuhl einem Schlachthaus. Die „Amsterdam“ ist leck, sie wird verbrannt. Die drei anderen Schiffe der Flotte nehmen Heimatkurs, ohne ihr Ziel je erreicht zu haben. So endet die dramatische Handelsexpedition unter Cornelis de Houtman, der Pfeffer und Gewürze für Holland kaufen sollte und der nichts anderes mitbrachte als den Vogel Eeme, das Molukkentier. Die erste Reise der Holländer nach Ostindien Ende des 16. Jahrhunderts bildet den Hintergrund dieses Romans, in dem Herbert Friedrich historische Quellen erschließt und dem Leser ein eindrucksvolles Bild der niederländischen Seefahrt vermittelt. Hier der dramatische Beginn des spannenden Buches:
„Das Buch der Commis
1
Am 2. September 1595, dem Tag, da wir endlich Madagaskar sahen, starb Pieter Claessen, Waffenmeister, und wurde zur gleichen Stunde über Bord geworfen. Item da starb noch unser jüngster Segelmacher zur selben Zeit und wurde über Bord geworfen, Gott sei allen Seelen gnädig. Item den 4., immer vor Madagaskar, starb unser Feuerwerker, genannt Hans van Staaten, und hatte lange gelegen im großen Elend, so dass er krank am Geist geworden war und den ganzen Tag gelacht und geflucht hatte. Und einen Tag bevor er starb, wollte er eine kleine Kanone haben, um damit die Hölle zu stürmen. Item denselben Tag starb unser Küfer Hendrijk van Deuenter und wurde über Bord geworfen vor Madagaskar. Am 13. aber starb Wouter, genannt der Gekappte Aff, und wurde dieselbe Nacht über Bord geworfen. Und am 18. dito starb Jost Worstraeten und ging den Weg in das Wasser. Jan Dittmers starb am 20., und den Tag danach starb Claes Heck, der immer unsere Takelung ausgebessert hatte, und wurde auf einem EILAND vor Madagaskar begraben …
So hatte nach der Entdeckung dieser winzigen madagassischen Insel als Begräbnisplatz mancher den Vorteil, statt in Wasser in Erde zu gelangen, und man nannte sie schon nach der ersten Bestattung den HOLLÄNDISCHEN FRIEDHOF. Die Toten aber kamen von allen vier Schiffen, die sich da zwischen Insel und dem festen Land von Madagaskar bargen, der MAURITIUS, dem Prinzenschiff, und der HOLLANDIA, dem Staatenschiff, der AMSTERDAM, dem Schiff der Stadt, und auch der kleinen Pinasse, dem TÄUBCHEN. Der Skorbut hatte sie hier zusammengefegt zwischen Steinriffen und Klippen, in einer schwülen Feuchte, von der Weite des Ozeans heruntergeholt, auf der sie bestrebt gewesen waren, Indien anzugehen.
In der Nacht zum 21. September starb Issbrant Jacobsen, der Oberzimmermann der HOLLANDIA, von den Ratten schon angefressen, und Tuenis, der Feuerwerker, starb des Morgens, im ersten Flirren des Lichts, also dass beide zugleich über Bord geworfen wurden vor der Insel HOLLÄNDISCHER FRIEDHOF.
Gerrit van Boninghen lehnte an der Reling, ein Würgen im Halse, und sah die Körper versinken, und wenn es Haie hier gäbe, dann hätten sie gute Zeiten. Er verspürte keine Lust, um sich zu blicken, in angststarre Augen, übel riechende Münder zu Fragen sich öffnen zu sehen, auf die er keine Antwort wusste. Er hatte aber nicht davon abgelassen, jeden Toten bis an die Reling zu begleiten. Die letzte Zeit, da nun auch der Schiffer krank lag, hatte er statt seiner Worte des Abschieds mitgegeben für Gott und den langen Weg in die Ewigkeit. Manchmal war ihm, als versänke da auch ein Stück von ihm, und manchmal war er nur wie betäubt; das machte die Schwäche, gegen die auch er nicht gefeit war.
Er war ein Mann Anfang Dreißig, mit offenen, freien Zügen, sehr selbstbewusst und voll Witz, was vor allem die Jungen an Bord schätzten, von denen mancher nicht gedacht hätte, dass gerade Boninghen ihn von dieser Welt verabschieden würde. Der Seewind blies in sein volles Haupthaar, das die Ohren bedeckte und wie der Bart weich und von brauner Tönung war. Er fuhr als Commis der HOLLANDIA, war also neben den Commis der anderen Schiffe einer der vier mächtigen Männer der Flotte, die Leinwand, Sammet, flämische Tuche nach Indien zu bringen hofften, um sie zu verwandeln in Näglein und Pfeffer und Muskat. Sunda Calapa war das Ziel, Java mithin, was vorher wohl Portugiesen und Spanier erreicht hatten, NIE dagegen holländische Schiffe.
Also stand die kleine Flotte vor der einzigartigen Aufgabe, für Amsterdam den Weg zum Pfeffer zu erschließen, Spaniern und Portugiesen zum Trotz. Die Stadt an der Amstel, von der sie ausgefahren waren, hatte es sich etwas kosten lassen. Ja, sie hatte ein Übriges getan, hatte ein zweites Eisen ins Feuer gelegt: Zur selben Zeit wie diese vier Schiffe hatte sie die Herren Barents und Nay mit sieben weiteren seetüchtigen Kähnen ausgeschickt, ebenfalls nach Indien, aber im Norden von Asien, auf dem Weg durch das Eis! Indien war reif für Holland, es musste endlich fallen.
Aber nun war diesen vier Schiffen südlich des Äquators die Reise versackt. Der Skorbut, der schaurige Passagier, hatte die Mannschaft dezimiert. Die Schiffe starben aus. Das nächstliegende Ziel war, nicht Meilen nach Java hinter sich zu bringen, sondern Versorgungsplätze zu suchen, frische Nahrung herbeizuschaffen, damit Schwellungen zurückgingen, Blutungen aufhörten, Zähne sich festigten und von jenen, die die Krankheit überstanden, die gedrückte Stimmung wich.
Seit dem letzten Ankern waren sie vierhundertdreißig Meilen gesegelt, und nun bei Madagaskar hatten sie mehrmals versucht, die Südspitze zu umrunden, hatten keine Bai gefunden, keinen Fluss, nur allein hier endlich den guten Ankergrund am HOLLÄNDISCHEN FRIEDHOF, eine halbe Meile vom Wall.
Es gab keinen Zweifel: Die kleine Flotte war übel daran. Wer hier Verantwortung zu tragen hatte, war keinesfalls zu beneiden. Nur einen einzigen Mann aber wusste Boninghen über sich in der gesamten Flotte: den Obercommis Cornelis de Houtman auf der MAURITIUS, als dessen Vertreter er galt.
Boninghen spie über die Reling; er dachte an den langen Weg von Amsterdam bis eben zu diesem HOLLÄNDISCHEN FRIEDHOF, und der Weg nach Java war noch weit und der Weg nach Hause wie in den Sternen.
Er steckte voll einer trägen Müdigkeit, die vielleicht auch schon Anzeichen des Skorbuts war, und hatte immer vor, in seine Kajüte zu steigen, um das vom vielen Sterben niederzuschreiben. Er konnte sich aber nicht aufraffen. Das Schiff schaukelte in der leichten Dünung und das Kabel, mit dem der Anker es hielt, knarrte.
„Commis“, sprach da einer hinter ihm, und als er sich umwandte, war es der junge Eemskerck, einer der zahlreichen Aspiranten. „Commis“, sagte Eemskerck in seiner raschen Art, „Herr Heynck ist gekommen, er möchte Sie sprechen.“
Boninghen blickte kurz auf. Barent Heynck, Commis der MAURITIUS, Sekretär der Flotte und rechte Hand Houtmans, kam auf die HOLLANDIA, kaum aber deshalb, um die Zahl der Gestorbenen zu erfragen! Da schob er sich vom Schanzkleid ab und legte Eemskerck die Hand auf die Schulter. Na, gehen wir, Aspirant, mal sehen, was der Heynck will.
Heyncks Boot, das ihn herübergebracht hatte, lag auf der anderen Seite der HOLLANDIA, so dass Boninghen es nicht hatte kommen sehen. Der Ankömmling saß bereits auf der Treppe zum Halbdeck, ein Barett in die Stirn gezogen gegen die viele Sonne. Er blieb sitzen, als Boninghen hinzutrat; auch die Hand streckte er nicht aus.
Heynck, was ist aus uns geworden! In Amsterdam standen wir besser zueinander, als wir noch genug Wein hatten, kredenzt von schönen Frauen. Einmal hatte der Heynck seine eigene Freundin beim Würfelspiel gesetzt, eine kleine Schwarze war das gewesen, zur Zeit, da Sarah schon krank lag. Und Boninghen hatte gewürfelt und – verloren! Gelächter. Wer weiß, was sonst geworden wäre mit dieser Kleinen … Wir hatten ’ne Menge zu lachen, Heynck. Hin ist hin.
Da hockte nun dieser Barent Heynck übellaunig und maulte heraus, dass der Generalschiffsrat beschlossen habe, das kleinste Schiff, TÄUBCHEN, auf die Suche nach Frischwasser auszuschicken. Denn der Karte nach lägen sie nicht weit von einem Fluss.
Boninghen musterte den Gleichaltrigen, Gleichrangigen, sah eine kräftige, schief gezogene Nase, vorgeschobene Unterlippe, einen festen Mund, der nun von sich gab, was längst bekannt war.
Er unterbrach Heynck nicht, der alles wohlgesetzt erläuterte. Dann kam es so, wie er erwartet hatte: Auch zu neuem gelangte Heynck endlich, denn wegen Zeug, was die Tauben schon vom Dach gurrten, hatte Houtman ihn nicht hergeschickt. Barent Heynck sagte sehr förmlich: „Sie, Herr van Boninghen, haben sich an Bord der Pinasse zu begeben und werden sie auf ihrer Fahrt begleiten.“
Es gelang Boninghen, seine Überraschung zu verbergen, während Heynck ihn fixierte. Dann sagte er etwas, was er sofort als töricht empfand. „Ich werde es mir überlegen.“
Heynck lächelte nur daraufhin, es zog seinen Mund schief. „Das ist ein Befehl!“
Boninghens schmale dunkle Augen blieben kühl; er merkte aber, dass sein Herz schneller schlug. Ein Befehl. Da wurde ihm befohlen, nicht mit der Pinasse zu gehen; sondern die HOLLANDIA zu verlassen! Jetzt, jetzt die HOLLANDIA zu verlassen!
Das hörte er als erstes heraus. Das konnten sie nicht ernstlich wollen! Fordernd streckte er die Hand aus. Da griff sich Heynck wirklich unters Wams und zog ein Papier heraus. Und Eemskerck stand immer dabei.
Mit erzwungener Gleichmut nahm Boninghen das Schreiben an sich. Er hatte Mühe, seine Zunge zu zähmen, Spott über Heynck zu gießen. Pack die Würfel aus! Knobeln wir, wer mitfährt? „Ich werde dem Schreiben meine Achtung nicht versagen“, brachte er herb hervor und ging davon, um sich nicht noch mehr zum Narren machen zu lassen.“
Manchmal regt die Lektüre eines Buches auch dazu an, zu überlegen, wie man sich selber anstelle der handelnden Personen verhalten hätte. Wie hätten Sie als Gerrit van Boninghen reagiert? Welchen Entschluss hätten Sie gefasst? Aber auch die anderen vier Sonderangebote dieses Newsletters bieten ausreichend Gelegenheiten zu solchen Gedankenexperimenten.
Viel Vergnügen beim Lesen, weiter einen schönen November, der sich mit wechselnden Wettern präsentiert, bleiben Sie angesichts der aktuellen Corona-Tendenzen weiter vorsichtig, vor allem aber weiter schön gesund und munter und bis demnächst.
EDITION digital war vor 27 Jahren ursprünglich als Verlag für elektronische Publikationen gegründet worden. Inzwischen gibt der Verlag Krimis, historische Romane, Fantasy, Zeitzeugenberichte und Sachbücher (NVA-, DDR-Geschichte) sowie Kinderbücher gedruckt und als E-Book heraus. Ein weiterer Schwerpunkt sind Grafiken und Beschreibungen von historischen Handwerks- und Berufszeichen sowie Belletristik und Sachbücher über Mecklenburg-Vorpommern. Bücher ehemaliger DDR-Autoren werden als E-Book neu aufgelegt. Insgesamt umfasst das Verlagsangebot, das unter www.edition-digital.de nachzulesen ist, mehr als 1.100 Titel. E-Books sind barrierefrei und Bücher werden klimaneutral gedruckt.
EDITION digital Pekrul & Sohn GbR
Alte Dorfstraße 2 b
19065 Pinnow
Telefon: +49 (3860) 505788
Telefax: +49 (3860) 505789
http://www.edition-digital.de
Verlagsleiterin
Telefon: +49 (3860) 505788
Fax: +49 (3860) 505789
E-Mail: editiondigital@arcor.de
![]()