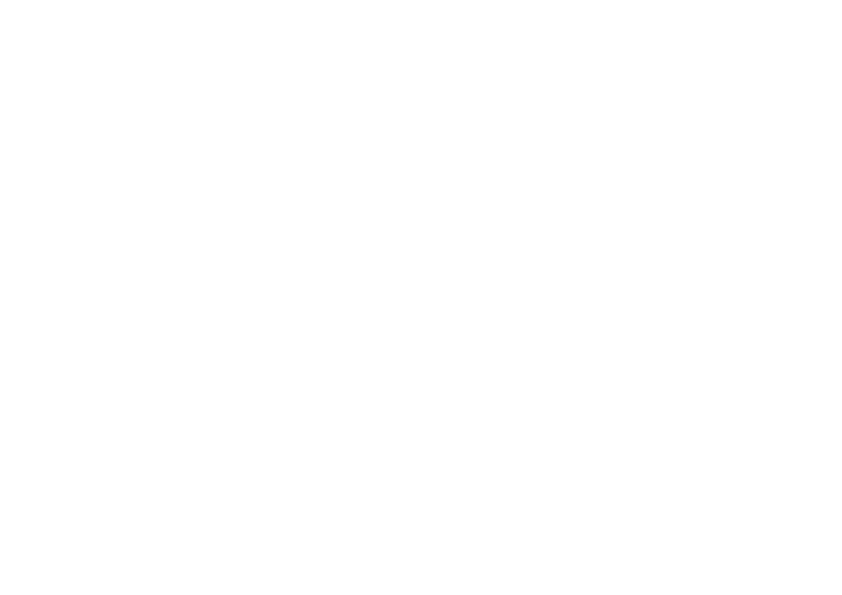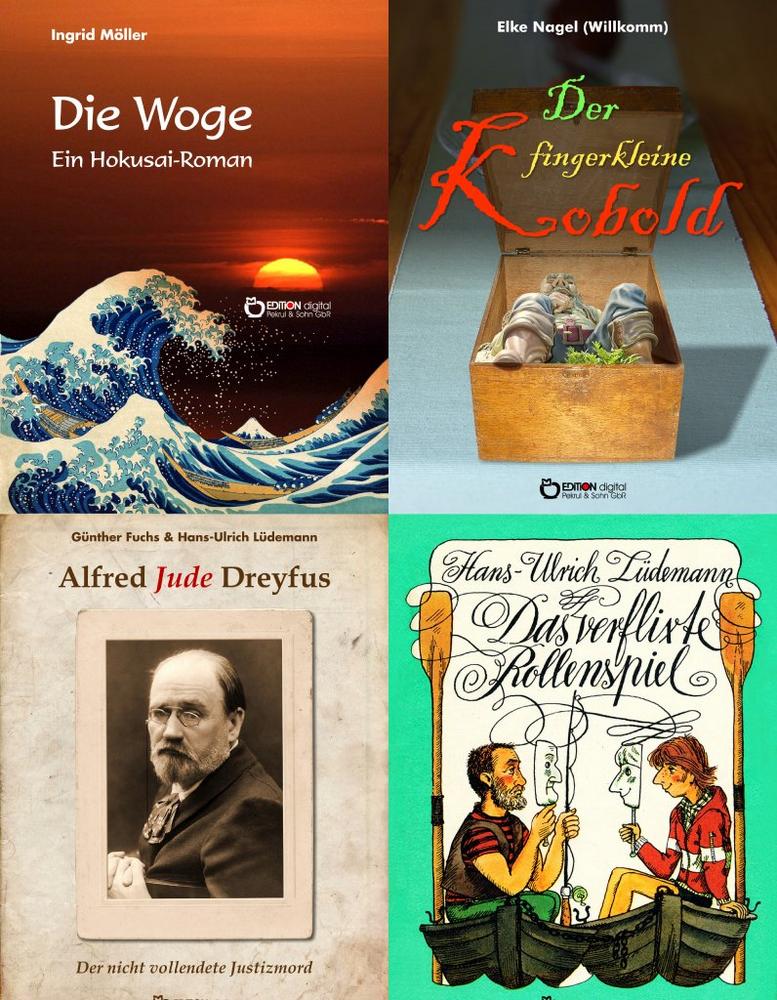Auch die nächsten beiden preiswerten Wochenangebote stammen (und diesmal ohne Co-Autor allein) von Hans-Ulrich Lüdemann: Im „Verflixten Rollenspiel“ geht es um einen schweren Verkehrsunfall und seine ungeahnten familiären Folgen sowie um eine besondere Form der Kommunikation – eben das verflixte Rollenspiel. „Patenjäger“ beschreibt ein heute kaum noch bekanntes Kapitel der DDR-Geschichte und kann zugleich als schriftlicher Beweis dafür dienen, dass damals mehr veröffentlicht werden konnte, als man heute annimmt oder – aus welchen Gründen auch immer (zum Beispiel aus Unwissenheit) behauptet.
Ein ganz anderes Thema greift Ingrid Möller in ihrem Hokusai-Roman „Die Woge“ auf, in dem sie ihre Leser mit dem Leben und Werk eines der in Europa vielleicht bekanntesten japanischen Künstler bekanntmacht, dessen Name sich übrigens wie Hok-Sai ausspricht. Alles begann damit, dass ein holländischer Kapitän um 1800 Bilder eines bis dahin unbekannten Japaners aus dessen damals streng abgeschirmtem Kaiserreich nach Europa schmuggelte. Oder war es gar kein holländischer Kapitän, sondern ein bayerischer Abenteurer?
Schließlich bringt das aktuelle Angebot an Deals der Woche noch ein hübsches kleines Kinderbuch, in dem zwei erstmals 1978 und 1979 veröffentlichte Texte von Elke Nagel (Willkomm) zusammengepackt worden sind: „Der fingerkleine Kobold“ und „Wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen“.
Erstmals 1995 erschien im Kiro Verlag Schwedt „Alfred Jude Dreyfus. Der nicht vollendete Justizmord“ von Günther Fuchs und Hans-Ulrich Lüdemann: Alfred Dreyfus wurde am 9. Oktober 1859 in Mülhausen geboren, für Sterndeuter und andere Astrologen also im Zeichen des Sternbildes Waage. Das Bild der Waage wird bestimmt durch zwei Schalen, die sich im ungefähren Gleichgewicht befinden. So mag es bei Alfred Dreyfus zu Beginn und zum Ende seines Lebens gewesen sein. In der Kindheit und auf dem Bildungsweg schien seine Welt wohl noch in Ordnung zu sein. Auch als er das Glück hatte, die Tochter eines wohlhabenden Juweliers zu freien, stand sozusagen die Plus-Schale steil nach oben. Dass ihm altersmäßig sein Bruder Mathieu um zwei Jahre voraus war, sollte sich als reiner Glücksfall für die Waage Alfred Dreyfus‘ erweisen. Mit dem Geld seiner Frau Lucie beziehungsweise des Schwiegervaters entwickelte sich der Offizier zu einem Lebemann und Schürzenjäger und die Gewichtung in seinem Dasein ließ die negative Schale Überhand gewinnen. Es sollte noch schlimmer kommen: Als es ruchbar wurde, dass im Generalstab der französischen Armee ein Verräter den deutschen Militärattaché v. Schwartzkoppen mit geheimen Nachrichten versorgte, da fiel wie automatisch der Verdacht auf den Weiberheld und Spieler Alfred Dreyfus. Die Führung der Armee hätte es weit von sich gewiesen, dass sein Judentum nicht wenig zum Unheil des Hauptmanns beitrug. Antisemitismus spielte Ende des 19. Jahrhunderts und darüber hinaus eine bedeutende Rolle in der französischen Gesellschaft. Kurzum ein Sündenbock war gefunden und am 15. Oktober 1894 wurde Dreyfus verhaftet. Die Anklage war schnell erhoben und der Volkszorn verlangte ein hartes Urteil gegen den jüdischen Hauptmann, der angeblich gegen etliche Silberlinge Verrat verübt hatte. Keine Zweifel quälen sie. Alfred Dreyfus war als deutscher Spion entlarvt. In der Folgezeit schmiedeten Militärs, oftmals wider bessren Wissens, an dem Komplott gegen ein ehemaliges Mitglied des Armeekorps. Nach einem Schauprozess wird er zu lebenslanger Haft auf die Teufelsinsel nach Französisch-Guayana verurteilt. Am 5. Januar 1895 erfolgt seine öffentliche Degradierung. Am 13. April 1895 tritt Alfred Dreyfus seine Haft in der lebensfeindlichen Strafkolonie an. Er ist am Boden zerstört, was ihn nicht hindert, immer noch an einen Justizirrtum statt an eine Intrige seiner Vorgesetzten zu glauben. Es betritt der ältere Bruder Mathieu die Szene. Dank seines Engagements finden Dreyfusards wie Zola oder Clemenceau eine gemeinsame Plattform. Auch die Antidreyfusards organisieren sich. Besonders vor ihnen hat die reiche jüdische Schicht wie die unermesslich reichen Rothschilds Angst, so dass keiner von ihnen Geld oder Worte für den übel bedrängten Glaubensbruder übrig hat. Ein spannendes Kuriosum bietet die so genannte Affäre Dreyfus: Ausgerechnet der spätere Chef des Armee-Geheimdienstes lässt sich aufgrund unwiderlegbarer Beweise von Dreyfus‘ Unschuld überzeugen. Das ist umso bedeutsamer, war Major Marie-Georges Picquart doch als überzeugter Antisemit bekannt. Als ein tödliches Kesseltreiben durch die zum Teil senilen Schurken im Generalstab gegen ihn beginnt, hält er unbeirrt an seiner Überzeugung fest. Die moralische Größe dieses Militärs ließe sich ermessen, wäre bekannt, dass Erich Mielke, einstiger Chef der DDR-Staatssicherheit, irgendwann einmal die charakterliche Integrität eines Antikommunisten anerkannt hätte. So gesehen, ist Marie-Georges Picquart nach Mathieu Dreyfus der tatsächliche Held in jenen Tagen. Nicht zu vergessen Tausende Intellektuelle, in ihrer Mitte mit seinen kämpferischen und vor allem weltweit beachteten Texten wie „J’accuse!“ der Schriftsteller Emile Zola. „ICH KLAGE AN!“ wirkte wie eine geschleuderte Brandfackel, die alle Ecken des militärpolitischen Sumpfes in Frankreich ausleuchtete. Irgendwann hatte das Schicksal ein Einsehen mit Alfred Dreyfus. Verschiedene turbulente Ereignisse innerhalb und außerhalb von Gerichtsgebäuden führten dazu, dass er am Ende rehabilitiert wurde. Für die wahren Verräter gab es keine gerechte Strafe; Maximilian von Schwartzkoppen, deutscher Militär-Attaché und Kontaktmann für den politischen Abenteurer Major Graf Esterhazy in Paris, quittierte den Dienst, ohne sich zu offenbaren. Am 13. Juli 1906 werden Alfred Dreyfus zum Major und Marie Georges Picquart zum Brigadegeneral befördert. Die Ehrenlegion ernennt Alfred Dreyfus am 20. Juli 1906 zum Ritter der Ehrenlegion. Am 11. Juli 1935 stirbt Major Dreyfus. Er muss nicht mehr erleben, dass die Enkelin Madeleine Levy im Laufe des Zweiten Weltkrieges als Jüdin nach Deutschland deportiert und im KZ Auschwitz umgebracht wird. Seine Ehefrau Lucie überlebte den Holocaust und starb kurz nach der Befreiung in Paris. Dieser spannende Polit-Krimi beruht auf wissenschaftlichen Forschungsergebnisse von Günther und Eckhardt Fuchs in ihrer akademischen Abhandlung „J’accuse! Zur Affäre Dreyfus“. Am 15. Oktober 2019 jährt sich der Beginn jener Affäre zum 125. Male. Und so entwickelt sich die spätere Affäre …
„1 ADEL VERPFLICHTET – WOZU?
Noblesse oblige: Zwischen drei und vier Uhr nachmittags entlohnt Major Graf Marie-Charles Ferdinand Walsin-Esterhazy in auffallend herablassender Art und Weise den Kutscher. Ist dieses Gebaren typisch für den verarmten Adel? Egal wie – für die späteren Gerichtsakten im Prozess gegen Alfred Dreyfus ist auch nicht von Belang, ob dieser 20. Juli 1894 ein strahlend schöner oder ein verregneter Sommertag war. Fakt ist – der mittelgroße, eher schmächtig wirkende Mann läuft eine kurze Strecke über die Pont de la Concorde zum Boulevard Saint Germain, um dann links in die Rue de Lille abzubiegen. Zielbewusst steuert Graf Esterhazy die Nummer 78 an: Ambassade d’Allemagne. Zivil gekleidet, steht dem Major nicht der Sinn nach Botschafter Graf Münster – nein, er muss und will allein den Militärattaché Oberst von Schwartzkoppen sprechen.
Aber da ein Infanterie-Major der Französischen Armee nicht avisiert ist, steht auch niemand zu seinem Empfang bereit. Die Enden des hochgezwirbelten Schnauzbartes zittern gereizt wegen dieser offensichtlichen Nichtachtung gegenüber einem Grafen Esterhazy, der von sich behauptet, Spross aus uraltem Adelsgeblüt und mit königlicher Linie verbunden zu sein. Wenn hakennasiges Profil und auffallend vorspringende Kinnpartie dero Merkmale bestimmen, dann mag es in Gottes Namen so sein. Was aber gewisse Kreise der Grande Nation auch hundert Jahre später noch immer in Abrede stellen möchten, das ist eben Sinn und Zweck dieser gräflichen Visite.
„He! Sie da!“, blafft Esterhazy in den Hintergrund der großen Empfangshalle. Eine Frau kommt stöhnend aus der Hocke in die Senkrechte. Sie streckt ihren malträtierten Rücken durch und nähert sich mit einem Gesicht, das von vornherein diesem herrischen Besucher nicht wohlgesonnen zu sein scheint. Um ihrem Phlegma die Krone aufzusetzen, dreht Madame Bastian noch einmal vergewissernd den Kopf in die Richtung, aus der sie gerade gekommen ist. Dann erst mustert sie aufmerksam den Mann vor sich. Und Madame Bastians intensiv prüfender Blick steht ganz im Gegensatz zur vorgeführten Langsamkeit einer Reinigungskraft in der Deutschen Botschaft anno 1894. „Meinen Sie mich, Monsieur?“, bequemt sich Madame Bastian endlich zu einer Äußerung.
Major Esterhazy ballt beide Fäuste in den Taschen seines schwarzen Gehrocks. So jemand Lahmarschiges auf dem Kasernenhof in Rouen – den Kerl würde er schleifen, bis der Blut schwitzt! Auch dieser Schlampe wird er wohl zeigen müssen, aus welch ehernem Holz ein Graf Esterhazy geschnitzt wurde: „Ist außer uns noch jemand zugegen, Kanaille?!“, zischt es giftig zwischen den schmalen Lippen unter dem Schnauzer. „Oberst von Schwartzkoppen! Dalli!“
Aufreizend gelassen dreht Madame sich wieder ihrer Arbeit zu. Aber irgendetwas scheint sie zu hindern, sich in Bewegung zu setzen. Esterhazys Fäuste fliegen geradezu aus den Taschen. Als wäre er auf dem Kasernenhof in Rouen beim Drillen ihm untergebener Infanteristen, legt der Major beide Hände an die Hosennaht und schnarrt: „Also melden Sie mich jetzt dem Herrn Militärattaché von Schwartzkoppen in Sachen Passformalitäten für eine Reise in den Elsaß oder ich werde Sie sofort …“
Nichts in Madame Bastians Gesicht regt sich. Von Ängstlichkeit schon gar keine Spur. „Ich bin hier nur die Putzfrau, Monsieur! August ist für solche wie Sie zuständig. Aber der holt gerade die Zeitung für Seine Exzellenz. Wenn Sie etwas für den Monsieur von Schwartzkoppen abgeben wollen – ich kann’s nachher raufbringen.“ Der fast schmächtige Mann scheint zu begreifen, dass er gegen diesen Plebs nicht ankommt. Esterhazy deutet zur Treppe und befiehlt: „So beschreiben Sie mir endlich den Weg!“
Das Desinteresse in Madame Bastians Mienenspiel zeigt sich nun unverhohlen. Sie schlurft die wenigen Schritte zu ihrem Arbeitsplatz zurück, bückt sich nach einem Wischtuch und spricht mehr in den halb gefüllten Wassereimer als zum honorigen Besucher des Deutschen Militärattachés: „Tut mir leid, Monsieur. Wie gesagt – legen Sie Ihre Papiere ruhig auf das Tischchen dort in der Empfangsloge …“
Major Esterhazy hat keine Lust, noch mehr Atemluft an diese unbotmäßige Person zu vergeuden. „Kanaille!“, wiederholt er ein zweites Mal. Dann läuft er mit behänden Schritten die prunkvolle Freitreppe empor und verschwindet so aus Madame Bastians Augen. Schließlich verhallen die eiligen Schritte und ein lautes Türenöffnen dringt herunter bis in die Empfangshalle.“
Erstmals 1986 veröffentlichte Hans-Ulrich Lüdemann im Kinderbuchverlag Berlin „Das verflixte Rollenspiel“: Ein nahezu beschauliches Leben führte die Familie Moor bis zum 3. Januar 1985, an dem Ellen Moor einen Autounfall verursachte, in dessen Folge ihr Mann Karl querschnittgelähmt war. Karl Moor hatte seine Frau zur Eile angetrieben, wollte er doch eine TV-Sendung zu Ehren des Geburtstages von Wilhelm Pieck, des ersten Staatspräsidenten der DDR, sehen. Durch ein Missverständnis zwischen den Eltern war verabsäumt worden, den Videorekorder zwecks Mitschnitts zu programmieren. Die Geschwister Roman Moor (geb. Lubenow, weil Eltern tot) und Amalia Moor mussten in der Folgezeit mit ansehen, dass die Familie immer stärker auseinanderfiel. Die Eltern wurden mit dem Schicksalsschlag nicht fertig. Karl Moor ließ sich in die Rolle eines stillen Leiders fallen, was seiner Frau stärker zusetzte als hätte er sie wegen ihrer Schuld an seinem Krüppel-Dasein beschimpft. Romans Adoptivvater, der sich bereits vor dem Unfall nicht hatte entscheiden können, welcher von fünf Mimen er folgen müsse, um als erfolgreicher Künstler zum Lebensunterhalt der vierköpfigen Familie beitragen zu können, floh geradezu in ihr Wochenendhaus bei Hollwiss, einem beschaulichen Dorf. Hier versuchte Karl Moor, auf dessen Vornamen seinerzeit der hochgebildete Buchhändler und Schillerverehrer (Die Räuber) Maximilian Moor bestanden hatte (Ähnliches traf später bei der Namensgebung für seine Enkelin Amalia zu) verbissen, herauszufinden ob er fortan Autor, Mime, Maler, Komponist oder Bildhauer sein wollte. Alle schienen sich mehr recht als schlecht eingerichtet zu haben. Bis eines Morgens Roman Moor sah, wie aus dem Schlafzimmer der Eltern Herr Dr. Hampe in den Wohnungsflur trat, als sei dies die natürlichste Sache der Welt. Während Amalia diese Veränderung in der Familie akzeptierte, sabotierte Roman den Eindringling, wo es nur ging. Er ordnete dessen Schallplattensammlung, indem zwei getrennte Haufen sich auf dem Teppich im Wohnzimmer wiederfanden, einer mit Hunderten Schallplattenhüllen und sein Pendant mit den Platten. Das Einsortieren dürfte eine Menge Arbeit erfordern beziehungsweise viel Zeit verschlingen. Roman Moor tat sich als Rabauke in der Schule hervor, bestahl Fischer Wehles Reusen, verschaffte sich bei den Mädchen einen zweifelhaften Ruf als Schürzenjäger und begann mit Hannibal oder kurz Hanno Pökermann, einem kürzlich aus Westberlin zugezogenen Schlimmen Finger, mit dem Trinken von Hochprozentigem. Als Roman nicht mehr weiter wusste, suchte er das Gespräch mit seinem Adoptivvater. Beide hatten ein ausgeklügeltes System des Umgangs miteinander: das Rollenspiel. Sprachen sich beide aus, dann schlüpfte der querschnittgelähmte Vater in die Rolle des alten ortsansässigen Fischers und dem Sohn oblag die Rolle eines 14-Jährigen Petrijüngers. Diese scheinbare Anonymität erlaubte es beiden, mit aller Schärfe ihre Meinung dem jeweils anderen beizubringen. Und so kam es, dass Roman, der nach wie vor unter dem Verhältnis seiner Adoptivmutter mit Dr. Hampe litt, erfahren musste, dass der Vater von der neuen Gemeindeschwester Akke Jensen mehr als nur medizinisch versorgt wurde. Ja, dass es da noch eine kleine Silke gab. Und noch eins machte Roman schwer zu schaffen: die Pökermanns waren hierher gezogen, um in Hollwiss ein beträchtliches Erbe anzutreten. Dazu gehörten auch Land und Wochenendhaus, von Romans Stiefvater genutzt. Beides zu kaufen überstieg die finanziellen Möglichkeiten der Familie Moor. Gegenwärtig stellt Karl Moor aus illegal eingeführtem Elfenbein kleine Kultfiguren her, die Pökermann durch dunkle Kanäle via Skandinavien nach Westberlin schafft und dort mit entsprechenden Zertifikaten als Jahrhunderte alte Indische Gottheiten mit hohem Gewinn verscherbeln lässt. Als Roman Moor glaubt, dass die übelsten Sachen ausgestanden sind, versucht er sich mit einem Bonmot zu empfehlen: Der Moor hat seine Schuldigkeit getan – der Moor kann gehen! Leider hat er mal wieder daneben gegriffen, wie Karl Moor auch sogleich berichtigt: Das ist Fiesco. Auch von Schiller. Aber Moor mit -Otto- und -Hilda-! In der Mitte! Dieser Schwarze. Aber lernen wir zunächst einmal Roman Moor kennen. Was ist das für ein Junge?
„1. Kapitel
Abgesehen vom wohlklingenden Namen Roman Moor, den einer auch ohne eigenes Zutun von seinen Eltern übertragen bekommt – hatte sich die Natur, was das Äußere des Jungen betrifft, nicht überanstrengt. Wie er dasteht am Zaun, in kurzer Hose und dünnem Anorak, mit weit aufgerissenem Mund nach Luft schnappend, ähnlich einer Flunder an Land – da kann einen schon der Gedanke anspringen, dass die Kräfte, die für alles verantwortlich sind in unserem Kosmos, was das künftige Leben eines Menschen angeht, mal stärker und mal schwächer zu Werke gehen! Bei Roman hatten diese sich wohl gerade für den Vordermann verausgabt. Schon der Hebamme in der Klinik war aufgefallen, dass sein rechtes Auge bläulich und sein linkes bräunlich gefärbt ist – statt reinem Blau oder reinem Braun – es hatte nicht gereicht zu einem klaren Entweder-Oder! Und so ist es auch geblieben. Romans norddeutscher Eierkopf dagegen darf getrost zu den landläufigen Eigenheiten gezählt werden. Seine Zähne erweisen sich mit den Jahren gut zum Pfeifen. Ihr weiter Abstand zueinander, nicht die Intelligenz des Jungen, führte dazu, dass er bereits in den ersten Lebensjahren mit schrillen Signaltönen seine staunende Umwelt heimsuchte. In jenem Alter war das etwas hinderliche ungleiche Verhältnis der einzelnen Körperteile zueinander noch nicht zu erkennen. Heute aber darf festgestellt werden, dass niemand sonst in der Schulsportgemeinschaft Schach die Figuren, während einer Blitzpartie beispielsweise, griffiger auf das hölzerne Spielfeld knallt als der nunmehr Vierzehnjährige mit seinen überaus sehnigen Spinnenfingern. Weil bei Roman die Beine abwärts vom Hintern als Striche in der Landschaft anzusehen sind und im allgemeinen wenig Halt auf der Erde finden – irgendeinen Sport wollte er aber treiben -, ist dem Jungen eine Anstrengung im Sitzen angenehmer als, ähnlich einem Göpel-Pferd zu Hollwiss in dörflicher Vergangenheit am Druschplatz, Runde um Runde auf der roten Aschenbahn im Stadion Schweiß lassen zu müssen …
Im Augenblick fliegt der Junge am ganzen Körper, von der schnellen Jagd auf dem Fahrrad völlig entkräftet. Es dauert, ehe er sich entschließen kann, in Richtung Bungalow zu gehen. Der Ballast, den Roman unsichtbar auf seinem Rücken oder mehr auf seiner Seele trägt, ist zu schwer, als dass der Junge aus heiterem Himmel Karl Moor gegenübertreten kann oder will. Beim vorsichtigen Heranpirschen überlegt Roman, wie viel Ungemach ihm die nächsten Stunden bringen können. An Gutes vermag er schon gar nicht mehr zu denken. Zuviel ist auf seinem Kerbholz registriert. Wenn er alles auch nicht mit Bosheit, sondern aus dem reinen Gefühl der Rache heraus tat! Zwar hat der um zwei Jahre ältere Hanno Pökermann, ehemaliger Westberliner und Romans neuer Mitschüler, ihm das mit der Spraydose eingeblasen – aber was soll’s? Roman bringt wider Willen einen leisen Pfiff zustande. Erschrocken schaut der Junge zum Bungalow hinüber. Aber nichts rührt sich hinter der auffällig großen, weil langen Fensterfront. Sie verläuft in geringer Höhe vom Erdboden, damit jeder einer, der im Hause sitzt, weithin den Bodden einsehen kann. Karl Moors Atelier. Jetzt mehr als früher. Der heute auch mehr als früher froh ist, dass Ellen Moor vor sieben Jahren ihren Wunsch durchgesetzt hat, Roman Lubenow an Kindes Statt zu adoptieren. Wie die Dinge sich entwickelt haben – Roman kann sich keinen anderen Vater als Karl Moor vorstellen.
Ein gewisser Dr. Hermann Hampe dagegen erscheint dem Jungen wie ein salzloser Eintopf! Fliegenpilzsuppe für den! Trotz seiner Atembeschwerden lächelt Roman bitter. Eine Tragödie bahnt sich an für die Familie Moor, wie sie Friedrich Schiller in Die Räuber nicht hätte schlechter oder besser erfinden können! Auf diesen großen deutschen Dichter hatte sich übrigens der Buchhändler Maximilian Moor berufen, als er sich einfallen ließ vor vierzig Jahren seinen einzigen Sohn Karl zu nennen. Der Alte drückte es auch durch, dass gegen Ellens Widerstand seine Enkeltochter den Namen Amalia erhielt. Was wohl hätte der achtzigjährige Schiller-Verehrer über den tragischen Unfall gesagt, den Ellen mit dem Auto verursachte und der seinem Sohn Karl von einer Sekunde zur anderen die Gesundheit und mehr raubte?! Während Ellen Moor mit Großvaters Umsicht weiterhin den Friseur-Salon ehemals Lubenow befehligt, leidet ihr Mann fortan umso stärker darunter, dass er sich nicht für ein Musen-M entscheiden konnte und daher weder als Mime noch in der Malerei oder in der Musik oder im Modellieren ein finanzielles Standbein auf der Erde fand. Dieser Umstand hat auch dazu geführt, dass Karl nach Hollwiss übergesiedelt ist.
Er und Ellen müssen erst einmal zur Ruhe kommen nach dem Unfall, der eigentlich mehr der Albtraum seiner Frau ist. Weil sie die schlimmen Folgen ihres Versagens Tag für Tag vor sich sehen muss. Karl macht ihr keine Vorwürfe. Vielleicht ist es aber gerade das? Eine verworrene Situation, die, wie Roman zu Recht oder zu Unrecht glaubt, jetzt noch verfahrener scheint. Teils durch Ellens Umgang mit diesem Dr. Hermann Hampe und Romans Reaktion darauf. Was Amalia angeht, die findet Hampe einfach Spitze. Von Fall zu Fall sogar super. Und wenn Roman nur an die Schallplattensammlung denkt, die der Typ angeschleppt hat …“
Bereits 1975 hatte Hans-Ulrich Lüdemann ebenfalls im Kinderbuchverlag Berlin sein Buch „Patenjäger“ veröffentlicht, über das der Autor selbst Folgendes schreibt: Habent sua fata libelli, sagen Lateiner. Zu Deutsch heißt es nichts anderes, als dass Bücher ihre Schicksale haben. Auf den Patenjäger (1. Auflage 1975) bezogen passt das wie die berüchtigte Faust aufs Auge. Ich erinnere mich noch genau: Zu Beginn der Siebziger starteten SED und FDJ eine ideologische Offensive in der Art, dass sozusagen ein Staffelstab von den alten Genossen über die mittlere Generation hin zur Jugendorganisation und den Thälmann-Pionieren weiter gereicht werden sollte. Schlüsselwort war die Patensuche. Paten in jeder Beziehung. Über ehrenamtliche ideologische Betreuung sollte quasi der Sieg des Sozialismus vorbereitet und letztlich zementiert werden. Schaltstellen dieser Bewegung befanden sich vornehmlich im Zentralrat, dem leitenden Organ der FDJ. Dort saßen überalterte Berufsjugendliche beiderlei Geschlechts, die sich nicht nur durch erhöhten Zigarettenkonsum auszeichneten. Als Bundesgenossen im Kampf um Herz und Hirn der Heranwachsenden hatte jene sich die Schriftsteller ausgeguckt. Wir waren aufgerufen, mittels Geschichten in neuen Büchern den Vorgang zu begleiten beziehungsweise zu intensivieren. Also schickte man dem auserwählten Künstler ein Auto, fuhr ihn in die Pionierrepublik am Werbellinsee und agitierte ihn mit drögen Vorstellungen in stundenlangen Vorträgen. Dieses geschah in einem Maße, dass über kurz oder lang selbst dem Willigsten unter den herbeigekarrten Schreibern der letzte Rest schöpferischen Elans verloren gehen musste. Salopp gesagt, ich machte mich sobald es ging vom Acker und schrieb meine Story mit dem Titel Patenjäger. Unbeeinflusst von Politikastern jedweden Couleurs wurden in meinem Buch sowohl die alten und jüngeren Genossen, die FDJler und Schüler zu Menschen aus Fleisch und Blut. Die ins Auge gefassten sogenannten Paten nicht ausgenommen. Es waren Menschen mit Fehlern und Vorzügen. Da organisiert unter anderem ein FDJ-Sekretär eine Arbeitsniederlegung, weil der Betrieb die neunte Klasse während des Unterrichtstages in der Produktion (UTP) sträflich unterfordert, ein Lehrer glaubt ständig auf der Hut sein zu müssen wegen der renitenten Schulklasse und ein Maler verweigert anfangs seine Rolle als Pate, weil er statt parteilicher Kunst sich an die Natur als Motivation für sein künstlerisches Schaffen hält. Gewisse Leute schlussfolgern jetzt messerscharf, dass seinerzeit ein derartiges Buch in der von SED-Ideologie und der Diktatur des Proletariats geprägten DDR selbstredend nicht zum Druck zugelassen worden war, aber dank meiner Paten sprich erfahrene Lektorin und politikbewusster Verlagsleiter erschien es bis 1984 in sechs Auflagen. Die Handlung beginnt nicht in Italien und nicht in England, sondern …
„1. Kapitel
Ein kühler Landwind lässt die Wolken über der kleinen Stadt am Bodden nicht zur Ruhe kommen. Ab und zu lugt die Aprilsonne hervor, wirft ihre wärmenden Strahlen auf das Pflaster der Straßen, die in engen Windungen zum Hafen hinunterführen. Die Häuser in der Altstadt kleben wie Schwalbennester an den Hängen. Sind durch Treppen miteinander verbunden, die manchmal fünfhundert Stufen und mehr zählen. Würde am Ortseingang auf der rechten Seite das gelbe Schild fehlen, auf dem der Name Standnitz zu lesen ist, ein Fremder könnte vermuten, dass er sich in einem kleinen italienischen Städtchen irgendwo an der Adria befände. Spräche er die Alten an, die auf den Bänken sitzen und klöhnen, um vielleicht den Weg zu einer der vielen verwinkelten Gassen zu erfragen, er könnte erneut stutzen ob der seltsamen Sprache, die ihm kehlig entgegen klingt. Also nicht Italien, sondern England?
Nein, nein – Standnitz gibt es nur einmal. Standnitz ist Rügen, und Rügen ist Standnitz, mannich? „Und nu giw mal Pass, lot de Wippken und Mafäuken“, würden die Alten mit den verwitterten Gesichtern zu dem Bröllenkater sagen, der auf dem Gehsteig liegt. Für den Uneingeweihten heißt das, er soll aufpassen und die Flausen und Winkelzüge lassen. Dieses laut weinende Kind, der Bröllenkater, heißt Jens Schimmelpfennig und ist fünf Jahre alt. Seine Zwillingsschwester Jutta hat sich gerade den Lederball erkämpft. Sie stellte dem Bruder ein Bein. Natürlich ohne Absicht. In diesem Alter tut man so etwas noch nicht absichtlich. Der Dritte im Bunde, Martin, ein kräftiger Junge mit welligem Haar und braunen Augen, läuft zum brüllenden Jens und versucht ihn zu beruhigen. Dabei schaut Martin hoch zum dritten Stock des windschiefen Hauses, das sich nur noch zu halten scheint, weil die links und rechts nebenstehenden es stützen. Aber die Gardine von dem Fenster, das zur kleinen Wohnung der Lehrerin Schimmelpfennig gehört, bewegt sich nicht.
Ist Martin Hagedorns Klassenleiterin so von der Qualität der Rechenarbeit beeindruckt, dass sie den Lärm, den Zwillings-Jens veranstaltet, nicht hört? Martin hofft das Beste. Für die Arbeit. Der Junge unternimmt einen schwachen Versuch, Gerechtigkeit zu üben. Aber als er das runde Leder anfasst, verzieht Jutta das Gesicht. Der Elfjährige kapiert. Ein Bröllenkater reicht ihm. Er läuft zum schluchzenden Jens und bietet ihm einen Pferderitt an. Gratis selbstverständlich. Und Martins Hoffnung, dass dieses kostenlose Vergnügen keinen Anklang findet, erfüllt sich nicht. Auf allen Vieren trabend, zweifelt er die Wahrheit eines Rätsels an, welches er irgendwo gelesen hat und dessen Lösung lautet: Nach der Geburt bewegt sich der Mensch auf vier Beinen, in der Mitte des Lebens auf zwei und zum Ende hin auf drei, wenn man den Krückstock berücksichtigt, den aber nicht jeder braucht. Großvater Kuddel Assmann zum Beispiel geht trotz seiner achtundsiebzig Jahre ohne Stock und kerzengerade. Das Orakel hat also gefragt: Wer geht am Morgen vierbeinig, zu Mittag zweibeinig und am Abend dreibeinig?
Nun, Martin Hagedorn ist es im Augenblick, als fallen Morgen- und Mittagstunde zusammen. Und bei dieser Überlegung angelangt, riskiert er einen Blick auf die Armbanduhr. Martin seufzt erleichtert. In wenigen Minuten muss Lute aufkreuzen und ihn ablösen. Vor Freude bäumt das Pferd sich ein wenig. Aber sofort spürt er einen ärgerlichen Stoß in den Weichen. Kinderhacken können verflucht hart sein, resigniert Martin. Er denkt an Egbert, der es sich mit den Zwillingen leicht gemacht hat. Der dicke Egs, wie die Jungen und Mädchen ihren Mitschüler nennen, hat die Kleinen kurzerhand zu seinem Vater in die Arztpraxis mitgenommen und vorsorglich ihre Augen und Ohren getestet. Ideen muss einer haben, schnauft Martin, während er den still lächelnden Jens die dritte Runde auf seinem Buckel reiten lässt. Ja, für eine Stunde ist Egs die beiden los gewesen. Eine Stunde hat ihr Interesse für alles in der Praxis von Dr. Sonntag vorgehalten. Wer solche Möglichkeiten wie Egs hat, der kann schon auf die Idee kommen, dass die Klasse sich um die Kleinen von Frau Schimmelpfennig kümmern sollte. Solange Herr Schimmelpfennig Soldat bei der Nationalen Volksarmee ist.
Als Martin seine fünfte Runde auf dem spärlichen Rasenflecken zwischen den eng gegenüberliegenden Häuserzeilen galoppiert und er einen Blick zu Jutta wirft, die damit beschäftigt ist, die Schnüre am Ball aufzuknoten, um ins Innere vom runden Leder sehen zu können, kommt der lang ersehnte Ludwig Bredow um die Ecke.“
Erstmals 1988 brachte der Prisma-Verlag Zenner und Gürchott Leipzig den Hokusai-Roman „Die Woge“ von Ingrid Möller heraus: Um 1800 schmuggelte ein holländischer Kapitän Bilder eines damals unbekannten japanischen Malers nach Europa. Sein Name wurde bald weltberühmt: Hokusai. Die von einem leidenschaftlichen Interesse an der Natur und den Menschen seiner Heimat getragenen Malereien und Holzschnitte eröffneten zugleich den Blick in eine fremde Kultur. Jahrhundertelang hatte sich Japan vor der übrigen Welt verschlossen, war das Land mit dem Odium des Geheimnisvollen umgeben. Die Kultur des fernöstlichen Inselreiches war und ist durch Tradition geprägt. Das gilt auch für das Werk Hokusais, des außerhalb seines Landes wohl bekanntesten japanischen Künstlers. Seine wechselvolle Biografie zeichnet die Kunsthistorikerin und Japankennerin Ingrid Möller in 47 Szenen nach, die wesentlichen Lebensstationen folgen. Eindrucksvoll erzählt, ersteht zugleich ein lebendiges Bild des kulturellen und Alltagslebens im japanischen Kaiserreich um 1800. 24 farbige Abbildungen vermitteln einen Eindruck von dem faszinierenden Werk dieses Künstlers, der längst Eingang in den Schatz der Weltkunst gefunden hat. Und gleich zu Beginn treffen wir den Meister und seine Tochter:
„1. Kapitel
Früher als gewöhnlich nehmen sie heute ihren Tee ein, schweigsamer auch als gewöhnlich. Es ist nicht nur die Stille der frühen Morgenstunde, die ihre Sinne schärft für jedes leise Rauschen der schmalen Bambusblätter hinter dem Haus, für das Niedergleiten und Gurren der Tauben auf dem niedrigen Schilfrohrdach und das Abtropfen des Nachttaus. Auf ihnen lastet eine unausgesprochene Sorge.
Oyei scheint heute eine besonders große Sorgfalt auf die Zubereitung des Tees zu legen. Jede ihrer Bewegungen ist langsam und gemessen. Sie schlägt das grüne Pulver mit dem Bambusquast, bis es fast aus dem Gefäß schäumt. Und während sie das sprudelnd kochende Wasser in die irdenen Schalen gießt, scheint ihre Hand leicht zu zittern. Unter den rituellen Verbeugungen, die ihr längst in Fleisch und Blut übergegangen sind, rutscht sie lautlos auf den Knien über die hellen Tatamimatten und stellt die Schale ihres Vaters in der vorgeschriebenen Weise vor ihn hin. „Otemae chodai“, murmelt der Alte den Dank in unverständlichen Kehllauten. Oyei holt auch den winzigen Teller mit Gebäck. „Okashi – itashi masu“, murmelt der Alte abwesend.
Oyei verbeugt sich wiederum, etwas tiefer als der Vater. Sie drehen die Teeschalen in der festgelegten Richtung in beiden Händen. Mit schlürfendem Geräusch ziehen sie in winzigen Schlucken den sehr heißen und sehr bitteren Tee in den Mund. Erst als Oyei sieht, dass ihr Vater die Schale völlig ausgetrunken hat, wagt sie nach einem flüchtigen Blick aus den Augenwinkeln die Bemerkung: „Die Maske ist heute Nacht heruntergefallen.“ Scheu, als fürchte sie den aufbrausenden Zorn ihres Vaters, beugt sie sich über das Teegeschirr und wischt die heiß ausgespülten Schalen öfter mit dem schönen Tuch aus, als es die Vorschrift verlangt.
„Hai!“, bestätigt Hokusai in kurzem, rauem Ton, wobei sich die zahllosen Querfalten auf seiner Stirn merklich vertiefen. Auch er ist besorgt, schließt Oyei daraus. Wenn die Maske herabfällt, gibt es Unheil! Wer weiß das nicht! Es ist zu heikel, darüber zu sprechen. Die Maske fiel auch herab, bevor Mutter starb und bevor damals das Haus abbrannte. Der Geist der Ahnen hat eine Botschaft an uns. Eine böse Botschaft. Aber welche? Verstohlen beobachtet sie ihren Vater. Wirkt er heute nicht müder als sonst? Allerdings, er hat sich wieder nicht rasiert. Überhaupt legt er zu wenig Wert auf sein Äußeres, schon immer. Einem fast Neunzigjährigen mag man das nachsehen, aber früher war er nicht anders.
Trotzdem! Oyei betrachtet ihn mit Stolz. Wer hat schon einen solchen Vater! Einen, der mit fast Neunzig immer noch glaubt, das Eigentliche, die Hauptsache vor sich zu haben, der immer noch rastlos neuen Zielen zustrebt und sich nicht die geringste Ruhe gönnt! Jetzt hält er den Kopf genau so, wie Oyei ihn einmal gezeichnet hat, diesen eigenwilligen alten Mann mit dem kahlen Schädel, der fliehenden, faltenübersäten Stirn, den waagerechten breiten Brauen, den vor Falten kaum sichtbaren Augen, der langen schmalen Nase, dem breiten Mund und dem energischen Kinn. Alles ist noch genauso und doch anders. Die Knochen scheinen von innen mehr auf die Haut zuzuwachsen. Der Schädel drückt sich durch, die Jochbeine. Vater ist alt, sehr alt -! Weiter wagt Oyei nicht zu denken. Nicht daran, dass deshalb vielleicht die Maske von der Wand gefallen sein könnte, weil der Vater …
Dennoch, dass er ihre Bemerkung nicht mit Zorn, nicht einmal mit einem zurechtweisenden Blick als Unsinn und Weiberaberglauben abgetan hat, zeigt, dass auch ihm in dieser Nacht eine böse Ahnung zu schaffen gemacht hat. Inzwischen steht die Sonne so hoch, dass der Strauß kunstvoll zusammengestellter Feldblumen im Tokonoma im Widerschein der seidenartig glänzenden Papierbespannung aufleuchtet. Der ganze Raum mit dem Braun der Holzpfosten, dem hellen Ockerton der Binsenmatten und dem Elfenbein der Wände scheint nur für diese eine, die vierte Wand geschaffen, um die sparsamen Farben der Blumen, des Rollbilds und der Maske zur Geltung zu bringen.
Hokusai verweilt heute länger in der Betrachtung als sonst, als hätte er den ewig sich wiederholenden Prozess von Knospen, Blühen und Welken nicht an jedem Tag seines Lebens bewusst beobachtet und unzählige Male mit dem Zeichenpinsel festgehalten. Alles Lebende ist Gleichnis, stets neu zu überprüfen und zu überdenken. Heute aber, mehr als an jedem anderen Tag seines langen Lebens, hat er Grund, sich dieser ältesten aller Weisheiten zu entsinnen. Denn in der vorigen Nacht war es kein anderer als Emma-o, der Herr der Unterwelt, der an den Stützpfosten geklopft hat. Deshalb ist die Maske heruntergefallen. Hokusai weiß, dass ihm nur noch eine kurze Frist bleibt, aber er möchte diese Gewissheit für sich behalten. Oyei soll keinen Verdacht schöpfen, die Schüler nicht, überhaupt niemand.“
Erstmals 1978 veröffentlichte Elke Nagel (Willkomm) als Band 130 in der Reihe „Die kleinen Trompeterbücher“ des Kinderbuchverlages Berlin „Der fingerkleine Kobold“. Ihre Erzählung „Wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen“ stand in dem erstmals 1979 ebenfalls im Kinderbuchverlag Berlin erschienenen Buch „Der blaue Schmetterling. Gute-Nacht-Geschichten“: Zwei kleine Geschichten für das Erstlesealter oder zum Vorlesen: „Wo sich Fuchs und Hase Gute Nacht sagen“ – eine Gute-Nacht-Geschichte“ und „Der fingerkleine Kobold“ – eine Geschichte über einen kleinen Jungen, der sich einen Kobold erschafft, den nur er selbst sehen kann, von dem er niemanden erzählen darf und mit dessen Hilfe er versucht, alle seine Probleme zu bewältigen. Zunächst aber lernen wir nicht den kleinen Jungen kennen, sondern seine Eltern und Frau Becker, seine Lehrerin:
„Der fingerkleine Kobold
ALS ERSTES: IRGEND ETWAS STIMMT NICHT
An einem Montagabend im April sagte Frau Rose: „Irgendetwas stimmt mit Christoph nicht.“ Sie sagte es vor dem Fernsehapparat, und sie sagte es eigentlich auch zu dem Fernsehapparat, denn Herr Rose, Christophs Vater, war eingeschlafen. Im Sessel. Vor dem Fernseher. Vielleicht hatte er nicht sehr fest geschlafen, denn als Frau Rose den Satz gesagt hatte, hob er plötzlich den Kopf, rieb sich die Augen und murmelte: „Hä? Hä? Hä?“ Christophs Vater sagte immer alle kurzen Wörter dreimal, damit sie sich länger anhörten.
Nun musste Frau Rose den Satz wiederholen. Christophs Vater fragte: „Wieso?“, und gähnte. Christophs Mutter sagte: „Er träumt mit offenen Augen, seine Zensuren werden immer schlechter, und ich glaube, er lügt manchmal.“
Christophs Vater sagte ganz schnell hintereinander: „So? So? So?“ Dann schlief er wieder ein. Die Mutter seufzte. Sie war auch sehr müde. Sie hatte heute viele Stunden in der Bücherei gestanden. Christophs Mutter war Bibliothekarin in einem sehr großen Betrieb. Der Betrieb war so groß wie eine kleine Stadt, und es wurden in ihm Tuche hergestellt, bunte und einfarbige, dicke und dünne. Der Betrieb hatte noch Schwesterbetriebe in anderen Städten, zusammen waren sie eine Familie, die man Kombinat nannte. Der Direktor des Kombinats hieß Herr Rose und war Christophs Vater.
„Vati muss doch den ganzen Betrieb im Kopf haben“, sagte Frau Rose manchmal zu Christoph, wenn der sich beklagte, sein Vati habe nie und nie ein bisschen Zeit für ihn. Aber Christoph glaubte nicht, dass sein Vater den ganzen Betrieb im Kopf hatte. Er wusste genau, wie der Betrieb aussah, wie unglaublich groß er war. Und er kannte Vatis Kopf. Sie muss sich bessere Ausreden überlegen, dachte er.
Nachdem Frau Rose geseufzt hatte, stand sie auf und drehte den Knopf des Fernsehers nach links. Da wurde es ruhig im Zimmer, und man konnte hören, wie Herr Rose schnarchte. Frau Rose stieß ihn an und sagte: „Komm schlafen.“ Sie sagte nicht noch einmal: Irgendetwas stimmt mit Christoph nicht. Sie nahm sich vor, am nächsten Tag mit Christophs Lehrerin zu sprechen.
Christophs Lehrerin, Frau Becker, dachte an diesem Abend auch an Christoph. Das kam dadurch, dass sie vor dem Fernseher saß und mit einem Auge auf den Film, mit dem anderen auf Christophs Mathematikarbeit starrte. In Christophs Arbeitsheft sah es ziemlich rot aus. Frau Becker schrieb eine rote Vier unter die Arbeit. Dann seufzte sie, vielleicht zur gleichen Zeit wie Christophs Mutter, aber drei Straßenbahnhaltestellen entfernt und drei Treppen höher. Sie murmelte vor sich hin: „Was war das in der ersten Klasse für ein guter Schüler!“ Das stimmte. Christoph hatte in der ersten Klasse nicht eine einzige Vier bekommen. Mit den Dreien freundete er sich auch erst in der zweiten Klasse an. Waren in der dritten Klasse nun die Vieren an der Reihe?
Es dürfte spannend zu lesen sein, wie es mit Christoph weitergeht, dem Sohn des Kombinatsdirektors, und mit seinen Zensuren. Und was ist überhaupt der wahre Grund für sein Absacken? Und welche Rolle spielt der kleine Kobold? Fragen über Fragen. Die stellen sich auch in den anderen vier Angeboten der Woche, so unterschiedlich die Schauplätze der jeweiligen Handlung auch sein mögen.
Viel Spaß beim Lesen, viel Vergnügen mit großer Geschichte und mit einem kleinen Kobold und bis demnächst.
EDITION digital wurde 1994 gegründet und gibt neben E-Books (vorwiegend von ehemaligen DDR-Autoren) Kinderbücher, Krimis, historische Romane, Fantasy, Zeitzeugenberichte und Sachbücher (NVA-, DDR-Geschichte) heraus. Ein weiterer Schwerpunkt sind Grafiken und Beschreibungen von historischen Handwerks- und Berufszeichen sowie Belletristik und Sachbücher über Mecklenburg-Vorpommern.
Insgesamt umfasst das Verlagsangebot derzeit mehr als 900 Titel (Stand Mai 2018)
EDITION digital Pekrul & Sohn GbR
Alte Dorfstraße 2 b
19065 Pinnow
Telefon: +49 (3860) 505788
Telefax: +49 (3860) 505789
http://www.edition-digital.de
Verlagsleiterin
Telefon: +49 (3860) 505788
Fax: +49 (3860) 505789
E-Mail: editiondigital@arcor.de