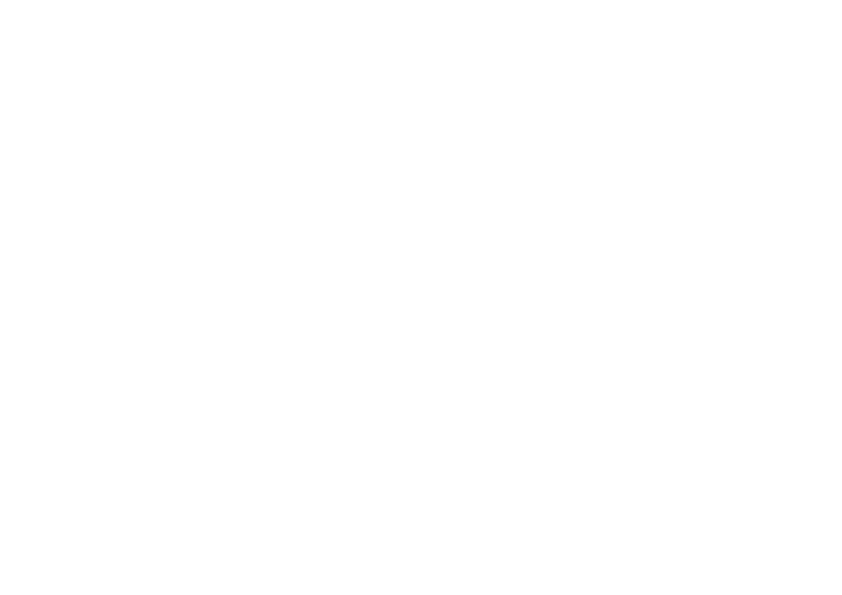Wieder einmal können wir Aphrodite, die berühmte Zeitreisende, auf ihren fantastischen Ausflügen durch Zeiten und Welten begleiten. Heute haben wir den 10. Teil dieser teils begeistert aufgenommenen, teils heftig kritisierten Reihe von Hardy Manthey im Gepäck. Was wird sie wohl „Im Land der Pharaonen“ erwarten? Ist Aphrodite glücklich?
Eine Art sozialistischen Wissenschaftsroman hat Heinz Kruschel mit „Wind im Gesicht“ geschrieben. Der Biologie Robert Karnel trifft ungewöhnliche Entscheidungen – und das betrifft nicht nur seine schon fertiggestellte Doktorarbeit.
Um einen berühmten Schweriner Schlossgeist und um eine Reihe von zunächst scheinbar unaufklärbaren Morden in der Umgebung der Landeshauptstadt von Mecklenburg-Vorpommern geht es in dem Pinnowkrimi „Die Petermännchenpuppe“ von Ulrich Hinse. Was und vor allem wer steckt dahinter?
Und damit sind wir wieder beim aktuellen Beitrag der Rubrik Fridays for Future angelangt. Jede Woche wird an dieser Stelle jeweils ein Buch vorgestellt, das im weitesten Sinne mit den Themen Klima, Umwelt und Frieden zu tun hat – also mit den ganz großen Themen der Erde und dieser Zeit. Eine der Geschichten des 2003 erschienenen letzten Buches von Heinz Kruschel befasst sich mit einer militärischen Aktion kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges und mit dem Schicksal eines jungen Deutschen, der aus Deutschland fliehen musste. Denn er ist Jude. Und jetzt hat er einen schweren Auftrag:
Erstmals 2003 erschien im Geest-Verlag Vechta-Langförden „Der große Teufelsrochen. Erzählungen“ von Heinz Kruschel: Am 8. April 1945 starten B17-Bomber von einem Flugplatz in der Nähe von London nach Leopoldshall in Sachsen-Anhalt. Daniel Rosebush sitzt allein in dem Aufklärungsflugzeug und soll die Vernichtung des kleinen Städtchens leiten. Er kennt Leopoldshall sehr gut. Denn dort ist er aufgewachsen und bis zur 6. Klasse zur Schule gegangen, bis seine jüdischen Eltern mit ihm nach Großbritannien emigrieren mussten.
Zur gleichen Zeit machen mehrere englische Fischer Jagd auf den Riesenmanta, einen Teufelsrochen. Das Tier hat den greisen Thor Underhill oft genug genarrt, dieses Mal muss ihm doch der Fang glücken. Aber zurück zu den britischen Bombern und zu Daniel Rosebush:
„Der große Teufelsrochen
DER HIMMEL ÜBER DER HALBINSEL DUNGENESS DRÖHNTE.
Es geschah an einem Sonntag, man schrieb den 8. April 1945, und die Fischer, die zu dieser Jahreszeit auf Rochen und Schollen aus waren, blickten nicht von ihrer Arbeit auf, als das Dröhnen begann. Sie waren es gewöhnt, wenn sich die Schwadronen der Bomberverbände über Dungeness und Petersfield formierten, um mit dem eingeladenen Tod an Bord über den Kanal von Dover in Richtung Flandern und dann weiter nach Deutschland zu fliegen. So auch an diesem Sonntag. Fliegende Festungen nannte man die B-17 Bomber ob ihrer starken Bewaffnung.
Sie waren von mehreren Flugplätzen nordöstlich von London aus gestartet, alle gegen 6.15 Uhr.
Die Fischer aber mussten bis zum Mittag das wohlschmeckende Fleisch ihrer Rochen an die Großmärkte von Hastings und Folkestone geliefert haben. In diesem Jahre war neben ungenießbaren Nagelrochen und Spitznasen in dem planktonreichen Gewässer auch ein Manta aufgetaucht, an die sechs Meter breit, wie kopflos wirkend und besonders seines weißen Fleisches wegen begehrt. Mantas waren immer schwer zu fangen, schwammen schnell und elegant, wie fliegend im Wasser. Wenn der Kopflose, wie man den Manta birostris nannte, tonnenschwer die Wasseroberfläche durchbrach, kam das Aufklatschen nach weitem Sprung einem Kanonenschuss gleich. Heute wollten es die Fischer wissen. Ein Manta versprach volle Kassen auf dem Markt. Die Fischer hatten starke Grundschleppnetze und reißfeste, stabile Fangleinen eingesetzt. Die kleineren Fische, die sich im schlammigen Untergrund aufhielten, waren ihnen sicher. Aber nun waren sie heute auf den Manta aus. Großer Teufelsrochen, so nannte man ihn auch.
Einmal gereizt, wird der große Rochen zu einem gefährlichen Kämpfer, sagte Thor Underhill, der die Fische besser kennt als die Menschen. Er warnte: Sie sind starke Gegner, wenn man sie harpuniert, ihr dürft sie nie unterschätzen.
DIE PILOTEN SAHEN DEN MOSQUITO BEI TAGESLICHT NICHT
So weit flog der englische Aufklärer den Bombern voraus, runde tausend Meter höher als sie. Aber alle Bomber besaßen Funkverbindung und wussten um seine Aufgabe: er war dafür verantwortlich, über zweihundert ‚Fliegende Festungen’ gemäß Order und Plan dem Angriffsziel entgegenzuführen.
Daniel Rosebush flog heute ohne einen zweiten Mann, aber er fühlte sich sicher. Seitdem die Deutschen die Lufthoheit verloren hatten, genügte ein Pilot in dem Aufklärer, der fast unangreifbar war, denn er konnte über 11 000 Meter hoch fliegen und war pro Stunde siebenhundert Kilometer schnell, dazu ausgerüstet mit modernster Technik.
Daniel hatte einen Befehl auszuführen, zu dem er keine Meinung zu äußern hatte. Befehle diskutierte man nicht.
Es gab, wie schon so oft, ein Hauptziel und ein Ersatzziel. Das Hauptziel hieß Leopoldshall, eine kleine, knapp achttausend Einwohner zählende Stadt im anhaltinischen Mitteldeutschland, in der es stille Salzschächte mit eingelagertem, kriegswichtigem Material gab, unter anderem auch mit angereichertem Uran.
Ferner existierten noch zwei chemische Fabriken, ein Sodawerk, ein Apparatebau- und ein Flugzeugwerk, das Leitwerke für die Firma Junkers herstellte.
Warum aber Leopoldshall mit der ersten Priorität benannt war, das wusste der Aufklärer Daniel Rosebush nicht, und danach hätte er Captain Trapp oder Colonel Stewart, den Group Leader, nicht fragen können und wollen. Jede Nachfrage gehört sich nicht, und er selber konnte dem Vorgesetzten erst recht nicht erzählen, was sich für ihn mit dem Namen des anzugreifenden Ortes Leopoldshall verband. Er hatte einen Befehl auszuführen, und oft war es gut, jemanden zu haben, der befiehlt und einem selbst damit die Verantwortung abnimmt.
Weit hinter sich sah er die silbernen, gestaffelt fliegenden Vögel, die Schwadronen im Abstand, eine höher als die andere.
ER KANNTE DIE KLEINE STADT LEOPOLDSHALL GUT
Denn sie war seine Heimat. Sie hatte erst in diesem Jahrhundert das Stadtrecht bekommen. Hier war er zur Schule gegangen, bis er sie nach der sechsten Klasse verlassen musste.
Daniel kannte auch das sogenannte Ersatzziel, nämlich Halberstadt am Rande des Harzes: Das war ein alter Bischofssitz, zugleich ein Verkehrsknotenpunkt, in dem Eisenbahnen repariert wurden.
Halberstadt war größer als Leopoldshall, und dennoch für die Order, die auszuführen war, nur von zweiter Priorität. Warum, das wussten nur wenige. Er jedenfalls nicht.
Denn die Priority Nr. 2 trat nur dann in Kraft, wenn vor Leopoldshall eine starke Luftabwehr auszumachen war oder ein massiver Angriff von deutschen Messerschmittjägern erfolgte. Aber jedes der ihm folgenden zweihundert Fernflieger vom Typ B1 besaß zehn Maschinengewehre zur Verteidigung, nicht ohne Grund nannte man den Typ ‘Fliegende Festung’.
GEGEN ACHT UHR ÜBERFLOGEN SIE DEN WESTWALL
Sie befanden sich über deutschem Gebiet, unbehelligt in dieser Höhe von deutscher Abwehr, die den Luftraum schon den Alliierten überlassen hatte, und der Tag versprach sonnig und warm zu werden, so schön, um sich in normalen Zeiten einen freien Tag zu machen. An einem solchen Tag hatte Daniel auf einem Radausflug in seinem vorigen Leben auch Halberstadt kennen gelernt.
Er dachte nach und das gefiel ihm. Bevor er Musik einschaltete, erinnerte er sich, dass er Halberstadt im Jahre 1936 besucht hatte, bevor seine Familie das Deutsche Reich verlassen musste. Im Jahre 1936, da war er, der heute dreiundzwanzig Jahre war, ein vierzehnjähriger Gymnasiast gewesen.
Gemeinsam mit dem Mädchen Ebba war er nach Halberstadt gefahren, nicht wissend, warum sie, die blonde Schöne, umschwärmt, mulattenbraun und überaus beliebt und begehrt, ausgerechnet ihn gewählt hatte. Aber es gefiel ihm, natürlich gefiel es ihm.
Und nun, zehn Jahre danach, saß er in einer modernen, schwer zu ortenden Maschine, Typ Mosquito, und hörte Billie Holidays Orchester, und wie sie sang. ‘Soon the deep blue sea’, und er sang mit: ‘Will be calling me’ und merkte, wie er während des Singens in die deutsche Sprache gewechselt war, dass er auf Deutsch sang, das war ihm jahrelang nicht passiert.
Das Netz der Erinnerung zog sich zusammen, während er wie mechanisch die Meldungen, die ihm seine Apparate mitteilten, an die in unterschiedlicher Höhe fliegenden Schwadronen weitergab. Es war noch eine halbe Stunde bis elf Uhr.“ Und damit zu den ausführlicheren Vorstellungen der anderen viere Sonderangebote dieses Newsletters:
Als Eigenproduktion veröffentlichte EDITION digital 2017 die 2., stark überarbeitete Auflage des erstmals 2013 dort erschienenen fantastischen Romans „Die Zeitreisende, 10. Teil. Im Land der Pharaonen“ von Hardy Manthey: Hat die Zeitreisende Aphrodite das Ziel ihrer Träume und Sehnsüchte erreicht? Über ein Jahrzehnt lebte sie glücklich an der Seite ihres Mannes. Es waren die schönsten Jahre ihres Lebens. Sie ist in dieser Zeit dreimal Oma geworden. Mit ihrem Wissen und ihrem Geld rettete sie unzähligen Kranken das Leben. Sie baute für die Armen der Stadt und besonders für Frauen ein soziales Netz auf und förderte die gegenseitige Hilfe der Frauen. Sie weckte bei ihnen das Bewusstsein dafür, sich aus eigener Kraft untereinander helfen zu können. Mit ihren Mitteln wurde das modernste Krankenhaus ihrer Zeit errichtet. Heiler aus allen Winkeln des Reiches eilten herbei und tauschten ihr Wissen mit Aphrodite aus. Reiche Römer stifteten gern Geld für ihre Einrichtungen, um ihren Reichtum zu demonstrieren. Aphrodites Macht und ihr Einfluss auf das römische Reich erreichten ihren Höhepunkt. Nach dem Tod ihres Mannes konnte sie sich vor Anträgen der reichsten und mächtigsten Männer kaum retten. Doch für sie gab es nur einen Mann, den sie auch über seinen Tod hinaus liebte. Er würde immer bei ihr sein.
Die Zeitreisende hat nur ein Problem: Die geliebten Menschen um sie herum altern, sie aber nicht. Ihre Tochter kann man inzwischen für ihre Mutter halten. Sie muss eine Entscheidung treffen. Wie es weitergeht, erfahren Sie in diesem Teil. Sie erlebt wieder unglaublich spannende Abenteuer und meistert sie exzellent im Ägypten zur Zeit von Ptolemäus X. Alexander I. Der Autor hat mit der 2. Auflage sein Erstlingswerk sehr stark überarbeitet und die kritischen, trotzdem begeisterten Hinweise berücksichtigt. Und so liest sich der Anfang, in dem sich Aphrodite Sorgen um ihre Tochter Mira macht. Und die haben mit dem Thema Schwangerschaftsverhütung
zu tun. Wir treffen Aphrodite allein:
„Syrakus – 20 Jahre später
Feuerrote Wolken am Horizont kündigen die Sonne an. Nur wenige Augenblicke noch, dann steigt die Sonne aus dem Meer. Ein besonders heißer Tag kann es auch heute wieder werden. Der milde schwache Wind von der See her und die Stille will Aphrodite heute besonders ausgiebig genießen. Schlafwandlerisch findet Hengst Tachos den Weg zum Strand, findet ihren gemeinsamen Platz, wo Aphrodite zum Baden und zum Meditieren jeden Tag die Sonne begrüßt. Ein Platz am Meer, der scheinbar nur ihr vorbehalten ist. Doch Aphrodite weiß, die Menschen der Antike haben nicht die Muße für Erholung und Entspannung am Meer. Für die meisten Menschen hier hat das Meer etwas Bedrohliches. Nur die wagemutigsten Männer trauen sich auf das offene Meer hinaus. So kann Aphrodite sicher sein, dass auch heute an diesem frühen Morgen der Strand nur für sie alleine da sein wird. Nur die Fischer werden sie vielleicht sehen, wie sie nackt in die Fluten steigt. Volle Netze sind ihnen so sicher, glauben die Fischer bis heute. Aphrodite will nach dieser wilden Nacht in ihrer Villa im Meer endlich wieder einen klaren Kopf bekommen.
Sie springt vom Pferd und setzt sich erst einmal auf einen der großen Steine am Wasser. Ruhe suchend blickt sie der aufgehenden Sonne entgegen. Es ist ein erhabener Moment, wo Sonne und Meer vereint scheinen. Hier findet Aphrodite wieder die Kraft für den neuen Tag. Es ist auch der Moment, wo die fliehende Nacht dem neuen Tag einen letzten Gruß schickt und der Himmel sich wie zum Dank in den schönsten Farben zeigt. Hier findet sie den nötigen Abstand von allem, was sie sonst so belastet. Sie muss über vieles nachdenken. Viel muss neu überdacht und neu entschieden werden, ist ihr längst klar geworden. So kann es jedenfalls nicht mehr weitergehen. Ihre kleine heile Welt hat einen gewaltigen Riss bekommen.
Es war gestern wieder einer der Festtage, die sie lieber ganz schnell vergessen möchte. Alles artete aus und steigerte sich schon ins makaber Absurde. Ihre Tochter Mira mittendrin. Das alles nur, weil ausgerechnet Mira nicht verhüten will. Aphrodite kann das überhaupt nicht verstehen. Zum Glück kennt und hat sie die Mittel, eine Schwangerschaft zu verhindern. Und das zu einer Zeit, wo die Frau es hinnehmen muss, jedes Jahr schwanger zu werden, nur weil sie dem Trieb der Männer nichts entgegensetzen kann. Eine Frau, die es wagt, sich dem Mann zu verweigern, darf hart bestraft werden. So ist es der unumstößliche Wille der Götter. Daran ändert sich auch nichts, wenn Jesus oder der Prophet Mohamed das alte Weltbild der Götter für immer aus den Angeln heben werden. Für Frauen kommt es dann knüppeldick und sie dürfen dann nur noch zu ihrem Mann aufschauen und ihn wie einen Gott anbeten. Ein Jahrhundert trennt sie zu ihrem Glück noch von dieser für Frauen schrecklichen Zeit. Nur sie, die göttliche Aphrodite, hat die schützende Pille und ihre Tochter, die dumme Kuh, will sie nicht nehmen. Dabei müssen die Frauen noch zweitausend Jahre auf diese Wunderpille warten. Doch Mira lehnt jede Art von Verhütungsmitteln rundweg ab. Für sie ist jedes Kind ein Geschenk der Götter. Mira hat jetzt schon drei Kinder. Drei Kinder großziehen, das reicht nach Aphrodites Ansicht. Was alle anderen Frauen natürlich ganz anders sehen. Eine Frau mit zehn Kindern ist hier die Regel. Viele schwache oder kranke Kinder lassen aber dann jeder Frau doch nur vier oder fünf Kinder. Miras Kinder, Minoa, Thelema und Perselos sind liebe Kinder, zum Glück gesund und wohlgeraten. Sie haben alle einen anderen Vater. Die fremden Väter werden sie vielleicht in ihrem Leben nie sehen. Mira sucht sich immer nur Männer aus, die zwar potent und gut im Bett sind, aber am Morgen danach auf ein Schiff steigen, um ferne Länder zu bereisen oder in den Krieg zu ziehen. Verrückter noch, Mira hofft scheinbar sogar, dass keiner der Väter jemals wiederkommt. Sie begründet ihre herzlose Entscheidung ausgerechnet mit den leidvollen Erfahrungen ihrer Mutter.
Selbst der arme und liebe Titus Anton, der leider viel zu früh verstorben ist, muss dafür herhalten. Die Götter mögen ihr und Mira das vergeben. Gestern Abend hat Mira sich den Mann für das nächste Kind ausgesucht. Sie hat ihm so den Kopf verdreht, dass er blind vor Leidenschaft über sie herfiel. Sie legte es richtig darauf an, dass der Mann, von seinen Trieben geblendet, alles um sich herum vergaß. Sie musste als Mutter mit ansehen, wie ihre Tochter von diesem eingebildeten Ägypter vielleicht wieder geschwängert wurde. So schön für sie auch guter Sex ist, zusehen ist nicht ihr Fall. Der Ägypter zeigte erstaunlich viel Ausdauer. Mira wollte, dass alle Gäste und vor allem die hohen Würdenträger sehen, wer sie dieses Mal schwängert. Aphrodite und fünfzig andere von ihr geladene Gäste schauten dabei zu, wenn sie nicht gerade selbst in gleicher Art und Weise miteinander beschäftigt waren. Dass ihre Tochter das als Hohepriesterin öffentlich tun durfte, nein sogar tun musste, entschuldigt nicht die Entgleisung. So hat sie ihre Tochter nicht erzogen. Auch wenn Mira sich mit ihrem Verhalten gerne auf ihre Mutter beruft. Doch als sie öffentlich von den Männern genommen wurde, war sie im Gegensatz zu ihrer Tochter noch eine rechtlose Sklavin. Nun ja, ein paar Männer waren es dann später auch noch. Mira versteht es als ihr Vorrecht, sich auf diese Art den Vater für ihr Kind zu suchen. Nun behauptete sie letzte Nacht in ihrem Rausch vor allen Gästen, dass sie über eine Schwangerschaft selbst entscheidet. Sie hat damit ein Tabu gebrochen. Über so etwas spricht man einfach nicht, denn die Männer glauben fest daran, dass nur sie alleine darüber entscheiden, wann eine Frau schwanger wird. Das Wissen über die fruchtbaren Tage einer Frau ist hier nur den Huren bekannt. Nur die Priesterinnen, die Hetären und die Huren wissen, wie sie sich vor den Männern schützen können. Die Männer dürfen es niemals erfahren. Ihre heile Welt würde dann untergehen.“
Erstmals 1981 erschien im Verlag Neues Leben Berlin „Der Sohn des Adlers, des Müllmanns und der hässlichsten Frau der Welt. Ein Märchen vom Eis und vom Feuer“ von Waldtraut Lewin: Das Buch ist eine ebenso skurrile wie zarte Geschichte von einem, der auszog, die Welt zu retten und sich dabei fast selbst verlor.
Die hässlichste Frau der Welt kann sich vor Verehrern kaum retten. Sie ist eben eine Sensation! Und so kommt es, dass ihr Sohn gleich zwei Väter hat: Einen stolzen Adler und jenen schönen Müllmann, der eigentlich von der Frau gar nichts wissen will und ihr eben den Gefallen tut.
Als das wundersame Kind dann aber geboren wird – was ihre Mutter in einen tiefen Schlaf versenkt – streiten sich die beiden absonderlichen Erzeuger um die Vaterschaft. Denn dieser Sohn ist zu Höherem bestimmt, wie es scheint. Er hat nichts mehr und nichts weniger vor, als die Welt von allem Übel zu erlösen. Allerdings verliert er darüber seine Mutter aus den Augen – und so etwas tut nie gut.
Der Sohn eilt von Abenteuer zu Abenteuer, und überall, wo er auf Unrecht und Verdrehtheiten stößt, schafft er Ordnung. Jedenfalls meint er das, während er weitereilt, getrieben von Neugier und dem Drang nach Gerechtigkeit.
Aber nur etwas zu „stiften“ und dann fortzurennen, das reicht nicht aus, wie sich herausstellt. An welchen Ort seiner Taten er auch zurückkommt, immer muss er feststellen, dass sich die Dinge inzwischen zum Schlechten entwickelt haben.
Und er kann weder verhindern, dass seine Mutter stirbt und seine Liebe, das kieselsteinerne Fräulein, in seinen Armen ganz und gar erstarrt.
Alles scheint aus zu sein für ihn. Aber zum Glück erwachsen ihm mächtige Helfer. All die Schwachen und Betrübten, denen er einst so unvollkommen geholfen hat, verbünden sich für ihn, und gemeinsam sind sie stark. Und da sich außerdem noch seine beiden ungleichen Väter aussöhnen, um ihrem Sohn beizustehen, kann ja die Welt vielleicht doch noch gerettet werden. Wenn man sich auch zunächst eine blutige Nase geholt hat. Aber schließlich wird man aus Erfahrung klug.
Die absonderlichen Abenteuer des Sohns, die ihn mit vielen unglaublichen Geschöpfen zusammenführen und in denen die Welt gleichsam durch ein leicht verzerrendes Brennglas betrachtet wird, sollen erstaunen, vergnügen und den Leser dazu anregen, das „Schiefe“ in diesen Geschichten in ihrem eigenen Kopf geradezurücken. Denn eigentlich kann immer nur der verfremdete Blick uns helfen, den Reiz der Wirklichkeit zu genießen. Nur die Fantasie öffnet den Blick.
„Der Sohn des Adlers“ knüpft an die Tradition des romantischen Kunstmärchens an, wie wir es von Goethe, von Clemens Brentano und vor allem natürlich von E.T.A. Hoffmann her kennen und das im Gewand einer modernen, ein bisschen surrealen und ein bisschen schrägen Sprache. Er hat eben, wie gesagt, zwei Väter. Aber dazu muss er erst einmal zur Welt kommen. Und davor musste natürlich noch etwas anderes passieren:
„Erstes Hauptstück von der merkwürdigen Empfängnis und Geburt des Sohnes, den Gaben des Adlers, der Harmonie der Sphären und der stillestehenden Zeit
Bevor seine Mutter ihn empfing, war sie die hässlichste Frau, die man sich denken kann. Sie war so hässlich, dass sich die Leute auf der Straße bis zu den Knien bogen vor Staunen über ihre Hässlichkeit. Sie hatte eine Haut wie ein Nilpferd, Zähne wie ein Waldeber, Haare, die wie Schilfhalme aussahen, und ihre Augen tränten, und an ihren Händen wuchsen graue Krallen. Aber ihr Herz war wie ein süßer Mandelkern in ihr.
Der Ruhm ihrer Hässlichkeit und ihres süßen Herzens ging in großen Wellen von ihr aus und lockte viele Männer an, denn ein so hässliches Weib zu besitzen ist eine große Ehre. Allen, die um sie warben, blieb bei ihrem Anblick fast das Herz stehen vor Beklommenheit und Entsetzen, aber dies Entsetzen wandelte sich alsbald in eine wilde Entschlossenheit, sie zu haben, und es war, als verfüge sie im Winkel ihrer grauen verschwimmenden Augen über mehr Bannkraft als ein großer Magnet, der so stark ist, dass er das Eisen aus den Schiffen zieht, und sie gehen unter.
Da sie keinen der Freier erhörte, aber auch keinen abwies, zog der Schwarm von Liebhabern ständig hinter ihr her wie ein Königsgefolge. Der eine schleppte ihre abgetragene Handtasche, der zweite ihren Sonnenschirm aus roter verschlissener Seide, der dritte ihren Regenschirm aus schwarzer Baumwolle, der vierte eine Standuhr, damit sie stets wisse, welche Stunde geschlagen habe, der fünfte zwei Zimmerlinden in Töpfen aus Majolika, falls sie im Grünen ausruhen wollte.
Der sechste bat sie flehentlich, ein Schleppkleid anzuziehn, damit er ihr die Schleppe tragen dürfe, aber trotz ihrer Güte ließ sie sich nicht dazu bewegen, etwas so Unmodernes wie ein Schleppkleid anzulegen. So musste dieser Freier nutzlos hinter ihr herlaufen und weinte oft, weil er ihr nicht dienen konnte.
Eines Tages im Februar stieg das Thermometer auf golden, ein Taubenpärchen hackte gegen die Fensterscheibe, und die Krokusse im Rasen sprangen mit jenem Geräusch auf, das von Küssen herrührte.
Sie verspürte den heftigen Wunsch, auf der Straße vor einem Café zu sitzen und einen Eisbecher mit Rosenblättern und Pfefferminz zu essen und lief so schnell los, dass ihr fast die Absätze von den Schuhen flogen und die Freier kaum zu folgen vermochten.
Als sie mit ihren sechs Verehrern schließlich in der Sonne saß, standen die Leute im Halbkreis, um sie zu sehen. Touristen machten Fotos von ihr, um sie zu Hause ihren staunenden Kindern zu zeigen, und zwei Naturforscher stritten sich, ob ihre Haare wirklich welke Schilfhalme seien oder nur so wirkten. Mehrmals musste der sechste Freier, glücklich darüber, etwas tun zu können, die Menge bitten, so viel Platz zu lassen, dass die Sonne durchkomme.
Sie rührte in ihrem Eisbecher mit Rosenblättern und Pfefferminz und hatte plötzlich keinen Appetit mehr. Die Standuhr schlug Mittag und einen Schlag darüber hinaus. Ein großer Schatten fiel auf ihre Hand.
Aufblickend, gewahrte sie einen riesigen Adler mit dunkelbraunem Gefieder, dessen gebogener Schnabel auf sie gerichtet zu sein schien. Ihr Herz klopfte stürmisch. Die Krallen des Vogels waren ihren Fingernägeln verwandt, und die gefühllosen Adleraugen glänzten.
Sie brach überstürzt auf und zahlte mit einer Muschel. Der Adler gab ihr ein Stück das Geleit, man hörte das gewaltige Rauschen seiner Schwingen noch drei Straßenzüge weiter, so dass der Magistrat annahm, der Staudamm sei gebrochen, und Vorkehrungen zur Rettung der Stadt traf.
Unterwegs, in der quirlenden Menge, die sie umgab, traf sie das Orangerot des Müllwagens wie eine Botschaft. Der Müllfahrer trug eine Mütze aus vielerlei Fellen, aber hauptsächlich vom Kaninchen. Die Haut seiner Hände und seines Angesichts war gelb vor Asche, aber als er die Hand hob, sich den Schweiß abzuwischen, entblößte er einen gemeißelten Arm mit Adersträngen. Seine unförmigen Handschuhe hingen ihm müßig an der Hüfte.
Die hässlichste Frau der Welt trat auf ihn zu, und während ihr süßes Herz zu leuchten begann, sagte sie: „Ich glaube, ich liebe dich.“
Weil der Müllwagen lärmte wie ein Wachhund, musste sie ihre Worte wiederholen.
Der Müllfahrer besah sie von oben nach unten, darauf von unten nach oben, brach in Gelächter aus und wandte sich ab.
Die hässlichste Frau der Welt begann zu weinen. Ihre Tränen flossen wie der Regen, und alle Freier zogen ihre gestickten Taschentücher, sie zu trocknen, aber so ein Tuch war im Nu nass. Nur der sechste Freier hatte zwei Reservetücher, weil er selbst so oft weinen musste.
So zogen sie dem Müllwagen hinterher von Straße zu Straße, erst der Müllmann, dann die hässlichste Frau der Welt und ihre Verehrer, zuletzt die Schaulustigen.
Als das achte Taschentuch vollgeweint war, trat die hässlichste Frau wiederum auf den Müllfahrer zu und wiederholte ihre Worte.
Darauf sagte er: „Olles Monster“ und andere Worte und spuckte aus.
Sie fiel in Ohnmacht.
Die Freier trugen sie nach Haus, wobei der, welcher sonst leer ausging, ihren Kopf mit den Schilfhaaren halten durfte und sehr glücklich war.“
Erstmals 1971 veröffentlichte Heinz Kruschel im Mitteldeutschen Verlag Halle-Leipzig seinen Roman „Wind im Gesicht“: Hier erzählt er die Geschichte des Biologen Robert Karnel, der seine eigene Dissertation verwirft, weil er einem außerordentlich interessanten und volkswirtschaftlich wichtigen mikrobiologischen Problem auf die Spur gekommen ist und helfen möchte, es zu lösen. Gleichzeitig hat Karnel Studenten zu erziehen, Biologie-Lehrer von morgen; auch dies versucht er auf neue Weise, er kämpft an gegen den toten Wissensballast einer bloß beschreibenden Wissenschaft; er sucht der Hochschulreform an seinem Institut schneller zum Durchbruch zu verhelfen. Gelegentlich erweist er sich dabei als Einzelgänger wider Willen, gelegentlich aber verbauen er und seine Freundin Jane sich auch selbst den Weg zu neuen Formen kollektiver Arbeit, die sie ja eigentlich anstreben. Es gelingt dem Autor, mit diesem Roman aus dem Milieu junger sozialistischer Wissenschaftler in einer spannenden Handlung Probleme jener Zeit zu gestalten. Immer geht es dabei um die Probleme und Konflikte von Menschen und um ihre Lösung. Hier der rattenscharfe Beginn:
„Wissen ohne Gewissen ist der Ruin der Seele
Rabelais
Erster Teil
1.
Der Alte hatte die Ratte abgetötet.
Er saß breitbeinig auf dem Holzstuhl am Tisch, sein Bauch ruhte auf den Oberschenkeln. Er schnaufte und dachte: Wenn Karnel nicht bald kommt, fängt sie an zu stinken, draußen haben wir an die dreißig Grad, wir können froh sein, dass die Mauern hier so dick sind, stabil haben die Mönche gebaut, das muss man ihnen lassen. Kommen könnte Karnel bald, da sitzt er nun die ganze Ferienzeit über am Institut, verheiratet müsste der sein, aber da könnte einem ja die Familie leid tun, der wäre ja doch nur mit seiner Biologie verheiratet …
Von seinem Platz aus konnte er beobachten, wie Robert Karnel aus dem löwenbewachten Portal des Hauptgebäudes trat, auf der Treppe stehen blieb und in den Himmel blinzelte, als wäre er überrascht, dass er so hoch war und so sonnig. Als Karnel über seinen widerspenstigen Haarschopf strich, lachte Engalke auf. Er erinnerte sich, dass Karnel einmal Pomade in sein Haar geschmiert hatte, weil ihm der Direktor in einer Feierstunde eine Auszeichnung geben wollte. Die Studenten hatten gefeixt, als sie Karnel erkannten, so fremd, so unnatürlich fremd wirkte der auf der Bühne mit dem angeklatschten, glatten Haar – wie ein Friseurkopf aus dem Werbefernsehen.
Seitdem hatte Karnel nie wieder den Versuch unternommen, seine Haare zu bändigen; es war, als fielen sie in alle Richtungen, auch in die Stirn. Aber das passt zu ihm, dachte Engalke vergnügt, ein Brausekopf ist er.
Karnel kam über den Hof. Man merkte seinem wiegenden Gang die Prothese nicht an. Sie werden ihn ja wohl befördern, dachte der Alte, er wird zum Lehrstuhlleiter gemacht, es gibt keinen besseren Mann dafür …
„Hast du das Tier geschafft?“, fragte Karnel, als er in das Zimmer trat. „Du siehst so erschöpft aus, hat sie sich gewehrt?“
Engalke winkte ab und wies auf den Seziertisch. „Ich kann mir Schöneres denken“, meinte er, „als in den Ferien trächtige Ratten zu sezieren.“
„Ich auch. Aber ich brauche den gefärbten Schnitt durch den Embryo …“
Engalke schüttelte seine weißen Loden. „Können das die Laboranten nicht besser?“
„Du traust mir nicht mal das zu, Fritze? Natürlich können es die Laboranten besser, aber sie sind nicht da, verstehst du, Ferienzeit. Die Fernstudenten sind nun auch weg, da habe ich Lust, ein bisschen Handwerk zu treiben, außerdem brauche ich ein paar frische Schnitte für die neuen Seminare.“ Er trat an den Tisch, auf dem das Tier lag, und öffnete geschickt mit Skalpell und Schere die Leibeshöhle und legte die Embryonen mit dem Uterus frei.
Engalke knöpfte sich den Hosenbund über dem Bauch zu und sagte: „Hörst du, da fährt ein Dampfer.“
„Die fahren doch immer in der Hochsaison, ins Grüne nach Hohenwarthe zum Bockwurstessen …“
„Und du?“
„Was, ich?“
„Ich meine, fährst du nicht? Nicht mal an die Ostsee?“ Karnel injizierte die Embryonen mit einer Tempospritze, damit die feinen Gewebe nicht durch Autolyse zerstört werden konnten, und legte sie vorsichtig in Boinsches Gemisch aus Pikrinsäure, Formal und Eisessig. Dann wusch er sich sorgfältig die Hände, Engalke reichte ihm das Handtuch.
„Ich habe drei Wochen lang täglich fünf Lehrveranstaltungen mit Fernstudenten gehabt“, sagte Karnel, „wie hätte ich da an die See fahren können? Und jetzt, wo alle Räume leer sind, fehlt mir etwas, ich fühle mich plötzlich nicht mehr beschäftigt genug.“
„Dann fahre doch noch ein paar Tage.“
Karnel antwortete nicht, das einzige Geräusch im Zimmer war das Tropfen des Wasserhahns, eintöniges Klick-klack-klick. Der Alte ging zum Fenster und öffnete es weit. Alles war nah: die Rufe der Möwen über dem trägen, breiten Fluss, das gemütliche Tuten der Dampfer, das aufgeregte Bimmeln einer Straßenbahn. Engalke setzte sich wieder, nahm aus der Schachtel eine Zigarette, rieb das Streichholz an und blickte über das Flämmchen hinweg nachdenklich auf Karnel. „Wirst du dieses Jahr noch deinen Doktor haben?“, fragte er. „Doktor Robert Karnel, das klingt, was?“ Er lachte.
„Nein“, sagte Karnel und lächelte, „ich habe die Dissertationsschrift zurückgezogen, ich muss noch einmal anfangen …“
Engalke schlug mit der flachen Hand auf den Tisch. „Aber du bist fertig gewesen! Du hattest viele neue Arten entdeckt und beschrieben von diesen kleinen Viechern …“
„Turbellarien, meinst du. Ja, das hatte ich, stimmt. Und vielleicht würde meine Dissertationsschrift auch durchkommen, so eine althergebrachte Beschreibung der Arten, aber in dem Thema steckt mehr, Fritze, das muss ich herausholen, ich muss es entschlüsseln. Aber ob ich es kann …“
Engalke brummte: „Und ich hatte den Wein schon bereitgestellt. Na, du wirst wissen, was richtig ist …“ Er dachte: Ein Dickkopf ist er. Alle glauben, dass Karnel dieses Jahr noch promovieren wird. „Weiß das der Chef schon?“
„Das wissen erst mein Doktor-Vater an der Uni, ich, du und Posalaky …“
„Dein ungarischer Kollege?“
„Ja.“
Engalke dachte: Zu gründlich ist Karnel, zu exakt, kein Pedant, aber bei ihm muss alles lückenlos sein. Er sagte: „Na, wenn du Zeit hast, Mensch, dann fahre doch noch zwei, drei Tage weg, verkriech dich nicht bei den blöden Ratten, die kann ich auch fertigmachen.“
Karnel lachte. „Perfekter Laborant.“
„Du denkst, ich kann bloß Tiere pflegen, ja? Gib mir zwanzig, ach was, zehn Jahre von deinem Leben ab, und ich mache euch allen einen echten Wissenschaftler vor …“ Karnel sagte zögernd, den Blick auf das Blau gerichtet, das die Fenster ausfüllte: „Du musst das Objekt entwässern …“
„Bin ich ein Anfänger?“
„Entschuldige, Meister.“
„Manchmal erschrecke ich vor eurer Biologie, Bob.“
„Nanu? Warum denn?“
„Ich habe da eine Sendung gehört. Man hat einige Hundert Ratten dressiert, auf ein bestimmtes Signal hin erschienen sie am Futterplatz, einzeln, nicht in Massen hat man sie gerufen. Na gut, das kann man dressieren. Aber dann hat man sie schnell getötet, ihnen die Ribonukleinsäure aus den Hirnen entfernt und die Säure anderen und nicht dressierten Ratten in die Bauchhöhle gespritzt. Dann wurde das Experiment wiederholt. Die nicht geimpften Ratten reagierten nicht, aber von dreihundertfünfundsiebzig injizierten Ratten reagierten dreihundertsiebzig sofort richtig und rannten zum Futterplatz, weil die Säure der getöteten Tiere ihnen diese Information übergeben hatte …“
„Aber das ist wunderbar, Fritze, ein gutes Experiment.“
„Ich weiß nicht. Ich kann mir so den nächsten Schritt vorstellen. Man wird Menschen verändern können. Durch Drogen, wie? Durch diese Säure? Durch fremde Informationen? Da kennt man sich selber nicht mehr. Da wacht der Tierpfleger Fritz Engalke eines Morgens auf und spricht wie ein Hindu, oder er hat ein Referat über Molekularbiologie im Kopf, das er noch nie gehört hat und auch gar nicht begreift!“
Karnel lachte laut. „Ob Drogen oder nicht“, sagte er, „wir können diese Möglichkeiten der Biologie zurzeit nur unterschätzen. Sie wird Erkenntnisse bringen – und auch Veränderungen bei uns Menschen, die die Kernspaltung in den Schatten stellen werden.“
Die Aspekte sind klar, dachte er, die Lernergebnisse, das sind eingeschliffene, bedingte Reflexe, werden in der RNS determiniert. Das bedeutet, dass Lernergebnisse in keinem Falle vererbbar sind. Es müssen in der Schaltzentrale, in Rückenmark, Gehirn und Ganglien, mit der Zeit Matrizen für bestimmte Handlungs- und Planungsvorlagen entstehen. In der RNS verändern sich dann die Schaltzellen, die Folge der Stickstoffbasen wird verändert, was zum Entstehen bestimmter Eiweiße führen muss. Ja, mein Alter, die Biologie beginnt, die letzten Wunder zu entkleiden
„Was ist nun?“ Engalke zeigte auf das sezierte Tier. „Fährst du? Oder ist dein Hirsch nicht fit?“
Ich könnte wirklich fahren, dachte Karnel, ein paar Tage in Luft und Sonne … „Das Auto ist schon in Ordnung.“
Engalke sagte: „Mach dir keine Sorgen, ich weiß Bescheid. Von Aqua destillata die Alkoholreihe hochführen, von dreißig auf sechsundneunzig Prozent, dann von Optal in Xylol legen …“
„Du musst es dreimal in Xylol legen, sonst streikt das Paraffin.“
„Weiß, weiß, hau schon ab …“
„Ich fahre wirklich.“
„Drohe nicht immer nur. Eine Ansichtskarte brauchst du nicht zu schicken, aber bring ’nen Eimer voll weißen Sand mit, fürs Aquarium, weißt du …“
„Wird gemacht. In drei Stunden könnte ich das erste Mal ’rausschwimmen …“ Er dachte: Über das Studium des Lebenden darf man das Leben nicht vergessen.“
Als Eigenproduktion von EDITION digital erschien 2014 „Die Petermännchenpuppe. Pinnowkrimi“ von Ulrich Hinse – und zwar sowohl als gedruckte Ausgabe wie als E-Book: Das Grauen geht um in dem kleinen Dorf Pinnow wenige Kilometer östlich des Schweriner Sees. Innerhalb kürzester Zeit werden mehrere Tote in der näheren Umgebung gefunden. Bei allen befindet sich eine Stoffpuppe, die in Schwerin als Andenken an den Schlossgeist verkauft wird. Das Petermännchen.
Die Kriminalisten um Raschke, den Leiter der Mordkommission Schwerin, ermitteln hektisch, aber es finden sich so gut wie keine Hinweise oder Spuren. Es ist zum Verzweifeln. Eigentlich könnte es nur ein Einwohner des kleinen Örtchens Pinnow sein. Einer, der auch im Winter mit dem Fahrrad fährt. Es gibt Hinweise, aber keine Beweise.
Als dann noch das Mitglied einer Rockergang zu Tode kommt, die in einem Nachbarort ihr Quartier hat, mischen plötzlich noch ganz andere bei den Ermittlungen mit. Die Polizei gerät unter Druck.
Gelingt es dem Ersten Kriminalhauptkommissar Raschke mit seinen Leuten, den Täter festzunehmen, bevor die Sache eskaliert? Ein spannender Krimi aus der Gegend in und um Schwerin. Am Anfang des Buches aber ist eigentlich noch gar nichts passiert. Oder doch?
„1. Kapitel
Es war ein winterlicher, feuchtkalter Januarmorgen in dem kleinen Örtchen Pinnow gut drei Kilometer östlich des Schweriner Sees. Die Tage mit den vielen vollmundigen Neujahrswünschen waren noch nicht allzu lange vorbei. Es war Sonntag. Trüber Himmel, böiger Wind und nieselnder Regen. Alles so knapp über Null Grad. Wen man in Pinnow auch traf, alle waren warm angezogen mit dicken Winterpullovern, wattierten Jacken oder langen Stoffmänteln. Die Mützen tief in die Stirn gezogen.
Gunnar, ein stämmiger Vierzigjähriger, war die ganze Nacht unruhig gewesen. Er hatte seine Wohnung in dem alten Büdnerhaus, das er von seinen Eltern geerbt hatte, recht früh am Morgen verlassen, das Fahrrad aus dem Schuppen geholt und war dick eingepackt und mit Handschuhen trotz des miesen Wetters durch den Wald bis nach Basthorst gefahren.
Der Himmel war grau. Er brauchte nur wenige hundert Meter auf der Kreisstraße vom Ende des Ortsteils Petersberg durch Muchelwitz zu fahren, dann war er im Wald. Die Bäume streckten ihre laublosen Äste wie ein Dach über die schmale Straße. Von ihnen tropfte es stetig. Ärgerlich fuhr er sich immer wieder mit der Hand durchs Gesicht, wenn ihm die Tropfen in die Augen gefallen waren, denn dann verschwamm alles vor seinen Augen.
Im Wald war es still. Nichts war zu hören. Sogar die Autos, welche die schmale Straße recht häufig nach Kladow, Gädebehn, Basthorst oder Crivitz benutzten, wollten bei dem Wetter offenbar nicht fahren. Er war allein mit sich und seinen Gedanken. Blutige Bilder tauchten vor seinem inneren Auge auf. Er spürte, er würde es bald tun müssen. Seine Seele, ja sein ganzer Körper verlangte danach. Es fühlte sich an wie ein Ziehen in seinem Magen.
Er rollte schnell in Basthorst den Hang hinunter, zwang sich mühsam aus dem Warnowtal hoch nach Kladow und weiter bei leichtem Gegenwind durch die lange Allee bis nach Gädebehn. Er schaute nicht nach links und nicht nach rechts. Den Weg und die Umgebung kannte er. Außerdem gab es nichts zu sehen außer freiem Feld.
Er war nie ein gläubiger Mensch gewesen. Seine Eltern hatten ihn zwar taufen lassen, sich aber dann um religiöse Erziehung nicht mehr gekümmert. Ihn selbst hatte das auch nicht interessiert und in der damaligen DDR hatte es auch niemanden gegeben, der ihm den Weg in die Kirche hätte weisen können. Er hatte sich in der Gesellschaft für Sport und Technik, in der DDR kurz GST genannt, recht wohl gefühlt. An mehr war er nicht interessiert und er hatte sich vor allen anderen Verpflichtungen, die der Staat seinen Bürgern auferlegte, mehr oder weniger erfolgreich gedrückt.
Er war ein wenig schüchtern und hatte sich nicht getraut, ein Mädchen anzusprechen. Deshalb war das andere Geschlecht für ihn fremd geblieben. Bis heute war er ledig. Zu sozialistischen Zeiten war er in der Gärtnerei in Petersberg beschäftigt gewesen. Die hatte in der neuen Wirtschaftsordnung Insolvenz angemeldet und zu allem Überfluss konnte er nach der Wende keine Arbeit mehr finden.
So lebte er einfach in den Tag hinein. Mit seiner Stütze vom Arbeitsamt kam er aus. Nicht gut, aber es ging.
Jetzt war er verwirrt, als er merkte, wie es ihn plötzlich nach einer kultischen Droge verlangte. Ein solches Gefühl war ihm bisher völlig fremd. Er hatte sich zwar schon immer sehr mit den Sagen und Mythen aus der näheren Heimat um Pinnow, Godern und Raben Steinfeld befasst und die Geschichten offenbarten ihm neue, verlockende Reize. Aber dass er sich das Ganze so zu Herzen nahm, war ein schleichender Prozess gewesen. Die Trolle und Gnome, vor allem aber das Petermännchen, schrien nach Blut. Und das, obwohl das Petermännchen eigentlich ein guter Geist gewesen war. Er war verwirrt, fühlte sich, als wollte ihm der Kopf platzen.
Ausgerechnet ihn, den arbeitslosen Gunnar Löffler aus Pinnow, hatte das Petermännchen dazu ausersehen, ihm Opfer zu bringen, und er konnte sich dem Ruf nicht widersetzen. Er beschloss, dem Ruf des Petermännchens in der kommenden Nacht zu folgen.
Sein erstes Opfer hatte er bereits ausgewählt. Den Ablauf der Opferung hatte er in den vergangenen Tagen bis ins Detail geplant. In seinem Kopf sah er minutiös genau, wie er die Tat ausführen würde. Immer wieder hatte er den Tatablauf durchgespielt, modifiziert, mögliche Fehler beachtet und die Geschehensabläufe verändert. Die Zeit des Überlegens und des Zögerns war nun vorbei. Aber Vorsicht, übereilte Hast macht alles kaputt, mahnte er sich selbst.
In Basthorst war er ganz durch den Ort gefahren. Vor dem Hotel stieg er vom Rad. In dem Restaurant gab es am Sonntag immer einen Frühstücksbrunch. Den wollte er genießen und sich ein wenig von seinen Gedanken ablenken. Einmal im halben Jahr konnte er sich das leisten, weil er das Geld dafür extra zurücklegte.
Mühsam schälte er sich aus seinen dicken Wintersachen, die er so an der Garderobe platzierte, dass er sie problemlos wiederfinden konnte. Er suchte einen Platz, bestellte Kaffee und während er sich die besten Sachen vom Buffet heraussuchte, dachte er zum wiederholten Mal an sein Opfer.
Unten in Mueß, auf einem Parkplatz neben der Ruine einer ehemaligen Gaststätte, dort, wo das Wasser des Sees in die Stör floss, stand seit einiger Zeit ein klappriges, angerostetes Wohnmobil. Darin lebte ein einsamer Mann. Schon über Weihnachten und Neujahr hatte der Wagen des Fremden dort ganz allein gestanden. Die kühlen Nächte schreckten ihn offenbar nicht. Einige Tage hatte Gunnar ihn zu unterschiedlichen Zeiten beobachtet. Der Mann hielt sich nur in der Nähe seines Wohnmobils auf. Besuch hatte er die ganze Zeit nicht bekommen. Ab und zu war er den Kilometer durch die blätterlose Kastanienallee bis zu einem Supermarkt gelaufen, wo er sich einige Lebensmittel, vor allem aber Rotwein kaufte. Damit soff der Mann sich offenbar sein erbärmliches Leben schön. Gunnar hatte befunden, dass der Säufer ein gutes Opfer für Petermännchen sein würde. Ganz bestimmt eine höhere Erfüllung, als sich mit billigem Rotwein zu Tode zu saufen. Der Mann schien Däne zu sein. Zumindest sagten das die Kennzeichen des Wohnmobils aus.
Nach gut zwei Stunden hatte Gunnar seinen Brunch beendet. Er bezahlte, zog sich die warmen Sachen wieder an und machte sich mit seinem Fahrrad auf den Weg zurück nach Pinnow.“
Und damit weiß der Leser – wie in manchen Krimis üblich – fast schon mehr als die Kripo. Das heißt, noch ist ja noch gar nichts passiert. Aber das wird sich sehr bald ändern. Schließlich hat der einsame Radfahrer, der eben noch fröhlich gebruncht hat, offenbar schon einen Plan im Kopf – einen tödlichen Plan.
Viel Spaß beim Lesen und Begleiten der Ermittlungsarbeiten, weiter einen schönen Februar und bleiben auch Sie weiter vor allem schön gesund und munter und bis demnächst.
EDITION digital war vor 28 Jahren ursprünglich als Verlag für elektronische Publikationen gegründet worden. Inzwischen gibt der Verlag Krimis, historische Romane, Fantasy, Zeitzeugenberichte und Sachbücher (NVA-, DDR-Geschichte) sowie Kinderbücher gedruckt und als E-Book heraus. Ein weiterer Schwerpunkt sind Grafiken und Beschreibungen von historischen Handwerks- und Berufszeichen sowie Belletristik und Sachbücher über Mecklenburg-Vorpommern. Bücher ehemaliger DDR-Autoren werden als E-Book neu aufgelegt. Insgesamt umfasst das Verlagsangebot, das unter www.edition-digital.de nachzulesen ist, mehr als 1.200 Titel. E-Books sind barrierefrei und Bücher werden klimaneutral gedruckt.
EDITION digital Pekrul & Sohn GbR
Alte Dorfstraße 2 b
19065 Pinnow
Telefon: +49 (3860) 505788
Telefax: +49 (3860) 505789
http://www.edition-digital.de
Verlagsleiterin
Telefon: +49 (3860) 505788
Fax: +49 (3860) 505789
E-Mail: editiondigital@arcor.de
![]()