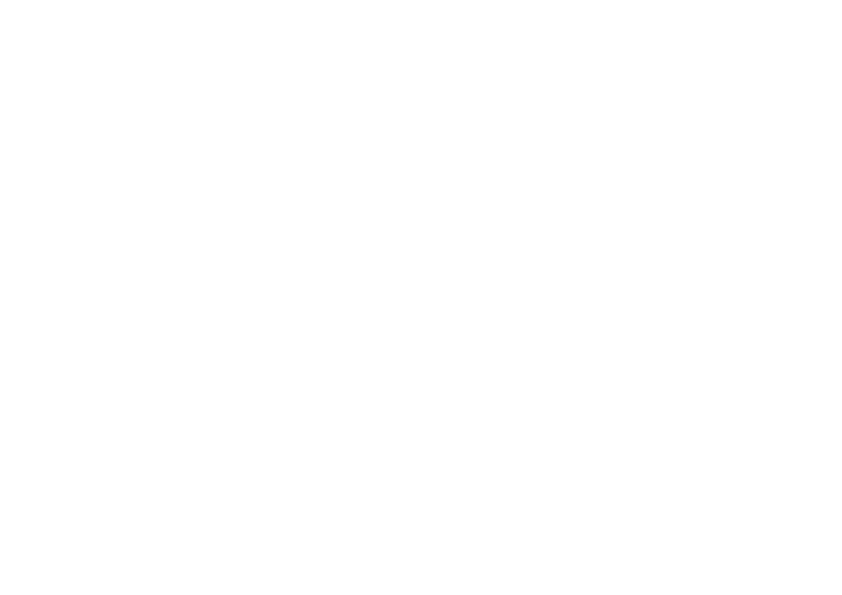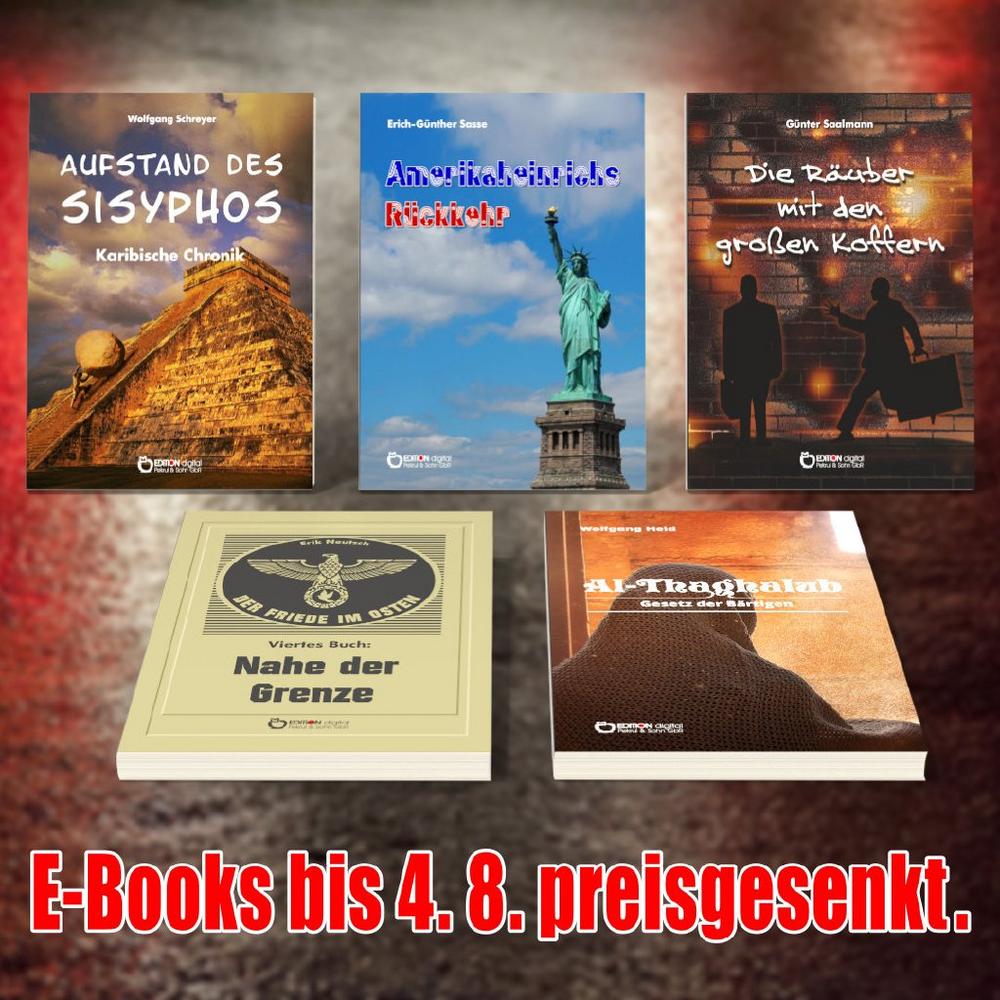Die Antwort hat mit dem Milieu zu tun. Denn diese dreizehn Erzählungen sind vorwiegend in einem Milieu angesiedelt, von dem der Autor sagt „Ich stamme vom Lande, und so ist mein Thema vorläufig das Land“. Sasses Erzählweise vermeidet Überflüssiges, beeindruckt durch psychologische Durchdringung, ist vor allem volkstümlich und lässt der Fantasie des Lesers Raum. So vermittelt seine Prosa Begegnungen mit Vergangenheit und Gegenwart, mit Alten und Jungen, mit Liebe und Zorn, ist heiter und ernst. Das alles zusammengenommen spricht jedenfalls sehr für Erzählungen vom Lande.
Spannender und hochpolitischer Lesestoff sind noch immer die drei Bände der „Dominikanischen Tragödie“ von Wolfgang Schreyer: „Der Adjutant“ (1971), „Der Resident“ (1973) und „Der Reporter“ (1980). Mit dem heute vorgestellten Essay „Aufstand des Sisyphos. Dominikanische Tragödie“ hat sich der Autor mit einem immer noch aktuellen Thema auseinandergesetzt – Revolution vor der Haustür der USA. Hat der Aufstand des Sisyphos eine Chance? Das Buch ist zugleich eine sehr gute Ergänzung zu den drei Bänden seiner „Dominikanischen Tragödie“.
„Die Räuber mit den großen Koffern“ von Günter Saalmann ist ein Krimi, in dem auch ein Anrufbeantworter eine nicht unwichtige Rolle spielt: Jana versteht gar nichts. Die fremde Stimme auf dem Anrufbeantworter krächzt und stammelt nur ein paar Worte. Doch irgendwie hört es sich wie eine Drohung an. Aber Jana ist kein Angsthase. Und Tim, ihr bester Freund, ist als Sohn eines Hauptkommissars fast ein Profi. Doch dann kommen sie, nachts, die Räuber mit den großen Koffern …
Noch einmal sehr politisch wird es im vierten von fünf Büchern des groß angelegten Romanzyklus „Der Friede im Osten“ von Erik Neutsch. In „Nahe der Grenze“ – gemeint ist die Grenze zur CSSR -, in den Wäldern des Erzgebirges, begegnen wir Achim Steinhauer wieder, dessen Lebensweg eine überraschende Wende genommen hat: Vom Drang nach Selbstbehauptung erfüllte Jahre als Gleisbauer, Fernfahrer und Mitarbeiter einer Vogelwarte liegen hinter ihm seit jenem Abschied aus Eisenstadt. In dieser Zeit hat er zu schreiben begonnen, eine Erzählung wird publiziert, die er mit Soldaten und Offizieren in einem Feldlager der NVA nach den Ereignissen vom August 1968 diskutiert.
Und damit sind wir wieder beim aktuellen Beitrag der Rubrik Fridays for Future angelangt. Jede Woche wird an dieser Stelle jeweils ein Buch vorgestellt, das im weitesten Sinne mit den Themen Klima, Umwelt und Frieden zu tun hat – also mit den ganz großen Themen der Erde und dieser Zeit. Auch nach Jahrzehnten scheint es keine Ruhe und keinen Frieden im Nahen Osten zu geben. Zu kompliziert, zu komplex und zu gewaltsam sind die in der Region immer wieder auflodernden Konflikte. Und wer wirklich mitreden will, der muss tief in die Geschichte eintauchen. Dabei kann das heute vorgestellte Buch helfen.
Erstmals 1981 erschien im Verlag Das Neue Berlin „Al-Taghalub. Gesetz der Bärtigen“ von Wolfgang Held: Reich und mit sich und der Welt zufrieden, erfährt der dänische Schäfer Bertel Björkborg – der Sinn seines Daseins besteht in der Sorge für das Wohl der von ihm allein aufgezogenen Tochter -, dass sein Kind bei einem Ausflug zu den Sehenswürdigkeiten des Heiligen Landes Opfer eines Terroranschlages geworden ist. Seinen Fäusten mehr vertrauend als den Gesetzen, verlässt er seine Heimat, um den Tod seiner Tochter zu rächen. Im abenteuerlichen Geschehen von Nachforschungen und Verfolgungen wird Bertel Björkborg mit der schwierigen Lage der Länder im Nahen Osten konfrontiert. Er gewinnt Einblick in die einem Europäer fremde und unverständliche arabische Mentalität, lebt mit den Beduinen, gerät in palästinensische Flüchtlingslager und erfährt von illegal stattfindenden Sklavenauktionen. Autor Wolfgang Held hatte mehrfach den Orient bereist. Sach- und Milieukenntnis sowie die unaufdringliche Verarbeitung gesellschaftlichen und historischen Geschehens prägen diesen Roman. Neben spannender Unterhaltung wird zeitgeschichtliche Information geboten:
Bei einer Flasche Bourbon und vielen Gläsern Bier hat Bertel Björkborg dem Deutschen während des Aufenthaltes in Sur von den Umständen erzählt, unter denen Silke ums Leben gekommen ist. Zu vorgerückter, alkoholumnebelter Stunde ist ihm Fischer dann schließlich auch vertrauenswürdig genug erschienen, um in die wahren Ziele der Suche nach den Mitgliedern der „Qibya“ eingeweiht zu werden.
Fischer gestand unumwunden, dass er ähnliches längst vermutete. Hätte sich der Plan gegen die Israelis gerichtet, wäre er freilich sofort von der Unternehmung abgesprungen. Immerhin sei er Deutscher und damit dem Volk der Juden gegenüber dermaßen mit kollektiver Schuld beladen, dass ihm hinsichtlich des Denkens und Handels dieser Menschen zeitlebens kein Recht auf kritisches oder gar feindseliges Verhalten zukäme. Aber wie die Dinge lägen, sähe er Björkborgs ziemlich verwegenes Vorhaben weniger unter moralischen als vielmehr rein finanziellen Aspekten. Er hielt für seine garantiert verschwiegene und ortskundige Mitwirkung die Summe von 2000 Dollar für ein durchaus angemessenes Honorar. Eine Hälfte sofort zahlbar, die andere fällig am Todestag jenes gesuchten Murwarkati. Als Bedingung müsse er jedoch stellen, dass ihm allein bezüglich des Ablaufes der Aktion sämtliche Entscheidungen überlassen blieben. Ohne jedes Hineinreden! Im Gegensatz zu seinem Auftraggeber betrachtete er namentlich jenen Teil des Unternehmens für wichtig, mit dem das eigene Unentdecktbleiben nach der Tat gesichert werden musste.
Bertel Björkborg ordnete sich nur widerstrebend unter. Aber er erkannte, dass kein erfolgversprechenderer Weg zu dem geschworenen Ziel führte. Er beschaffte die geforderten Dollar, während Fischer indessen mit zwei Streifzügen durch den Suk von Sur und mit einigen Telefonaten das neue Quartier der „Qibya“ im Flüchtlingslager Sabakh nahe Beirut ermittelte.
Im Lager werden die beiden Ankömmlinge zuerst von den Kindern entdeckt. Sie reagieren sehr ungewöhnlich. Die schmutzstarrenden, braunen Knirpse flitzen nicht heran, um mit krähenden Stimmen und fuchtelnden Händen die Fremden einzukreisen. Keiner bettelt Bakschisch. Sie stieben vor den Männern auseinander, als kämen tollwütige Hunde. Aus verstecktem Winkel beobachten sie fluchtbereit jeden weiteren Schritt der Unbekannten. Auch einige der Frauen werden aufmerksam. Sie halten in ihrem Tun inne und blicken ängstlich.
„So was ist mir auch noch nicht passiert“, sagt Fischer überrascht. „Anscheinend halten uns die Truppen hier für Leute von der libanesischen Obrigkeit. Sicherlich haben sie mit solchen Typen keine besonders guten Erfahrungen gemacht.“
Ein Stück weiter im Lager finden sie ein paar Männer, die Löcher für Stützpfeiler ausheben und Kanthölzer zusammennageln. Ihre nackten, braunen Oberkörper glänzen schweißig. Alle sind nur mit den hellen Sirwals bekleidet, jenen um die Hüften sehr weiten und nach unten eng werdenden Hosen der palästinensischen Männertracht. Nur zwei von ihnen tragen Sandalen, die anderen laufen barfüßig umher. Ein Schutzdach entsteht, in seinen Dimensionen ausreichend, um künftig einigen Dutzend Menschen Schatten zu spenden.
Fischer spricht die Arbeiter an. Er erfährt, dass der Bau zugleich als Schule, Kaufhalle, Versammlungsplatz und Kulturzentrum dienen soll. Das Wichtigste, so sagt man ihm, sei die Schule. Allerdings hat man vorläufig noch keinen Lehrer. Die Zigaretten, die Fischer anbietet, finden dankbare Abnehmer. Die Männer langen zu, bis die Schachtel leer ist. Anders als die Kinder, verhalten sich die älteren Lagerbewohner den Fremden gegenüber beinah freundschaftlich.
„Ihr seid die Ersten, die hier nur zu Besuch herkommen“, sagt ein hohlwangiger Bursche, dem die Vorderzähne fehlen. Er hat mit einem Griff gleich drei Glimmstängel geangelt. Fischer fragt ihn, weshalb die Kleinen sich so scheu benehmen. Der Palästinenser schiebt seine Zunge in die Zahnlücke und lacht.
„Sie halten dich für einen Zionisten“, erklärt er heiter. „Kerle mit so heller Haut machen ihnen Angst seit den Tagen voriges Jahr im Juni.“ Er wird ernst. Sein Blick sucht die Kinder, die nun vorsichtig aus ihren Schlupfwinkeln kommen. „Mancher von den Knirpsen hat in ein paar Stunden soviel Böses und Widerliches gesehen, wie es die meisten Erwachsenen in ihrem ganzen Leben nicht ertragen müssen.“
„Schlimm“, sagt Fischer ruhig. „Gehörst du zur ,Qibya?‘“
Die Männer schauen sich verdutzt an. In ihren Augen glimmt Misstrauen. „Was habt ihr damit zu tun?“, fragt ein anderer für den Hohlwangigen. „Schnüffler, wie?“
Die Haltung der Palästinenser verliert alle Zeichen von Freundlichkeit. Der Kreis um Fischer und Bertel Björkborg wird enger.
Der Deutsche lächelt.
„Ihr dürft eure Feinde nicht für blöd halten, Brüder“, sagt er. „Die Schnüffler schicken sie zu euch in Galabiyas, mit Kufiyas und Aqal auf dem Schädel, aber doch nicht in unserem Aufzug. Schaut uns doch an, Leute! Wir sehen doch aus wie zwei Fremdlinge, die gerade aus einer Christenkirche gestolpert kommen, aber nicht wie unauffällige Spitzel!“
Die Runde murmelt beifällig.
„Nee, ihr Ehrwürdigen, an uns sind nicht des Satans schwarze Zeichen!“ Fischer benutzt die Hände beim Reden. „Wir kommen aus Beirut. Ich bin dort Fremdenführer. Der Freund hier neben mir ist aus Europa herübergeflogen. Dänemark, wenn ihr das Wort schon mal aufgeschnappt habt. Er interessiert sich für Beduinen. Eine Art Schulmeister, glaube ich. Irgendwo hat er erfahren, dass die Zionisten den Wüstensöhnen im Negev arg mitgespielt haben. In einem Beiruter Kaffeehaus erzählte uns ein Mann aus dem Dorf Habakir, dass wir hier im Lager Sabakh einen Murwarkati finden könnten, der von hundert Gemeinheiten der Zionisten gegen seinen Stamm weiß. Solche Geschichten möchte unser Freund hören. Der Murwarkati soll ein Held sein, heißt es. Einer von der ,Qibya‘, der schon gekämpft hat. Da war von Minen die Rede und von einem Lastwagen, den sie in die Luft gejagt haben.“
„Eine ganze Kolonne!“, korrigiert der Hohlwangige. „Munitionstransport. Die Straße war wie ein roter Teppich vom Blut der Hundesöhne!“
Fischer übersetzt unbedacht jedes Wort.
Bertel Björkborg versteckt seine Fäuste in den Hosentaschen.
1977 erschien im VEB Hinstorff Verlag Rostock das Buch „Amerikaheinrichs Rückkehr“ von Erich Günther Sasse. Heinrich war in Amerika und wird von den Dorfbewohnern doch nicht als Globetrotter bewundert. Dieser Prahlhans schneidet so sehr auf, dass der Großvater – sein bester Freund – ihn vor die Tür setzt. Die dreizehn Erzählungen sind vorwiegend in einem Milieu angesiedelt, von dem der Autor sagt „Ich stamme vom Lande, und so ist mein Thema vorläufig das Land“. Sasses Erzählweise vermeidet Überflüssiges, beeindruckt durch psychologische Durchdringung, ist vor allem volkstümlich und lässt der Fantasie des Lesers Raum. So vermittelt seine Prosa Begegnungen mit Vergangenheit und Gegenwart, mit Alten und Jungen, mit Liebe und Zorn, ist heiter und ernst. Überzeugen Sie sich selbst:
Als er wieder mit der Kutsche bestellt wurde, zog er sich die Livree an. Sie passte nicht mehr in den Schultern, und über dem Bauch spannte sie. Ein Knopf riss ab, Heinrich nähte ihn allein an. Die schöne Livree, am Arm war ein großes Loch, die Motten waren drin gewesen.
Als die Alte Heinrich sah, lief sie laut schreiend in den Hühnerstall. Jesusmaria, jammerte sie.
Und Heinrich sagte, so oder so, jetzt werden wir zum Schluss kommen.
Natürlich sah jeder, was los war. Der Direktor war verhindert. Seine Frau stutzte einen Moment, dann drehte sie sich um und zischte, das wird Folgen haben. Heinrich rief hinter ihr her, da warte ich doch bloß drauf.
Heinrich brachte die Pferde in den Stall zurück und ging nach Hause. Die Alte war nicht da. Heinrich suchte nach ihr. Im Schlafzimmer fand er sie. Sie saß auf dem Bettrand und heulte Rotz und Wasser. Ich tu mir noch was an, schrie sie, das kann ich nicht mehr aushalten.
Schweigend zog Heinrich die Livree aus. Sie riss auch noch unter dem anderen Arm auf. Er hängte sie in den Schrank. Du brauchst dir nischt antun, sagte er, ich höre schon auf.
War es denn wirklich so schlimm, fragte er und kniete sich vor das Bett und nahm die runzligen Hände der Alten in seine Hände und erschrak, die ganzen vierzig Jahre mit mir? Er wischte der Alten die Tränen mit den Händen aus den Augen, und sie war schon wieder ganz vergnügt, als sie sagte, i wo, das sage ich nicht.
Sie zog ihn an seiner grauen Haarsträhne, die immer am Hinterkopf abstand, auch dann, wenn er sich nass kämmte. Und sie lächelte.
Du verstehst es immer noch, sagte Heinrich und gab ihr einen Kuss, einen ganz leisen, leichten.
Komm in die Küche, sagte die Alte, ich mache uns Eierkuchen mit Heidelbeeren.
Die aß Heinrich besonders gern. Was bist du nur für einer, sagte die Alte, dass du dich so um die Politik kümmern musst!
Solange wir uns aufregen, Alte, sagte Heinrich und stopfte einen Eierkuchen in sich rein, solange geht’s uns was an, solange leben wir. Und was gibt’s Schöneres, was, Alte, sagte Heinrich und streichelte die Alte an der Backe. Sie wurde rot und sagte, wie du redest, nein aber auch, na, hier zu Hause kannst du’s ja.
Ein paar Tage später wurde Heinrich ins Büro bestellt. Agronom Holze saß im Vorzimmer und sagte, das wird schlimm, Heinrich, aber ich denke da anders, das musst du mir glauben!
Is man gut, sagte Heinrich, das weiß ich ja, und ging eine Tür weiter.
Der Direktor saß hinter dem Schreibtisch, er räusperte sich und sagte, wir brauchen die Wohnung, so viel junge Leute wohnen nur in einem Zimmer. Er zählte ein paar Namen auf. Zwei Leutchen in einem Haus, das geht nicht, und so viel Einsicht kann man auch von Ihnen verlangen, sagte er.
Als der Direktor von gesellschaftlicher Notwendigkeit sprach, als er sagte, wir sitzen in jedem Fall am längeren Hebel, dachte Heinrich, dir grünem Bengel könnte ich jetzt eine knallen. Einsicht, von wegen Einsicht, du wohnst in sechs Zimmern, und das muss so sein. Heinrich dachte an die Alte. Er drehte sich halb rum und blinzelte den röhrenden Hirsch an, der da an der Wand noch vom Grafen Auerstein hing. Heinrich war schwer zumute, deshalb sagte er – es wurde ihm sauer genug -, sagen Sie man Ihrer Frau, ich hätte mich entschuldigt.
Zwischen den Zähnen presste er durch, jede Woche schreibt mir der Graf. Der hat sicher Besseres zu tun!
Der Direktor sah hoch. Wie, fragte er.
Ach, nur so, sagte Heinrich. Der Direktor wurde rot. Jede Woche, ich schreibe ihm, wie es den Pferden geht und meiner Alten, Heinrich hüstelte.
Dann ging er raus und wollte die Tür zuknallen, aber er sah die Alte vor sich, deshalb schloss er sie sehr leise, sie knackte kaum. Heinrich ging langsam nach Hause, ihm war elend genug zumute, er fühlte sich schwer. Wenn er an die Zukunft dachte, fror ihn, dabei war Sommer.
Die Alte hatte den Mittagstisch gedeckt und sprach kein Wort. Auf dem Tisch brannten Kerzen. Am helllichten Tag, sagte Heinrich, was soll denn das, ist hier Beerdigung? Ach, winkte die Alte ab und fing an zu heulen, die Mönchmann …
Heinrich schwieg. Er wusste auch nicht, was er sagen sollte. Das hat man davon, heulte die Alte, vierzig Jahre. Heinrich pustete die Kerzen aus und sagte, mach s gut. Er legte sich in der Stube auf das Sofa, und alles tat ihm leid, und er sich selbst am meisten.
Die beiden Araberstuten standen wochenlang im Stall. Keiner kümmerte sich um sie und Heinrich.
Er dachte, die werden mir noch steif, und spannte sie vor die Kutsche und fuhr im leichten Trab mit ihnen über die Feldwege, an den Weiden vorbei und durch den Wald. Nirgendwo hielt er an.
Die Vögel sangen, die Sonne schien. Heinrich ließ den Kopf hängen und guckte nicht nach rechts und nach links. Ihm war so schwer zumute. Ich hätte mich doch nicht entschuldigen sollen, dachte er immer wieder. Dann sah er wieder die Alte vor sich mit ihren paar dünnen grauen Haaren auf dem Kopf, ihren verarbeiteten Händen, und ihm war zum Heulen.
Und ich habe doch recht, sagte er ganz laut, nischt is anders geworden!
Heinrich fuhr zurück, brachte die Pferde in den Stall und ging nach Hause.
Am Abend kam Agronom Holze vorbei und sagte, ich bin anderer Meinung, das müsst ihr mir glauben.
Die Alte brachte Schnaps und goss ein, und ihre Finger zitterten dabei.
Sie trank auch mit. Heinrich sagte, is schon gut, Willi. Die Alte sagte dauernd prost. Sie soff wie ein trockenes Fass. Ich tu mir noch was an, sagte sie, solange wir verheiratet sind, wohnen wir in dem Haus.
Und nun – alles wegen solchem Quatsch. Heinrich fuhr sie an, was für dich Quatsch ist, muss es noch lange nicht für mich sein.
Heinrich brachte Holze zur Hoftür. Am Arsch soll er mich lecken, sagte er, ich ziehe hier nicht aus.
Sorgfältig verschloss er das Hoftor und zog den Schlüssel ab und sagte zur Alten, ich gehe morgen zu Tischler Grabe, der muss einen neuen Haustürschlüssel machen. Und du lässt mir niemanden ins Haus.
Ach, winkte die Alte ab. Ich ziehe hier nicht aus, sagte Heinrich, und wenn sie mit der Polizei kommen. Meinst du wirklich, lallte die Alte. Sie hielt die schon ziemlich leere Schnapsflasche in der Hand.
Wie du wieder redest, lallte die Alte, richtig schlau.
Nun singen wir, sagte sie und fing auch schon an: Am Brunnen vor dem Tore. Ihre Stimme war dünn. Sie nahm die Flasche zum Mund und trank den letzten Tropfen aus. Alles ist alle, kicherte sie.
Hör auf, sagte Heinrich. Ich fange erst an, lallte die Alte. Nun wollen wir tanzen. Tanz doch, sagte Heinrich. Schlau sein ist eins, lallte die Alte, aber Herz haben das andere. Donau so blau, so blau, sang sie und drehte sich, und auf einmal saß sie auf dem Teppich und schnarchte. Heinrich brachte sie ins Bett.
Heinrich fuhr jeden Tag mit der Kutsche aus, keiner kümmerte sich um ihn, wieder vergingen Wochen, in denen nichts geschah.
Der große Festtag kam heran, ein bedeutender Jahrestag. Aus diesem Anlass wurde der Doktor zum Professor ernannt.
Sogar in der Zeitung wurde darüber geschrieben. Die Alte las es Heinrich vor. Hör bloß auf damit, sagte er, nachts hat er gearbeitet, wenn andere Leute schlafen.
Die wichtige Entdeckung bringt großen Nutzen, las die Alte. Sogar in Japan interessiert man sich dafür.
So, sagte Heinrich, und wenn er zehnmal in Japan berühmt ist, hier habe ich doch recht.
Das Essay „Aufstand des Sisyphos. Dominikanische Tragödie“ von Wolfgang Schreyer erschien erstmals 1970 beim Deutschen Militärverlag Berlin. In moderner essayistischer Form behandelt Wolfgang Schreyer ein immer noch brennend aktuelles Thema: Revolution vor der Haustür der USA.
Schauen Sie doch mal rein:
Der Bürgerkrieg, durch die Interventen um vier Monate verlängert, hatte die nationale Wirtschaft schwer getroffen; im September lag die Arbeitslosenzahl bei 400 000. Als Juan Bosch am Monatsende aus dem Exil zurückkehrte, bezifferte er den Gesamtschaden auf 1,135 Milliarden Dollar – diesen Betrag müsse die künftige Regierung von den Interventionsmächten fordern, notfalls durch Klage beim Internationalen Gerichtshof.
In einem Gespräch mit einem Vertreter des britischen "National Guardian" gab Bosch unumwunden den USA alle Schuld am Unglück seines Landes: Ohne ihr Eingreifen hätten die Konstitutionalisten im April gesiegt. "Sogar Wessín gab zu, dass er nur über 200 Mann verfügte; seine Basis in San Isidro wäre gefallen, es war nur eine Frage von Stunden", sagte er. "Ich war damals in Puerto Rico und versuchte, meine Überfahrt nach hier zu bewerkstelligen. Aber der USA-Botschafter Martin weigerte sich, mir ein Flugzeug zu geben. ‚Die Kommunisten würden Sie umbringen‘, erklärte er."
Auf die Frage, was er selbst vom Kommunismus hielte, antwortete Bosch: "Welchen Kommunismus? Es gibt tausende Kommunismen – den Kommunismus des Monsignore Clarizio, den internationalen Kommunismus und den Kommunismus in Santo Domingo. 1963, als ich Präsident war, gab es hier zwischen 700 und 800 Kommunisten, die in drei Gruppen gespalten waren. Heute sind es 10 000 bis 12 000. Nur die USA können so viele Kommunisten in einer so kurzen Zeit produzieren… Lassen Sie mich aber klar sein: Ich bin kein Antikommunist, ich bin ein Nichtkommunist."
Boschs Äußerungen schilderten aus liberaler Sicht eine Entwicklung, die Quello und Conde als "beispiellosen Aufschwung des Massenkampfes" beschrieben. "Die Einheit des Volkes im Kampf für die ursprünglichen Ziele… bleibt erhalten", urteilten die beiden Kommunisten um dieselbe Zeit. "Man kann sagen, dass gerade diese Einheit und die höhere Bewusstheit der Massen die wichtigsten Errungenschaften der fünf Monate des bewaffneten Kampfes sind."
Obwohl der Aprilaufstand die dominikanische Linke überrascht und scheinbar an den Rand des Geschehens gedrängt hatte, da Caamaño dauernd den Vorwurf kommunistischer Beeinflussung zurückweisen musste, war sie über ihre anfängliche Nebenrolle hinausgewachsen. Sie hatte militärische Erfahrung gesammelt und gelernt, auseinanderstrebende Kräfte zu einen. Es war ihr gelungen, den städtischen Massen zu erklären, dass der Kampf unausweichlich war. Nun ging sie daran, die Landbevölkerung aufzuwecken. Der Aufstand hatte Opfer gefordert, aber auch den Schleier zerrissen, den die Oberschicht über ihre Aktionen zu breiten versteht.
Das war für die Oberschicht gefährlich. Ihr musste daran liegen, das alte Spiel hinter einem neuen Schleier fortzusetzen. Gardas Godoys Übergangsregime sollte dieser Schleier sein. Während die zivilen Kabinettsmitglieder Godoys nach demokratischen Lösungen suchten, behielten die Chefs der Waffengattungen ihre Befehlsgewalt; an Wessíns Stelle trat Cespédes. Im Kabinett waren die "Gorillas" durch Rivera Caminero vertreten, den Verteidigungsminister, der das Vertrauen des neuen US-Botschafters Ellsworth Bunker genoss. Gemeinsam mit den Interventen – noch 12 000 OAS-Soldaten standen auf der Insel – gingen sie daran, das Volk durch Terror einzuschüchtern.
Schon bei Boschs Ankunft am 25. September 1965 gab es auf halbem Weg zwischen Flugplatz und Innenstadt einen Feuerüberfall, der 16 Menschenleben kostete. Statt die Attentäter zu suchen, behinderte die Polizei Boschs Kundgebung; dennoch nahmen 45 000 Menschen daran teil. Am 18. Oktober drang ein Bataillon der dominikanischen 4. Armeebrigade in das ehemalige Rebellenviertel ein und besetzte unter Bruch der Aussöhnungsakte die Ozama-Festung, wo auch ein US-Hubschrauber landete; das löste Warnstreiks und bewaffnete Zusammenstöße aus.
Daraufhin besetzten amerikanische Truppen die Räume der linksgerichteten Zeitung "Patria" und des Regierungsorgans "La Nación"; nur das Rechtsblatt "La Hoja" erschien weiter. Imberts Anhänger stürmten ein Ministerium, US-Soldaten verhafteten zahlreiche Demonstranten, die sich im früheren Hauptquartier Caamaños versammelt hatten.
Nun riss der Terror nicht mehr ab. Am 1. November eröffnete dominikanische Polizei das Feuer auf 300 Zuckerarbeiter. Am 2. November zersprengten US-Fallschirmjäger Demonstrationszüge in der Provinz – wie die Marineinfanterie anno 1915. Am 3. November entkam Oberst Montes Arahe, ein Vertrauter Caamaños, nur knapp einem Mordanschlag; sein Wagen wies 46 Einschüsse auf. Am 4. November wurde ein anderer Caamaño-Freund, Major Luis Arias, ermordet; man fand die zerstochene Leiche nahe der Hauptstadt am Strand… Kaum eine Nacht verging mehr ohne Überfall.
"Das sind Verbrechen, die man als politischen Terror bezeichnen kann", sagte Héctor Aristy dazu in einem Interview mit der "l’Humanité". "Die Mörder befestigen einen ‚konstitutionalistischen‘ Zettel an der Leiche…, sie benutzen die psychologischen Schreckenstechniken der Nazis. Es sind zwar im Kampf Rückzüge möglich, aber niemals wird unser Volk kapitulieren. Die Bewegung erreicht jetzt auch die Landgebiete. Bauerndelegationen kommen aus dem Landesinneren und wollen sich mit uns am Kampf beteiligen." Aristy, noch immer Caamaños Sekretär, fügte hinzu: "Die Kraft der Armee und die Schwäche der Regierung führen dazu, dass die Regierung keine Autorität über die Armee hat. Unser einziger Trumpf ist also unsere Fähigkeit, uns selbst zu verteidigen."
Das Buch „Die Räuber mit den großen Koffern“ von Günter Saalmann erschien 1994 in Der KinderbuchVerlag. Jana versteht gar nichts. Die fremde Stimme auf dem Anrufbeantworter krächzt und stammelt nur ein paar Worte. Doch irgendwie hört es sich wie eine Drohung an. Aber Jana ist kein Angsthase. Und Tim, ihr bester Freund, ist als Sohn eines Hauptkommissars fast ein Profi. Doch dann kommen sie, nachts, die Räuber mit den großen Koffern:
Unter schweren Schritten knarrt die Haustreppe.
„Kindesräuber!“, flüstert es in Janas Rücken.
Sie fährt herum. In die Mauerecke gepresst, hockt auf dem abgestellten Rasenmäher ihr Freund Tim, die Knie bis unters Kinn gezogen.
Er ist ihr unbemerkt gefolgt.
Auch ihn hat wohl der Lichtschein aus dem Wohnzimmer überrascht. Kurz vor ihr muss er hier unten angelangt sein. Jetzt hat ihn die Angst gepackt. Vor sich hält er irgendetwas Dunkles, Spitzes: eins von seinen Messern, was sonst. Die übrigen klappern in seiner Tasche.
„O Gott, Kindesräuber“, wimmert er im Flüsterton.
„Hast du eins eins null angerufen?“, fragt Jana und zieht dabei die Luft durch die Zähne.
„Nein, ich wollte …“
„Du wolltest, du wolltest, du Nachtjacke! Jetzt sitzen wir alle drei in der Falle! Dass das Kindesräuber sind, weiß ich selber …“
Bis in den Hals hinauf schlägt Janas Herz. Oh, wie wütend ist sie, dass ihrem >Hauptkommissar < das Herz offensichtlich in die Hose gerutscht ist. „Ob in die Koffer ganze Kinder reinpassen?“, jammert er.
„Immer noch besser als halbe“, zischt sie zurück.
Janas Wut wächst zum Riesenzorn. Noch ist es nicht so weit, ihr Herren Gangster! Wehren wird sie sich, den Fluchtweg freikämpfen!
Robby gibt wütende Knurrlaute von sich, er strampelt, macht sich steif, will raus aus ihrer Umklammerung.
Sie faucht Tim an: „Her mit dem Messer!“
„Die haben bestimmt Pistolen!“, raunt Tim.
In der dunklen Ecke unter der Treppe gibt es ein stummes Handgemenge um das Messer. Dabei muss Jana den Mund des Brüderchens freigeben. Das erwartete Geschrei bleibt aus.
Robby öffnet den Rachen weit wie ein Löwe und japst und schnappt nach Luft. Die Schritte aus dem Obergeschoss kommen zurück in die Diele. „Im Kinderzimmer sind sie nicht! Im Elternschlafzimmer auch nicht!“
Die hellere Stimme ist ungeniert laut, sie verschwindet hinter der Toilettentür.
Der andere Gangster hat inzwischen die Küche inspiziert und hält sich jetzt wieder im Wohnzimmer auf.
Jana erkennt das alles am vertrauten Knarren der verschiedenen Türen.
„Mir nach!“, flüstert sie entschlossen. Sie wird ein zweites Mal versuchen, die Haustür zu erreichen. Ist sie erst draußen, kann sie laufen, laufen, bis zur Chaussee, ein Auto stoppen, um Hilfe bitten.
„Los doch, hab’ ich gesagt!“
Das Buch „Nahe der Grenze“ von Erik Neutsch erschien erstmals 1987 bei Mitteldeutscher Verlag, Halle (Saale). Nahe der Grenze zur CSSR, in den Wäldern des Erzgebirges, begegnen wir Achim Steinhauer wieder, dessen Lebensweg eine überraschende Wende genommen hat: Vom Drang nach Selbstbehauptung erfüllte Jahre als Gleisbauer, Fernfahrer und Mitarbeiter einer Vogelwarte liegen hinter ihm seit jenem Abschied aus Eisenstadt. In dieser Zeit hat er zu schreiben begonnen, eine Erzählung wird publiziert, die er mit Soldaten und Offizieren in einem Feldlager der NVA nach den Ereignissen vom August 1968 diskutiert.
Doch in diesen Tagen erfuhren er und Ulrike auch von Ilse Lutters plötzlichem Tod. Was ist geschehen?
Ins Zentrum dieses Romans von Erik Neutsch rückt die Geschichte um Frank Lutters Ehe. Er hat promoviert und befindet sich im Aufstieg. Bohrend sind die Fragen, wieweit ihm dabei seine Frau und Lina Bonk, die Journalistin, zu helfen vermögen, und – hat die Freundschaft zwischen ihm und Achim Steinhauer noch eine Chance?
Nahe der Grenze – der Titel des Buches wird zum Bild für die inneren und äußeren Vorgänge, die der Leser miterlebt. Hier ein Ausschnitt aus dem E-Book, das auf den Wunsch des Autors nicht auf Neue Rechtschreibung umgestellt wurde:
Nein, die Schritte der Mutter waren es nicht. Der Vater befand sich ohnehin wieder auf Reisen. Vielleicht weilte er wirklich in Berlin, vielleicht auch nur dort, wo er nach seiner Geographie Berlin angesiedelt hatte. Aber was störte es ihn noch! Ihm, Robert, war es gleich, schnurzpiepe, wo sein Alter die Nächte verbrachte. Lina Bonk, nach dieser Enttäuschung, war nicht mehr sein Typ. Ihr Bild war ihm während seiner Abwesenheit entwendet worden. Aber selbst, wenn er es noch besessen hätte, er hätte es zerrissen und seine Fetzen durchs Klobecken gespült. Dort gehörten sie beide hin, sie und sein Vater …
Clara … Es konnte nur Clara sein, die so spät umhergeisterte. Eine dumpfe Ahnung befiel ihn, und er mußte ihr nachgehen. Was hatte denn sie noch, um diese Zeit, im Wohnzimmer zu suchen?
Einige Male, obwohl zögernd, mit verhaltenen Worten, ihrer Sache nicht sicher, hatte sich in den letzten Wochen die Mutter darüber beklagt, daß ihr im Portemonnaie Geld fehle, und stets dabei ihn mit mißtrauischen, fast strafenden Augen angesehen. Nachdem jedoch seine Schwester in der Kaufhalle die Schokolade gestohlen hatte, waren ihre Blicke – und diesmal trauriger denn je, wie ihm schien – vom einen zum anderen gewandert. Er vermutete, daß es sich nur um Pfennigbeträge handelte, dieses oder jenes Markstück, aber er, das konnte er beschwören, mußte er wohl von sich selber hundertprozentig wissen, war in dieser Beziehung sauber.
Er kroch aus dem Bett, schlich sich durch den Korridor. Wenn das zuträfe, was er glaubte, sein detektivischer Spürsinn nicht trog und er sie auf frischer Tat überraschte … Er könnte sich ein für allemal reinwaschen.
Und so geschah es.
Als er die Tür aufriß, sah er Clara über die Couch gebeugt, halb auf den Knien, im Nachthemd. Nur das Licht der Stehlampe in der Sesselecke funzelte. Dennoch war alles klar zu erkennen. Mit beiden Händen wühlte sie soeben in der Umhängetasche, in der die Mutter Papiere des täglichen Bedarfs aufbewahrte, ihren Personalausweis, Straßenbahnfahrkarten, ein Schlüsselbund, auch sonst eine Menge Krimskrams und – ihr Portemonnaie aus rotem Rindsleder.
„Ich hab dich erwischt“, schrie er. „Du gemeines Biest, du Diebin!“
O, jetzt konnte er wieder einmal Gerechtigkeit üben. Er stürzte auf sie zu und versetzte ihr links und rechts Ohrfeigen.
Sie heulte, stotterte irgend etwas vor sich hin, wimmerte, bat ihn, halb erstickt unter Tränen, sie nicht zu verraten. Sie erschien ihm in diesem Zustand noch häßlicher als sonst. Er schlug ihr nochmals ins sommersprossige Gesicht und vernahm nur die Worte: „Bitte, bitte, wecke sie nicht. Sie will ihre Ruhe haben. Wir sollen sie nicht stören …“
„Das könnte dir so passen …“
Nein, diesen Gefallen würde er seiner Schwester niemals tun. Denn was für eine einmalige Gelegenheit bot sich ihm da, der Mutter zu beweisen, daß nicht er der ständige Sündenbock sei, sondern dieses ihm stets vorgezogene, mit Lobsprüchen noch bis vor kurzem überhäufte Töchterchen.
Er klopfte an die Tür des Schlafzimmers.
„Mama! Mama!“
Nichts aber rührte sich.
„Mama! Wach auf! Mir tut es leid, aber ich muß dich stören …“
Er erhielt keine Antwort.
Das Schlafzimmer, so hatten es die Eltern bestimmt, war ein Bereich, den sowohl er als auch Clara nur mit ihrer Erlaubnis betreten durften. Nicht selten kam es auch vor, besonders in letzter Zeit, daß sich die Mutter, sobald sie sich unwohl fühlte, darin einschloß.
Robert zögerte einen Moment. Dann aber drückte er die Klinke nieder, sie gab nach. Endlich sollte die Mutter die Wahrheit erfahren, wissen, wer sie bestahl.
Er schaltete das Licht an.
Da sah er sie liegen. Auf ihrer Seite in den Ehebetten. So ungemein friedlich, wie es schien. Bis ans Kinn gezogen die Decke. Mit geschlossenen Augen. Doch verfallen, zusammengeschrumpft der Mund, ein wenig zwar geöffnet, aber mit ganz schmalen Lippen.
Er trat näher. Er vernahm keinen Atemzug an ihr.
Bleiern senkte sich etwas in ihn hinab. Yesterday, I Want to Hold Your Hand … Es dröhnte in seinem Kopf. Jetzt sah er es deutlicher: Der Anblick seiner Mutter war so unnatürlich, daß es ihm ein Frösteln einjagte und seine Gedanken sich verwirrten.
Von einer unbestimmten Furcht gepackt, wagte er dennoch, sie anzurühren. Er versuchte, sie wachzurütteln, nur zaghaft, ängstlich.
Unter der Bettdecke glitt ein Arm hervor. Die Hand mit dem Ehering. Schlaff hing sie herunter.
Auf dem Nachtschrank stand ein Glas mit Wasser, in dem ihre Zahnprothese schwamm.
Daneben lag ein Blatt Papier, willkürlich mit Druckbuchstaben aus Schlagzeilen von Zeitungen beklebt: SeHR geEhrTe FraU LuTteR …
Er kannte den Text. Er war sein Werk, und er riß den Zettel an sich. Der Brief hatte sie doch nur warnen sollen, und niemals hatte er daran gedacht, daß sie sich deswegen …
Wie im Traum, benommen vor Schreck, gewahrte er noch auf dem Bettvorleger ein zweites Glas. Es lag dort umgekippt und leer.
Er rannte zurück in den Korridor. „Clara! Clara … Die Mama!“
Seine Schwester hockte nach wie vor winselnd in irgendeiner Ecke.
Ihn aber erfüllte nur noch Entsetzen, und nichts von alledem, was er jetzt tat, drang in sein Bewußtsein. Zwar begriff er, die Mutter war tot, doch er wollte sie immer noch retten, die Mutter, mit ihrer … Trotz allem … Mit ihrer großen Liebe zu ihm, ohne die er verloren sein würde …
Er lief ins Treppenhaus, klingelte bei den Nachbarn, hielt den Finger auf dem Knopf, bis ihm aufgetan wurde.
„Tante Gisela! Tante Gisela! Ich glaube … Es ist …“ Er würgte an jedem Wort.
Kommen wir zum Schluss der heutigen Post aus Pinnow noch einmal auf die eingangs gestellte Frage nach den Unterschieden von Erzählungen vom Lande und aus der Stadt zurück. Dahinter steckt auch die Frage nach den Unterschieden der Menschen auf dem Lande und in der Stadt. Lange Zeit war auch hierzulande von einer Stadtflucht die Rede, inzwischen hört man aber auch wieder öfter von Landflucht. Wie lebt es sich im ländlichen Raum? Ist der ländliche Raum tatsächlich ein Vorort des Paradieses? Schließlich kommt noch die Frage hinzu, was für Menschen denn inzwischen auf dem Lande leben. Es sind keineswegs alles „Ureinwohner“, allerdings auch nicht wenige Rückkehrer und wie schon erwähnt immer noch eine Menge Stadtflüchter. Wie gehen sie miteinander um? Bleiben die jeweiligen Milieus unter sich? Oder mischt sich das auch? Und sagen eigentlich Großväter heute noch solche Sätze wie „Ich will man meine Karnickel füttern“, wenn sie sich geärgert haben?
Stoff genug jedenfalls für Autorinnen und Autoren, neue Geschichten vom Lande zu schreiben. Spannend werden dürften sie allemal.
Viel Vergnügen beim Lesen in der Stadt und auf dem Lande, weiter einen schönen Sommer, bleiben auch Sie weiter vor allem schön gesund und munter und bis demnächst. Und falls Sie selbst auf dem Lande leben, vielleicht schreiben Sie ja selbst mal ein paar Geschichten auf …
EDITION digital war vor 28 Jahren ursprünglich als Verlag für elektronische Publikationen gegründet worden. Inzwischen gibt der Verlag Krimis, historische Romane, Fantasy, Zeitzeugenberichte und Sachbücher (NVA-, DDR-Geschichte) sowie Kinderbücher gedruckt und als E-Book heraus. Ein weiterer Schwerpunkt sind Grafiken und Beschreibungen von historischen Handwerks- und Berufszeichen sowie Belletristik und Sachbücher über Mecklenburg-Vorpommern. Bücher ehemaliger DDR-Autoren werden als E-Book neu aufgelegt. Insgesamt umfasst das Verlagsangebot, das unter www.edition-digital.de nachzulesen ist, mehr als 1.300 Titel. E-Books sind barrierefrei und Bücher werden klimaneutral gedruckt.
EDITION digital Pekrul & Sohn GbR
Alte Dorfstraße 2 b
19065 Pinnow
Telefon: +49 (3860) 505788
Telefax: +49 (3860) 505789
http://www.edition-digital.de
Verlagsleiterin
Telefon: +49 (3860) 505788
Fax: +49 (3860) 505789
E-Mail: editiondigital@arcor.de
![]()