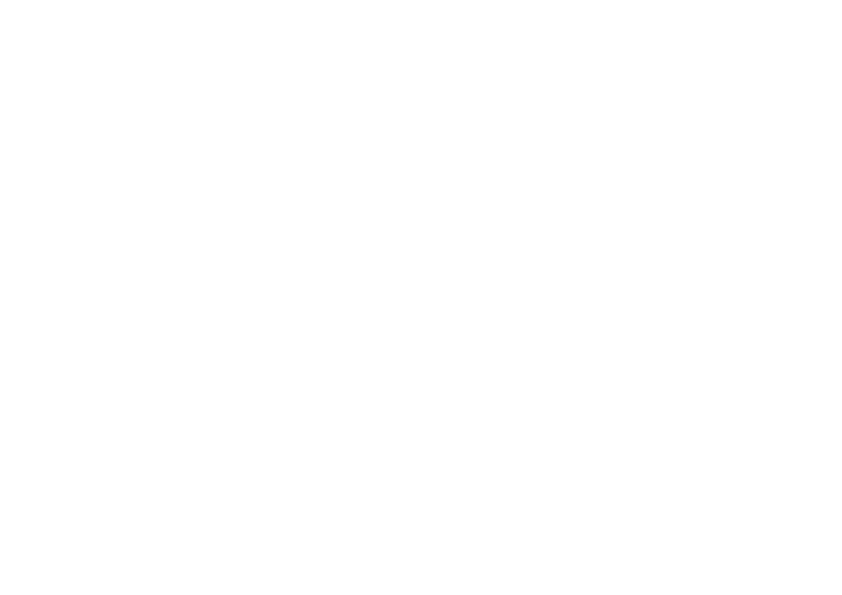Einen Blick zurück in die DDR der 1970er Jahre erlaubt Hans-Ulrich Lüdemann in „Patenjäger“.
Eine leidenschaftliche Schauspielerin steht im Mittelpunkt des Romans „Die Axt der Amazonen. Eine Penthesilea-Modifikation in Prosa“ von Wolfgang Licht.
Wie viele Menschen kann man eigentlich lieben? Auch das ist eine Frage, die Christa Grasmeyer in „Aufforderung zum Tanz“ stellt.
Und damit sind wir wieder beim aktuellen Beitrag der Rubrik Fridays for Future angelangt. Jede Woche wird an dieser Stelle jeweils ein Buch vorgestellt, das im weitesten Sinne mit den Themen Klima, Umwelt und Frieden zu tun hat – also mit den ganz großen Themen der Erde und dieser Zeit. Wieder einmal geht es um den Zweiten Weltkrieg, um seine Schrecken und seine Folgen für die einzelnen Menschen – dargestellt am Schicksal einer Frau, die zwar mit ihrer kleinen Tochter überlebt, Schutz und Unterkunft findet, aber dennoch den Halt im Leben verliert. Auch das ist eine Folge dieses furchtbaren Krieges:
Erstmals 1986 erschien im damaligen VEB Hinstorff Verlag Rostock der Roman „Abgefunden oder Das Siegel“ von Erich-Günther Sasse: Nach verzweifeltem Umherirren und strapazenreicher Flucht gelangt die im Krieg verwitwete, schließlich besitz- und rechtlos gewordene Gräfin Eva von Kutschberg-Hohenau mit ihrer vierjährigen Tochter Astrid im Herbst 1946 auf ein Dorf nahe Magdeburg. Die völlig verängstigte und fast zum Tier herabgekommene junge Frau findet Unterschlupf bei der alten Reimann, Besitzerin eines respektablen Bauernhofes, die sie aus Mitleid, vor allem aber wegen der überraschenden Ähnlichkeit zur eigenen sterbenskranken Tochter aufnimmt. Unter dem Namen Eva Krüger, als Frau ohne Herkunft und Geschichte, findet sich die einstige Gräfin allmählich in den neuen Lebensumständen zurecht. Bald entwickelt sich eine lebenshungrige Liebesbeziehung zwischen ihr und Meyer, dem Ehemann der Todkranken und zukünftigen Erben des Bauernhofes. Durch Heirat mit dem schließlich verwitweten Meyer etabliert sich Eva wieder als Herrin, kann sich aber mit den heraufziehenden historischen Umbrüchen auf dem Lande nicht mehr abfinden.
Während Astrid, Vertreterin einer neuen Generation, den Weg zur Kunst findet und wie selbstverständlich in die neue Zeit hineinwächst, flüchtet Eva erneut – in Zurückgezogenheit und eine Art innerer Emigration. Hier der ziemlich düstere Anfang dieses Romans:
„1. Kapitel
Auf dass Du daran gedenkest, und Dich schämest, und vor Schande nicht mehr Deinen Mund aufthun dürfest; wenn ich Dir alles vergeben werde, was Du gethan hast …
Hesekiel 16,63
Es war noch nicht Mittag an diesem Tag im Spätherbst, als die Männer auf dem abgeernteten Rübenfeld standen und über die schlimmen Zeiten redeten, aber auch darüber, dass es nun wohl doch weitergehen werde.
Hoffentlich, sagte der ältere, ein bisschen schwerfällige, und biss von seiner Klappstulle ab, während der jüngere mit der Stiefelspitze Löcher in die Erde bohrte und dem braunen Pferd die Blesse auf der Stirn streichelte.
An diesem Herbsttag, der hell und kalt war, lag die Welt still und verlassen. Die Männer hatten so viel erlebt, dass sie nichts mehr aus der Fassung bringen konnte. Der Krieg war schon anderthalb Jahre vorbei. Gefühle, die verschüttet waren und für immer verschwunden schienen, brachen hervor.
Die Männer schwiegen. Das Pferd kaute trockene Grashalme und kratzte manchmal mit seinem Huf die Erde.
Der jüngere Mann blickte dorthin, wo Himmel und Erde zusammenstießen. Er sah nur einen schwarzen Punkt, der seine Aufmerksamkeit fesselte, als er größer wurde. Auf einmal waren es zwei Punkte. Der jüngere Mann entdeckte, dass eine Frau und ein Kind etwas hinter sich herschleppten, das wie ein Handwagen aussah. Bevor er etwas sagen konnte, sagte der ältere: Ach du lieber Gott, noch welche, die unterwegs sind, wird Zeit, dass sie unterkommen!
Er faltete das Brotpapier zusammen und steckte es in die Joppentasche. Dann zog er dem Pferd das Geschirr zurecht und legte ihm die Leine über den Hals. Er blieb stehen und sah auf die Frau, die sich langsam näher schleppte. Sie schien uralt zu sein, ihre Bewegungen waren müde und kraftlos, das Gesicht wirkte unnatürlich blass und starr. Sie hielt den Kopf gesenkt. Als sie die Männer entdeckte, zuckte sie zusammen und wollte weglaufen. Die Frau trug ein Lumpenkleid, das aus Säcken zusammengenäht war. Sie hatte nackte Beine, die Füße steckten in halbhohen Lederschuhen. Die Männer hörten ihre Stimme, die ängstlich war, zugleich aber voller Härte, leise fragen: Kann ich vielleicht hier irgendwo unterkommen? Mit einem Ruck drehte die Frau sich um, als fürchte sie, verfolgt zu werden. Dann blickte sie die Männer an, ihre Augen waren groß und kalt.
Der jüngere Mann musterte die Frau, wie sie dastand, die Lumpen, die groben schmutzigen Schuhe, er sah, dass die Frau sehr jung war, und etwas erschütterte ihn, dass er dachte: Großer Gott, wie viel muss die durchgemacht haben, um so runterzukommen. Etwas zwang ihn, seine Hand auszustrecken und dem Kind, das ihn mit neugierigen, furchtlosen Augen anstarrte, über den Kopf zu streichen. Als die Frau das merkte, knurrte sie böse und zog die Oberlippe hoch. Es schien, als fletschte sie die Zähne. Plötzlich riss sie das Kind an sich und presste es gegen ihren Leib. In ihren Augen war ein Ausdruck, dass der jüngere Mann zurückwich: Aber ich wollte doch nur …
Der ältere Mann wartete.
Die Frau beugte sich über das Kind, in ihren Augen war dieses Flackern, Furcht und Drohung zugleich.
Dem jüngeren schien es, als ähnelte dieses armselige, heruntergekommene Wesen einer anderen, die in ihrem verdunkelten Zimmer lag und nicht mehr wusste, wer sie war, dass sie ein Kind gehabt hatte und schon überhaupt nicht, dass sie bald sterben würde.
Nein, sagte der ältere abweisend, wir haben auch kein Unterkommen. Was denken Sie, wie viele schon hier waren! Er bückte sich und befestigte das Pferd mit Ketten am Pflug.
Bitte, sagte die Frau leise und senkte den Kopf. Sie wusste nicht, was es war, das sie ausgerechnet jetzt bitten ließ. So oft auf ihrem langen Weg hatte sie fremde Menschen angefleht, dass sie es nur noch mit größter Anstrengung tun konnte.
Weil hier etwas anders zu sein schien, wiederholte sie: Bitte, wir wissen nicht, wo wir bleiben sollen!
Der jüngere Mann spürte den Gestank, der von ihr ausging. Er trat ein paar Schritte zurück, sah wieder die Lumpen und die groben Schuhe an den schmutzigen Beinen, er sah aber auch das Kind, das ihn aufmerksam und überhaupt nicht ängstlich anblickte. Da fühlte er eine Scham, deren Ursprung ihm rätselhaft war. Ihm war, als wäre er verantwortlich für das, was aus der Frau und dem Kind würde. Er erschrak.
Der ältere Mann legte sich die Leine über den Rücken und klatschte sie dem Pferd auf die Kruppe. Er schnalzte mit der Zunge. Das Pferd zog an, und der Mann drückte mit seinem ganzen Gewicht auf den Pflug. Hü! rief er. Die Rufe wurden schnell leiser und waren bald überhaupt nicht mehr zu hören.
Nein, sagte der jüngere Mann und starrte auf die braune Erde, wo Rübenblätter herumlagen, ein Unterkommen haben wir wohl nicht, aber vielleicht könnten Sie mit uns essen!
Essen, die Frau warf mit einem Ruck den Kopf nach hinten, essen, stieß sie hervor, und dann?“ Und damit zu den ausführlicheren Vorstellungen der anderen vier Sonderangebote dieses Newsletters:
Erstmals 2009 veröffentlichte Carlos Rasch im Projekte-Verlag Cornelius „Zurück zum Erdenball. Raumlotsen Band 1“: In dem auf vier Bände angelegten Werk zeichnet Carlos Rasch in episodenhaften Abenteuergeschichten eine nicht zu ferne Zukunft: den Raumfahreralltag im Sonnensystem, Bedrohungen aus der Tiefe des Alls, die Dinge, welche unsere Nachkommen bewegen könnten. Die Geschichten sind größtenteils unveröffentlicht, neun von ihnen wurden für die Reihe überarbeitet.
Während die Science Fiction die Leser meist von der Erde weg in den Kosmos entführt, geht dieser Buchband in sechs Geschichten über RAUMLOTSEN den umgekehrten Weg: Sie erzählen mit „Und ringsum nur die Sterne“ von der Erkundung des Trümmergürtels zwischen Mars und Jupiter, in „Vandalus“ von treuer Kameradschaft bei einer Mission am Rande des Sonnensystems, und in „Diamanten von Pupurgrazia“ über die Beschaffung seltener Rohstoffe mit Hilfe von Mutanten. In den drei Geschichten „Verlobung im Orbit“, „Raumschlepper HERKULES“ und „Absturz beim Prüfungsflug“ treten die menschlichen Probleme erdnaher Raumfahrt in den Vordergrund.
Die Hauptakteure sind ein Dreigestirn: Der legendäre Altraumfahrer Ben, die Raumfahrtpsychologin Cora und der Kadett der Raumflotte Jan. Hier der Beginn der ersten der sechs utopischen Geschichten:
„Und ringsum nur die Sterne
Wenn Abendrot Sternenschein entflammt
über den dunklen Hügeln der Erde,
beugt, sonderbar umspielt vom Licht,
unter aufquellender Träne sich,
zur Erde der Astronaut
und küsst zum Abschied sie.
Tagebuch der Astronautin Cora
Vorstoß zum Trümmergürtel
Die gesamte Besatzung hatte sich in der Kommandozentrale des Raumschiffes versammelt. Auf den Gesichtern lag ein Ausdruck gespannter Erwartung, denn der erste Höhepunkt ihrer Mission stand bevor: Das Eintreffen im Operationsgebiet der Asteroidenjäger! Als letzter betrat Kommandant Axel Kerulen, ein kräftiger, mittelgroßer Mann, den Raum. Gewohnheitsmäßig warf er einen prüfenden Blick auf die Kontrollinstrumente am automatischen Astro-Piloten, Pilotron genannt. Der Flug verlief planmäßig. Auch die Radarkonsole zeigte keine beunruhigenden Tänzchen mit Kurven und wechselnden Diagrammen. „Unser Raumschiff hat seine Einsatzposition erreicht“, sagte er zu Norbert Franken an der Funkkonsole. „Sende unser Rufzeichen und stelle Kontakt zur Leitrakete her.“
Norbert richtete sich in seinem Konturensessel auf. Seine Finger huschten über die Tastatur, um die gewünschte Verbindung herzustellen. Er wusste, dass außen am Raumschiff nun eine Antenne ausgefahren wurde. Sie kreiste langsam und suchte ihr Ziel: Die Leitrakete AJ-401, die, für menschliche Maßstäbe unendlich weit weg, fern in eiskalten, schweigenden Abgründen des dunklen Universums hing. Aus dem Kreis der wartenden Besatzung hatten sich inzwischen auch der Ingenieur für die Düsenaggregate und der Navigator gelöst, um ihre Plätze am Triebwerkspult und am Navigationsschirm einzunehmen. Die leisen Gespräche verstummten. Stille breitete sich in der Kommandozentrale aus. Auf dem Monitor interpretierte die Elektronik den Kontakt. Ein heller Punkt wanderte vom Rand zur Bildmitte. Dann verdeutlichte die Apparatur den Punkt zu einem Raumschiffsymbol mit den Buchstaben AJ-401. Eine Stimme wurde hörbar, schwach, aber bald deutlicher. Auf dem Monitor ordneten sich die Farben zu einem Gesicht.
„Hier Leitrakete der vierten kosmischen Flottille!“, sagte der Mann. Er schmunzelte. „Ich dachte, ihr Narren von der Wimmelwelt Erde habt es verschlafen, euch in unsere Suchgruppe einzugliedern. Erwartet haben wir euch bereits vor 72 Stunden.“
Axel Kerulen ignorierte diese ironische Kritik, denn es handelte sich bei einer Reise von der Erde zum Mars und über dessen Bahn hinaus nicht um den Linienflug einer Mondfähre, die nach Fahrplan flog. Es war ein gefährlicher Bereich des Alls, in dem man sich befand, wo oft wegen Meteoritenschwärmen zeitraubende Abweichungen vom Kurs in Kauf genommen werden mussten. Er hielt sich an seine Rolle als Kommandant und fragte in offiziellem Tonfall: „Hier AJ-408. Ich möchte dem Kommodore unser Eintreffen im Operationsgebiet mitteilen und den Statusbericht geben.“
„Steht neben mir. Ich übergebe.“
Das Gesicht auf dem Monitor wechselte zu einem Mann mit eisgrauem, kurzem Haar. Schweigsam musterte der die Frauen und Männer hinter und neben Axel Kerulen. Der meldete ihm: „Alle wohlauf und gut trainiert. Schiff einsatzbereit. Technisch keine Probleme. Funkwarnfeuer für Asteroiden und Ausrüstungen zur Vernichtung von Meteoriten an Bord, Kommodore.“
„Wieso Schiff? Das Wort Raumkreuzer scheint neuerdings verpönt zu sein. Wessen Idee war denn auf der Erde die Umbenennung unseres Verbandes von Raumkreuzern zu Asteroidenjägern?“, fragte der Befehlshaber. „Sicherlich irgendwelche Klugschnäbel, die das den Leuten vom Kosmischen Rat eingeredet haben.“
„Taktische Sprachregelung zur Kostenbegründung, Kommodore. Raumkreuzer heißen jetzt nur noch jene Raumschiffe, welche die Solarkraftwerke in der Erdumlaufbahn vor Meteoriten schützen.“
„Aha. Reden wir später noch mal über dieses Thema. Zurück zu den Dienstvorschriften.“
„Wir sind Ihrem Kommando für 19 Monate unterstellt. Nahrung und Energie für die Triebwerke sind, wie vorgeschrieben, in dreifacher Menge gebunkert. Unsere Geschwindigkeit beträgt, auf die Sonne bezogen, derzeit 45 Kilometer pro Sekunde. Anschließend übermittle ich Ihnen unsere Besatzungsliste. Sie werden auf ihr bewährte Leute finden, die bereits mehrmals im All eingesetzt waren.“
Der Kommandant machte eine kurze Pause. Er drehte sich nach seinen Leuten um und nickte ihnen aufmunternd zu, bevor er wieder den Kommodore auf dem Bildschirm ansah. „Vier meiner Frauen und Männer möchte ich Ihnen aber gleich vorstellen, nämlich unsere Neulinge, die zum ersten Mal in ihrem Leben Irdien verlassen haben. Es sind dies die Chemikerin Filitra Goma aus dem südamerikanischen Kulturbereich, der Informatiker Rai Raipur aus dem indischen Kulturbereich, der Japaner Kioto Yokohata aus dem fernöstlichen Kulturbereich, Pilot unseres Kolibri-Shuttles, und der Mathematiker Oulu Nikeria aus dem zentralafrikanischen Kulturkreis. Diese jungen Raumfahrer sehen mit Ungeduld ihrem Einsatz im Trümmergürtel entgegen. Jüngster Aspekt unserer Mission hier auf Mars-Vorposten ist es auch noch, das Herannahen der Strahlungsfront des Crabnebels – nach den Asteroiden die zweitgrößte Gefahr für die Menschheit – zu messen. Diese neue Order dazu für den ganzen Suchverband habe ich, gesiegelt, mitgebracht. Ich hoffe, wir haben bald mal eine Annäherung auf kurze Distanz, damit ich Ihnen, Kommodore, dieses Siegel persönlich übergeben kann.“
Die vier Genannten waren vorgetreten. Die Nennung der beiden Hauptgefahren für die Menschheit bewirkte, dass sie sich alle in ihrer Haltung unwillkürlich strafften, denn ihnen war bewusst, dass man auch anderswo im solaren Raum, etwa durch den Bau eines Observatoriums auf Merkur zur Direktbeobachtung der Sonne, heldenhafte Anstrengungen unternahm, um Vorbereitungen zum Eintreffen jener gefährlichen Front harter kosmischer Strahlung als Folge einer Supernova zu treffen, deren Ausbruch vor rund tausend Jahren in China am Himmel beobachtet worden war.“ Und damit zu den ausführlicheren Vorstellungen der anderen vier Sonderangebote dieses Newsletters:
Erstmals 1975 erschien im Kinderbuchverlag Berlin „Patenjäger“ von Hans-Ulrich Lüdemann, wozu der Autor selbst Folgendes anmerkt: habent sua fata libelli sagen Lateiner. Zu Deutsch heißt es nichts anderes, als dass Bücher ihre Schicksale haben. Auf den Patenjäger (1. Auflage 1975) bezogen passt das wie die berüchtigte Faust aufs Auge. Ich erinnere mich noch genau: Zu Beginn der Siebziger starteten SED und FDJ eine ideologische Offensive in der Art, dass sozusagen ein Staffelstab von den alten Genossen über die mittlere Generation hin zur Jugendorganisation und den Thälmann-Pionieren weitergereicht werden sollte. Schlüsselwort war die Patensuche. Paten in jeder Beziehung. Über ehrenamtliche ideologische Betreuung sollte quasi der Sieg des Sozialismus vorbereitet und letztlich zementiert werden. Schaltstellen dieser Bewegung befanden sich vornehmlich im Zentralrat, dem leitenden Organ der FDJ. Dort saßen überalterte Berufsjugendliche beiderlei Geschlechts, die sich nicht nur durch erhöhten Zigarettenkonsum auszeichneten. Als Bundesgenossen im Kampf um Herz und Hirn der Heranwachsenden hatte jene sich die Schriftsteller ausgeguckt. Wir waren aufgerufen, mittels Geschichten in neuen Büchern den Vorgang zu begleiten bzw. zu intensivieren. Also schickte man dem auserwählten Künstler ein Auto, fuhr ihn in die Pionierrepublik am Werbellinsee und agitierte ihn mit drögen Vorstellungen in stundenlangen Vorträgen. Dieses geschah in einem Maße, dass über kurz oder lang selbst dem Willigsten unter den herbeigekarrten Schreibern der letzte Rest schöpferischen Elans verloren gehen musste. Salopp gesagt – ich machte mich sobald es ging vom Acker und schrieb meine Story mit dem Titel Patenjäger. Unbeeinflusst von Politikastern jedweden Couleurs wurden in meinem Buch sowohl die alten und jüngeren Genossen, die FDJler und Schüler zu Menschen aus Fleisch und Blut. Die ins Auge gefassten sogenannten Paten nicht ausgenommen. Es waren Menschen mit Fehlern und Vorzügen. Da organisiert unter anderem ein FDJ-Sekretär eine Arbeitsniederlegung, weil der Betrieb die neunte Klasse während des Unterrichtstages in der Produktion (UTP) sträflich unterfordert, ein Lehrer glaubt ständig auf der Hut sein zu müssen wegen der renitenten Schulklasse und ein Maler verweigert anfangs seine Rolle als Pate, weil er statt parteilicher Kunst sich an die Natur als Motivation für sein künstlerisches Schaffen hält. Gewisse Leute schlussfolgern jetzt messerscharf, dass seinerzeit ein derartiges Buch in der von SED-Ideologie und der Diktatur des Proletariats geprägten DDR selbstredend nicht zum Druck zugelassen worden war – aber dank meiner Paten sprich erfahrene Lektorin und politikbewusster Verlagsleiter erschien es bis 1984 in sechs Auflagen. Hier der Anfang des Buches:
„1. Kapitel
Ein kühler Landwind lässt die Wolken über der kleinen Stadt am Bodden nicht zur Ruhe kommen. Ab und zu lugt die Aprilsonne hervor, wirft ihre wärmenden Strahlen auf das Pflaster der Straßen, die in engen Windungen zum Hafen hinunterführen. Die Häuser in der Altstadt kleben wie Schwalbennester an den Hängen. Sind durch Treppen miteinander verbunden, die manchmal fünfhundert Stufen und mehr zählen. Würde am Ortseingang auf der rechten Seite das gelbe Schild fehlen, auf dem der Name Standnitz zu lesen ist, ein Fremder könnte vermuten, dass er sich in einem kleinen italienischen Städtchen irgendwo an der Adria befände. Spräche er die Alten an, die auf den Bänken sitzen und klöhnen, um vielleicht den Weg zu einer der vielen verwinkelten Gassen zu erfragen, er könnte erneut stutzen ob der seltsamen Sprache, die ihm kehlig entgegen klingt. Also nicht Italien, sondern England? Nein, nein – Standnitz gibt es nur einmal. Standnitz ist Rügen, und Rügen ist Standnitz, mannich? „Und nu giw mal Pass, lot de Wippken und Mafäuken“, würden die Alten mit den verwitterten Gesichtern zu dem Bröllenkater sagen, der auf dem Gehsteig liegt. Für den Uneingeweihten heißt das, er soll aufpassen und die Flausen und Winkelzüge lassen. Dieses laut weinende Kind, der Bröllenkater, heißt Jens Schimmelpfennig und ist fünf Jahre alt. Seine Zwillingsschwester Jutta hat sich gerade den Lederball erkämpft. Sie stellte dem Bruder ein Bein. Natürlich ohne Absicht. In diesem Alter tut man so etwas noch nicht absichtlich. Der Dritte im Bunde, Martin, ein kräftiger Junge mit welligem Haar und braunen Augen, läuft zum brüllenden Jens und versucht ihn zu beruhigen. Dabei schaut Martin hoch zum dritten Stock des windschiefen Hauses, das sich nur noch zu halten scheint, weil die links und rechts nebenstehenden es stützen. Aber die Gardine von dem Fenster, das zur kleinen Wohnung der Lehrerin Schimmelpfennig gehört, bewegt sich nicht. Ist Martin Hagedorns Klassenleiterin so von der Qualität der Rechenarbeit beeindruckt, dass sie den Lärm, den Zwillings-Jens veranstaltet, nicht hört? Martin hofft das Beste. Für die Arbeit.
Der Junge unternimmt einen schwachen Versuch, Gerechtigkeit zu üben. Aber als er das runde Leder anfasst, verzieht Jutta das Gesicht. Der Elfjährige kapiert. Ein Bröllenkater reicht ihm. Er läuft zum schluchzenden Jens und bietet ihm einen Pferderitt an. Gratis selbstverständlich. Und Martins Hoffnung, dass dieses kostenlose Vergnügen keinen Anklang findet, erfüllt sich nicht. Auf allen Vieren trabend, zweifelt er die Wahrheit eines Rätsels an, welches er irgendwo gelesen hat und dessen Lösung lautet: Nach der Geburt bewegt sich der Mensch auf vier Beinen, in der Mitte des Lebens auf zwei und zum Ende hin auf drei, wenn man den Krückstock berücksichtigt, den aber nicht jeder braucht. Großvater Kuddel Assmann zum Beispiel geht trotz seiner achtundsiebzig Jahre ohne Stock und kerzengerade.
Das Orakel hat also gefragt: Wer geht am Morgen vierbeinig, zu Mittag zweibeinig und am Abend dreibeinig? Nun, Martin Hagedorn ist es im Augenblick, als fallen Morgen- und Mittagstunde zusammen. Und bei dieser Überlegung angelangt, riskiert er einen Blick auf die Armbanduhr. Martin seufzt erleichtert. In wenigen Minuten muss Lute aufkreuzen und ihn ablösen. Vor Freude bäumt das Pferd sich ein wenig. Aber sofort spürt er einen ärgerlichen Stoß in den Weichen. Kinderhacken können verflucht hart sein, resigniert Martin. Er denkt an Egbert, der es sich mit den Zwillingen leicht gemacht hat. Der dicke Egs, wie die Jungen und Mädchen ihren Mitschüler nennen, hat die Kleinen kurzerhand zu seinem Vater in die Arztpraxis mitgenommen und vorsorglich ihre Augen und Ohren getestet.
Ideen muss einer haben, schnauft Martin, während er den still lächelnden Jens die dritte Runde auf seinem Buckel reiten lässt. Ja, für eine Stunde ist Egs die beiden los gewesen. Eine Stunde hat ihr Interesse für alles in der Praxis von Dr. Sonntag vorgehalten.
Wer solche Möglichkeiten wie Egs hat, der kann schon auf die Idee kommen, dass die Klasse sich um die Kleinen von Frau Schimmelpfennig kümmern sollte. Solange Herr Schimmelpfennig Soldat bei der Nationalen Volksarmee ist. Als Martin seine fünfte Runde auf dem spärlichen Rasenflecken zwischen den eng gegenüberliegenden Häuserzeilen galoppiert und er einen Blick zu Jutta wirft, die damit beschäftigt ist, die Schnüre am Ball aufzuknoten, um ins Innere vom runden Leder sehen zu können, kommt der lang ersehnte Ludwig Bredow um die Ecke.
Temperamentvoll bäumt das Pferd auf der Hinterhand hoch, so dass der kleine Reiter in der Not Martins Hakennase packt, fest genug, um einen Sturz zu verhindern. Martin schießen Tränen in die Augen. Trotzdem setzt er Jens vorsichtig ab und fährt sich dann prüfend mit der Hand über den Nasenrücken. Alles ist heil. Die Knie werden auch wieder sauber. Spätestens nach dem Leichtathletiktraining, wenn er unter der Dusche steht.
.Alles klar?“ Lute Bredow mustert grienend seinen Freund. Er muss etwas aufschauen, da er ein Kopf kleiner ist als Martin.
„Die können einen ganz schön fikatzen“, stöhnt Martin. „Ehrlich.“
Lute lächelt noch stärker. Die Sommersprossen auf den Wangen wandern dabei um einen Zentimeter dem Haarschopf entgegen. Er weiß, dass Martin lieber einen Trainingstag zusätzlich einlegen würde, könnte er sich um diese Spielstunde drücken. Dass Martin Hagedorn sich dem Beschluss der Gruppe gebeugt hat, verlangt Anerkennung.
„Spuck dir man unter die Hacken, wenn du pünktlich zum Training sein willst“, sagt Lute. „Knut ist schon da. Ich hab ihn unterwegs getroffen“, fügt er hinzu.
Martins Gesicht verfinstert sich. Er knöpft betont ruhig den Hemdkragen zu. Die Freude auf den Übungsnachmittag ist plötzlich getrübt. Knut, einer aus der Neunten, hat ihn in der Staffel als zweiten Läufer eingesetzt. Martin war sonst immer am Schluss gelaufen. Und zwar deshalb, weil er ein sehr guter Sprinter ist, aber auch, weil Martin es verstanden hat, die anderen davon zu überzeugen, der Beste der Staffel müsste Schlussläufer sein. Und plötzlich erklärte Knut Assmann: Martin übernimmt bei der Kreis-Spartakiade den zweiten Wechsel! Weil diese Strecke die längste in einer Staffel über 4 x 100 m ist. Alle sehen das ein, nur Martin nicht. Dem zweiten Läufer jubelt keiner zu, wohl aber dem auf der Zielgeraden!“
Erstmals 1995 veröffentlichte Wolfgang Licht im HAAG + HERCHEN Verlag Frankfurt am Main seinen Roman „Die Axt der Amazonen. Eine Penthesilea-Modifikation in Prosa“: Zoe ist eine erfolgreiche Schauspielerin und ihrem Beruf leidenschaftlich verfallen. Ihre Sensibilität ist sowohl Voraussetzung für ihre berufliche Leistung, aber auch schwerwiegendes Hindernis bei der Suche nach persönlichem Glück. Sie leidet unter der Trennung von Erno, dem Vater ihres Sohnes Olaf, dessen Erziehung ihr zu entgleiten droht. Sich der Herausforderung stellend, die Penthesilea zu spielen, verfällt sie dieser Rolle so sehr, dass sie die Grenzen zur Realität nicht mehr wahrnimmt. Die Handlung setzt ein, als Zoe nach Hause kommt:
„Teil 1
- Kapitel
Am Karfreitag betritt die Schauspielerin Zoe, von einer Abendvorstellung im Städtischen Theater kommend, ihre Wohnung in der Westvorstadt.
Ihr ist heiß. Sie öffnet ein Fenster im Wohnzimmer, beugt sich weit hinaus, doch die Nachtluft erquickt sie nicht. Sie schließt das Fenster, geht ins Bad, bemüht, die Stelle in der Diele zu umgehen, an der der Fußboden unter ihren Schritten einen knarrenden Laut gibt, von dem Olaf, ihr Kind, in seinem Zimmer, dessen Tür stets offen steht, aufwachen könnte.
Im Bad dreht sie den Wasserhahn auf, bildet aus beiden Handtellern eine Mulde, in die sie ihr Gesicht presst. Das treibt sie, bis sich ihre Haut kühl anfühlt und der Druck in ihrem Kopf nachlässt.
Sie betritt das schmale Zimmer ihres Sohnes, Ein Lichtstreifen aus der Diele liegt über dem Kinderbett. Sie betrachtet die Umrisse der kleinen, gekrümmt liegenden Gestalt, die sich unter der Zudecke abbildet, die im Schlafe sanften Züge, die wie kleine Fächer aufgebogenen Wimpern über den geschlossenen Augen. Sie atmet seinen Duft, unterdrückt das plötzlich aufschießende Verlangen, das Kind anzufassen. In ihrem Schlafzimmer zieht sie sich um zur Nacht. Doch sie ist noch nicht müde. Eine Weile verharrt sie vor Ernos Bett, das, neben dem ihren stehend, mit einer blauen Seidendecke überzogen ist. Es ist ihr in diesem Augenblick, als berge dieses Bett die Erinnerung an Erno in solch starkem Maße, dass sie die kräftige, untersetzte Gestalt ihres Mannes vor sich zu sehen meint: erdbraune Augen im rötlichen Gesicht, seine ihm wohl unbewusste Bewegung, mit der er eine Haarsträhne aus der Stirn zu streichen versucht.
Vor einem Jahr, auf den Tag genau, war er nach einer heftigen Auseinandersetzung aus diesem Zimmer gegangen.
Seitdem hatten sie sich nicht wieder gesehen. Sie setzt sich auf einen Armstuhl neben dem Fenster und überlässt sich der Erinnerung an Erno.
[*] Kapitel
Damals, es scheint ihr jetzt wie in einem früheren Leben, hat sie an vielen Abenden vor dem Einschlafen noch in ihrem jeweiligen Rollenbuch gelesen, wobei sie, die Arme über der Bettdecke, Gesten andeutete, einen Satz, eine Sentenz vor sich hinsagte und gelegentlich sogar einen Ausruf tat, wenn sie die Szene fortriss.
Erno hatte ihr vornächtliches Benehmen erduldet, ertragen; es ihrer beruflichen Begeisterung zugutegehalten, darin eine der Eigenheiten gesehen, die man einer Künstlerin nachsehen müsste.
Einmal sprach sie Verse des Heilbronner Käthchens an ihren Geliebten. Vor dem Schlafzimmerfenster hing ein orangefarbener Mond über den Parkbäumen. Ein Vogel, wahrscheinlich eine Amsel, sang ein sehnsüchtig schwermütiges Lied, das, gedämpft durch die geschlossenen Fenster, ihre Worte nicht störte. Sie sprach von ihrer, vielmehr Käthchens, beseligenden Liebe, die voller Selbstaufgabe war. Erno lag so, dass er Zoe den Rücken zuwandte. Plötzlich begannen sich seine Schultern im Rhythmus heftiger werdender Atmung zu bewegen, und es kann sein, dass Zoe, das Käthchen spielend, in einem seltsamen Identifikationsvorgang begriffen, die Wirkung ihres Spiels, ihrer Worte an Erno erproben wollte.
Sie hatte einer Zäsur im Text wegen eine Pause eingelegt, in der der geliebte Graf vom Strahl eine ernüchternde, Käthchen demütigende Bemerkung zu machen hatte. In diesem Augenblick drehte sich Erno ungestüm zu ihr herum, ergriff ihre auf der Bettdecke umherfahrenden Hände, presste und küsste sie. Beugte dann sein Gesicht über ihres, nahe, als versuche er im Schimmer des Mondes ihre Züge zu erkennen: Dass du das gesagt hast! Seine Stimme war unfest, er stammelte vor Erregung. Er hatte ihre Hand losgelassen, sich auf einen Ellenbogen gestützt; strich dann mit der anderen Hand über ihre Schläfe, den Hals, rückte näher, begann sie zu küssen, auf die Stirn, das Gesicht, die Brüste. Und obwohl sie, noch im Bann ihres Spiels, ihn und sich selbst, die Frau Zoe, beobachtete, zog Leidenschaft sie wie in einen Sog, der sie endlich ihres Augenblicksbewusstseins beraubte; ihr einen langen hohen Laut auspresste.
Erno war von ihr geglitten. Sein Gesicht an ihren Leib geschmiegt. Der Mond schien jetzt so hell, dass die Baumkronen draußen im Park Schatten an die Zimmerwände warfen, über ihre Körper, das Laken.
[*] Kapitel
In acht Tagen war die Premiere des Stückes. Erno würde diese Aufführung nicht versäumen. Nicht einmal war er einer Erstaufführung, in der Zoe auftrat, ferngeblieben. Und diese Verse, ihr Wortlaut, aber mehr noch Zoes Spiel, ihre Bühnenhingabe an den Partner, würden Erno an ihre Liebe in jener Nacht erinnern. Ihr blieb nichts anderes übrig, als ihm jetzt, an diesem Nachmittag, die Sache zu offenbaren, sich ihm anzuvertrauen.
Sie saßen in den Sesseln vor dem Fenster, das im Gegensatz zu denen des Schlafzimmers auf eine verkehrsreiche Straße hinausging, deren Lärm sie nur dadurch auf ein erträgliches Maß dämpfen konnten, indem sie trotz herrschender Schwüle und der verbrauchten Luft im Zimmer das Fenster verschlossen hielten. Zwischen ihnen stand ein Tisch, auf dem Ernos Zeitschriften Platz hatten, Zoes Rollenbuch und ihre beiden Kaffeetassen. An der dem Fenster gegenüberliegenden Wand hing Ernos umfängliche Sammlung von Hieb-, Stich- und Stoßwaffen aus den früheren Epochen der Wehrgeschichte. Da gab es Streitäxte, Morgensterne, Hellebarden, Schwerter und Krummsäbel. Man konnte die Entwicklung des Dolches vom Faustkeil über den Stein- und Knochendolch, den Feuersteindolch, zum Kupfer- und Bronzedolch der Metallzeit verfolgen. Die verschiedenen Entwicklungsstufen der Äxte, worunter sich als besondere Kostbarkeit die Nachbildung einer sogenannten Amazonenaxt befand. Zoes Blick konnte sich in diesem Moment von den durch die schräg stehende Nachmittagssonne zum Funkeln und Gleißen gebrachten Waffen nicht lösen. Ihr war, als fände sie in der Art, wie sie aufgehängt waren und der im Grunde unerklärlichen Tatsache, dass Erno, der ein pazifistischer Charakter war, sie sammelte, einen Fingerzeig, wie sie ihre Sache am besten beginnen könnte.
Da nahm sie aus den Augenwinkeln wahr, dass Erno sie anschaute. Wann ist es soweit, fragte er plötzlich, und Zoe erschrak, als hätte er ihre Gedanken verfolgen können. Sie wusste auch sofort, dass er die Premiere meinte. In einer Woche, sagte sie. Übrigens, du hast schon Verse aus dem Stück gehört. Verse, sagte er, wann denn? Zoe beugte sich vor, griff nach seiner Hand, mit der er ein Buch hielt. – Gestern. Er sah verdutzt zu ihr. Sie stand auf, trat hinter seinen Stuhl und zog Ernos Kopf an ihren Leib. Sie wiederholte: gestern, gestern Abend, im Schlafzimmer, als wir bevor wir … uns liebten, sagte sie sehr leise.
Er beugte sich nach vorn über den Tisch, um von ihr loszukommen, drehte sich dann um und starrte sie an: Du hast deklamiert, rief er, offenbar absichtlich dieses Wort gebrauchend, um sie herabzusetzen. Das … das, was du mir gesagt hast, war Theater? Diese … Worte, eingelernt? Die Art, wie du mich angesehen hast, der Ton deiner Stimme, Schauspielerei? Ihm schien Speichel den Mund zu füllen. Er umschloss die Flüssigkeit mit Lippen und Wangen, schob sie umher wie einen Brocken, der ihm, dem Manne Erno, zum Bolus werden könnte, an dem er erstickte, bis er ihn zerbeißend, zerdrückend hinunterschluckte mit einem hörbaren Geräusch.
Ich fand sie schön, diese Verse, sagte sie. Ich habe dich nicht täuschen wollen.
Er war aufgestanden, brüsk; hatte eine Bewegung mit der Hand gemacht, als wolle er die Luft zerteilen; kam dann zurück, um seine Papiere vom Tisch zu nehmen. Willst du deinen Kaffee nicht austrinken? fragte Zoe, damit er sich beruhige. Plötzlich vernahm sie das polternde Rattern der Tatrabahn vor ihrem Hause, als höre sie es zum ersten Mal; die Vibration der Gleiskörper setzte sich durch Straße und Haus bis in ihr Zimmer fort. Erno nahm wie unter einem Zwang seine Kaffeetasse auf, sah hinein, schüttelte den Kopf, wobei unklar blieb, ob er Zoes Frage verneinte oder ob ihm der Vorfall unbegreiflich blieb.
Früher, sagte er plötzlich, empfand ich dein Spiel wie eine zweite, neue Wirklichkeit. Ich habe mich an deiner Kunst freuen können, die, wie ich glaubte, unsere persönlichen Gefühle nicht berührte. Aber das ist anders geworden. Wenn ich dich heute üben sehe, dich reden höre, weiß ich nicht, ob du als meine Frau sprichst oder als irgendeine Judith oder Magdalena. Ich kann bei dir Spiel und Wirklichkeit kaum noch unterscheiden; nicht einmal dann, wenn es um Ernsthaftes geht. Denke ich, du redest mit mir, übst du eine Rolle, und glaube ich, du probst einen Text, sprichst du mit mir.
Es war gestern Abend, dachte Zoe, nur ein äußerliches Missverständnis. Ich hätte eigene Worte finden können, sie wären mir zugefallen. Und sie sagte zu Erno: Das sagst du so, aber dann, später, konntest du spüren, was ich fühlte.
Ja, sagte er bitter, gestern dachte ich es, aber heute weiß ich nicht, ob nicht auch das gespielt war. Schließlich gebrauchst du auf der Bühne nicht bloß Worte. Das war boshaft, und Erno wusste es. – Wenn du deinen Empfindungen selbst nicht mehr traust, kann ich dir nicht helfen. Das sagte sie nun auch kühl, und so war das Gespräch auf ungute Weise zu Ende gegangen.
Zoe blickt in die Dunkelheit hinter dem Fenster. Sie atmet tief auf. Heute glaubt sie zu wissen, was damals in Erno vorging. Er konnte sich nicht verzeihen, auf ihre von ihm sogenannten Theatergefühle mit einem Ausbruch wirklicher Leidenschaft reagiert zu haben. In jenen Tagen, wo er vielleicht gehofft hatte, Spannungen, die seiner geschiedenen Frau wegen schon längere Zeit bestanden, auflösen zu können.
Erno war gegangen. Sein Vortrag im „Haus der Technik“ begann erst in ein paar Stunden. Zoe hatte das Fenster geöffnet, Verkehrslärm überflutete sie. Die brandenden Geräusche erschienen ihr wie Äußerungen des Lebens. Fließendes, treibendes Leben, jung, daherstürmend. In immer neuen Anfängen begriffen. Zu diesem Zeitpunkt ging ihre Ehe mit Erno ins vierte Jahr.“
Erstmals 1986 erschien im Verlag Neues Leben Berlin „Aufforderung zum Tanz“ von Christa Grasmeyer: Bettinas Freundin Nathalie meint, dass es altmodisch sei, immer bloß einen Mann zu lieben und dem auch noch ständig treu zu sein. Für moderne Liebe ist Bettina auch. Aber Arne, wie denkt er darüber? Noch aber ist an Arne gar nicht zu denken:
„1. Kapitel
Sie sieht in den großen Spiegel, und sie staunt, dass sie es wirklich ist, sie, Bettina Stoll, Schülerin an dieser Schule, am Ziel ihrer Wünsche. Gleich fällt ihr ein, wie weit sie entfernt ist vom Ziel. Aber sie trägt nun ein schwarzes, an Hals und Rücken ausgeschnittenes Trikot, dazu ein weißes Beintrikot und an den Füßen Schuhe mit über den Knöcheln gekreuzten Bändern, Schläppchen genannt. Sie hat das Haar streng aus der Stirn genommen, wie es hier Vorschrift ist, und am Hinterkopf aufgesteckt. Sie sieht so viel reifer und bedeutender aus als früher.
Füße seitwärts gedreht, mit den Fersen geschlossen, also in erster Position, linke Hand auf der Stange, rechter Arm in vorbereitender Haltung, Kopf nach vorn. Der Mann am Flügel, der Korrepetitor, beginnt zu spielen. Rechten Arm in die erste Position führen, dann in die zweite. Kopf nach rechts und Kopf nach vorn. Becken und Schultern genau ausrichten, Rücken gerade, Schultern gesenkt, geradeaus blicken. Den rechten Fuß vorn gekreuzt vor den linken stellen, das heißt die fünfte Position schließen, seitwärts schleifen, bis die Fußspitze den Boden berührt, fünfte Position hinten schließen, wieder seitwärts schleifen und die erste Position schließen. Wenden und Wiederholung der Übung mit dem linken Bein.
Wie oft hat sie das schon gemacht? Als es hier losging, mit dem Allereinfachsten, das dem Anfänger als erstes beigebracht wird, hat sie sich beinah erhaben gefühlt, denn zu Hause, in der Tanzgruppe bei Dietmar Stiller, ist sie längst darüber hinaus gewesen. Beide Hände auf die Stange legen, mit Mittelkörperspannung stehen, Füße in der ersten Position. Wenn’s weiter nichts ist, hat sie gedacht, aber nicht lange. Die Hände sind nicht irgendwie, sondern in Schulterbreite auf die Stange zu legen, Daumen und die übrigen Finger nebeneinander, und man hat in Unterarmentfernung von der Stange zu stehen, Oberarme in senkrechter Haltung neben dem Körper, Schultern nach unten, Blick nach vorn. Was für eine Penibligkeit!
Bei Dietmar Stiller haben sie oft gemacht, was sie wollten, gelacht, geschwatzt, zwischendurch gestöhnt über Schwierigkeiten, sogar mittendrin einfach aufgehört und erklärt: „Ich kann nicht mehr.“ Was hätten sie wohl gesagt, wenn es Dietmar in den Sinn gekommen wäre, jede einzeln prüfend zu betasten? „Bauch rein“, hat er gerufen: „Rücken gerade, Knie durchdrücken!“ Damit ist es hier nicht getan. Hier kommt die Lehrerin, diese Frau Reichert, auf einen zu und pikt einem mit den Fingern gegen der Po, zur Kontrolle, ob die Gesäßmuskeln gespannt sind. Sie begrabbelt den Rücken, kneift in die Oberschenkel, eine Handgreiflichkeit, die Bettina zuerst hat zusammenzucken lassen. Inzwischen hat sie sich daran gewöhnt, und sie hat gelernt, neunzig Minuten durchzuhalten. Von wegen, ich kann nicht mehr. Hier muss man können, oder man ist an dieser Schule fehl am Platz.
Woher der Muskelkater kommt, ist Bettina anfangs unerklärlich gewesen. Auf einmal machten sich Muskeln bemerkbar, von deren Existenz sie vorher keine Ahnung gehabt hat. Dabei hat sie doch früher Tennis gespielt und geturnt, und weil sie, aus Angst vor den Geräten, immer bloß am Boden turnen mochte, ist sie schließlich nicht mehr zum Turnen gegangen, sondern mit vierzehn Jahren zur Tanzgruppe beim Fritz-Reuter-Ensemble. Da hat Dietmar Stiller sie eigentlich noch nicht aufnehmen wollen, sie war zu jung für seine Gruppe. Aber dann hat er ihre Beine gesehen, und ein Jahr später hat er ihr geraten, zur Eignungsprüfung nach Berlin zu fahren. Er hat ihr gesagt, was sie erwarten würde, und sie war bereit, alles in Kauf zu nehmen und zu ertragen, alles an Mühsal und Plackerei, wenn sie nur Tänzerin werden durfte.
Sie ist verzweifelt, weil Frau Reichert schon wieder ihre Armhaltung korrigiert. Der Unterarm muss leicht eingebogen werden, aber nicht das Handgelenk, denn die Hand verlängert die Linie des Unterarms, und die Finger werden nur leicht gestreckt, nicht gespannt, und immer die Arme schön gerundet halten.
„Verstehst du?“, fragt Frau Reichert.
Bettina nickt.
„Warum tust du es dann nicht? Ich kann dir nicht in jeder Stunde dasselbe sagen, dazu haben wir keine Zeit.“
Bettina nickt wieder. Verzagtheit wird ungern gesehen, man muss Zuversicht und Bereitwilligkeit zeigen. Die Armhaltung heißt port de bras. Der Unterricht wimmelt von französischen Ausdrücken, die meisten sind Bettina noch fremd, aber das entsetzliche port de bras hat sich ihr eingehämmert. Manchmal möchte sie sich die Arme abhacken. Was nützen ihr die Beine, solange ihre Arme wie Stöcke sind?
Bei Dietmar reichte es aus, die Arme zur Seite zu führen oder nach oben. Hauptsache, man drehte einigermaßen die Beine nach außen und man war insgesamt beweglich und stellte sich nicht tramplig an. Sicher wusste er Bescheid über port de bras. Aber seine Aufgabe war es nicht, den Mädchen in seiner Gruppe das Einmaleins des klassischen Tanzes einzupauken. Das tat er bloß in großen Zügen, großzügig also, als allgemeine Trainingsgrundlage. Hier reichen die Vorschriften vom kleinen Finger bis zum großen Zeh. Sogar die Augen haben in eine bestimmte Richtung zu gucken, und wer zu heulen anfängt, muss die Tränen eben laufen lassen.
Frau Reichert hat alle sieben Mädchen im Blick, die nun nicht mehr an der Stange stehen, sondern frei im Raum verteilt. Zu den ersten drei Takten der Musik haben sie die Arme über den Kopf gehoben, in die dritte Position. Beim vierten Takt wird die Position gehalten, beim fünften Takt in die zweite Position geführt, eine Bewegung, die mit den Unterarmen beginnt.
„Leicht strecken“, sagt Frau Reichert, „und, ohne anzuhalten, senken, aus den Schultergelenken, ganz natürlich. Ganz natürlich, Bettina!“, wiederholt sie, und Bettina, die sich müht, im Takt zu bleiben, empfindet ihre Arme wie fremde, an ihr befestigte Gegenstände, die sie bewegen soll, als seien es ihre Arme.“
Noch wird es einige Zeit dauern, bis Bettina zu einer Tänzerin wird und zu einer jungen Frau, die einen Freund hat. Aber wie wird sich die Liebe zu Arne entwickeln? Passen Arne und der junge Mann wirklich zusammen? Und wie viele Menschen kann man wirklich lieben?
Viel Vergnügen beim Lesen, einen guten Start ins neue Jahr und bleiben auch Sie vor allem weiter schön gesund und munter und bis demnächst.
EDITION digital war vor 28 Jahren ursprünglich als Verlag für elektronische Publikationen gegründet worden. Inzwischen gibt der Verlag Krimis, historische Romane, Fantasy, Zeitzeugenberichte und Sachbücher (NVA-, DDR-Geschichte) sowie Kinderbücher gedruckt und als E-Book heraus. Ein weiterer Schwerpunkt sind Grafiken und Beschreibungen von historischen Handwerks- und Berufszeichen sowie Belletristik und Sachbücher über Mecklenburg-Vorpommern. Bücher ehemaliger DDR-Autoren werden als E-Book neu aufgelegt. Insgesamt umfasst das Verlagsangebot, das unter www.edition-digital.de nachzulesen ist, mehr als 1.200 Titel. E-Books sind barrierefrei und Bücher werden klimaneutral gedruckt.
EDITION digital Pekrul & Sohn GbR
Alte Dorfstraße 2 b
19065 Pinnow
Telefon: +49 (3860) 505788
Telefax: +49 (3860) 505789
http://www.edition-digital.de
Verlagsleiterin
Telefon: +49 (3860) 505788
Fax: +49 (3860) 505789
E-Mail: editiondigital@arcor.de
![]()