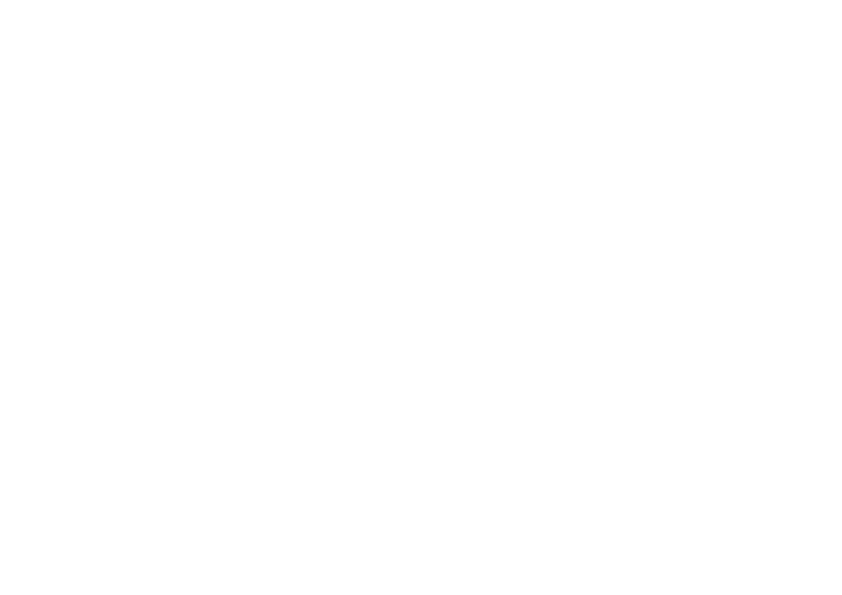Eine Silberhochzeit steht an. Was das für Folgen für Paul und seine Frau hat, darüber schreibt Wolfgang Eckert in seinem Roman „Familienfoto“. Und zum Ende des Buches wird tatsächlich noch einmal der Auslöser gedrückt.
Eine doppelte Ermutigung – die gibt es in „Der Meeraner Bote. Geschichten aus einer kleinen Stadt“ von Wolfgang Eckert zu besichtigen. Aber wer kennt schon Meerane?
Ein fünfzehnjähriger Junge ist scheinbar spurlos verschwunden. Das ist die Ausgangssituation in dem Roman „Kinderbaum“ von Wolfgang Eckert, dem der Autor ein Zitat von Albert Einstein vorangestellt hat: „Es gibt keine großen Entdeckungen und Fortschritte, solange es noch ein unglückliches Kind auf Erden gibt.“ Was ist passiert?
Und damit sind wir wieder beim aktuellen Beitrag der Rubrik Fridays for Future angelangt. Jede Woche wird an dieser Stelle jeweils ein Buch vorgestellt, das im weitesten Sinne mit den Themen Klima, Umwelt und Frieden zu tun hat – also mit den ganz großen Themen der Erde und dieser Zeit. Heute beschäftigen uns wieder einmal lang zurückliegende Ereignisse des Zweiten Weltkrieges, die allerdings bis weit in die spätere Gegenwart hineinspielen. Rätselhafte Vorgänge lassen sich erst verstehen, wenn man mehr über die Vergangenheit weiß – einschließlich lange unbekannter Ereignisse in der deutsch-sowjetischen Geschichte:
Erstmals 2011 veröffentlichte Renate Krüger ihre Erzählung „Clownschule“ im Wagner-Verlag Gelnhausen: In ihrem Buch schlägt die Autorin einen weiten historischen Bogen – vom Zweiten Weltkrieg über die 1950er Jahre in der DDR bis ins Heute. Die Rentnerin Helga Schneider, eine ehemalige Krankenschwester aus Oberschwaben, will sich in einer Mecklenburger Nobelherberge erholen. Damit unternimmt sie zugleich eine Reise in die eigene Vergangenheit, hatte der Gebäudekomplex derer von Klevenow zu DDR-Zeiten doch eine ganz andere Funktion. Er diente als „Rehabilitationsstätte für verdienstvolle, aber mit Sicherheitsrisiken behaftete Staats- und Parteifunktionäre“, wie die Erzählerin mit feiner Ironie schreibt. Ein Objekt, auf dem natürlich auch die Hand der Stasi lag und in dem Helga Schneider beschäftigt war.
Eine im Bereich des Alltäglichen angesiedelte und zu keinen besonderen Höhenflügen herausfordernde Begebenheit, wären da nicht die Hintergründe, die im Verlauf der Erzählung nach und nach sichtbar werden. Und die bestehen nicht aus irgendeiner Familiengeschichte mit Tabubereichen, sondern sind schmerzliche Konturen und Schicksale vor dem Hintergrund deutscher und europäischer Vergangenheit und Gegenwart.
Das Klevenow-Schloss existiert nicht wirklich. Vielmehr handelt es sich um ein fiktives Konstrukt, eine Kombination aus den realen Orten Schloss Wiligrad, dem Sachsenberg in Schwerin und Schloss Basedow. Dort, so Renate Krüger, findet sich auch der Zimbelstern, das Spielwerk einer Orgel, das im Roman eine wichtige Rolle spielt.
Zu einem weiteren wichtigen Motiv des Buches führen drei Clowns, die in Renate Krügers Wohnzimmer stehen. Ein Unterrichtsfach in der Clownschule sei auch das Gebrochensein, heißt es im Roman: Das Leben mit einem lachenden und einem weinenden Auge, über alle statushafte Selbstdarstellung hinausgehend. Die Figuren müssen von ihren Ordnungen Abschied nehmen, um sie zu finden. Von diesem Ansatz stand es für Renate Krüger auch fest, dass sie auch die Stasi-Leute als Menschen und nicht als Un-Menschen beschreibt. Und so beginnt alles:
„1. Kapitel
Schwester Consolata – mit bürgerlichem Namen Hedwig Puchalla – war neugierig auf das, was nun immer deutlicher an ihrem Lebenshorizont heraufzog. In ihrer Sprache nannte man es „die letzten Dinge“ , auf Latein „novissima“ – das Allerneuste … Das Alte hatte sie in 84 Lebensjahren zur Genüge kennengelernt, das stand unabänderlich fest, da gab es nichts mehr zu entdecken oder zu deuten, und Schwester Consolata interessierte sich kaum noch dafür. Was aus diesem Haus, aus diesem riesigen Anwesen im schwäbischen Oberach werden würde, wenn auch die letzten Ordensfrauen gestorben waren – damit befasste sich Schwester Consolata nicht, sehr zur Entrüstung ihrer Mitschwestern.
„Wir werden nicht mehr da sein, aber die Welt wird nicht untergehen. Vielleicht wird hier eine Bananenplantage eingerichtet, wenn es mit der Klimaerwärmung so weiter geht. Oder eine Zitronenfarm. Vielleicht werden unsere Gräber im Palmenschatten liegen. Was weiß ich?“
Schwester Consolata war von hoher hagerer Gestalt und hielt sich gebückt. Ihre harte oberschlesische Aussprache hatte sie nicht abgelegt und baute damit ständig eine Mauer gegen ihre schwäbische Umwelt, der sie sich nie zugehörig fühlte, auch wenn sie nun einmal ihr Arbeitsfeld war. Die Ländlesprache verstand sie noch immer nicht. Eines Tages würde es nach Hause gehen, und das Himmelreich war nun einmal schlesisch. Das Schlesische gab es nur noch im Himmelreich. Alles Schlesische war himmlisch.
Als sie ausgehungert, zerlumpt und mit angesengten Kleidern kurz vor Weihnachten 1945 hier ankamen, mussten sie sich mit unheizbaren Verschlägen auf dem Dachboden begnügen, denn die alte Abtei St. Polykarp diente als Lazarett und als Lager für Staatenlose. Die Mönche, die hier gelebt hatten, waren von den braunen Behörden vertrieben worden. Nur zwei hatten sich nach dem Krieg zurückgemeldet und hausten im Keller unter der Kirche. Viele Kranke wurden geheilt, noch mehr starben, und die Staatenlosen verließen das Land.
Die vertriebenen Ordensfrauen blieben. Sie richteten die ehemaligen Klausurräume wieder her und konnten schließlich den Dachboden verlassen, sich in einem Seitenflügel der ehemaligen Abtei häuslich einrichten und ihr strenges abgeschiedenes Leben wieder aufnehmen. In den anderen weiträumigen Gebäudeteilen fanden weiterhin Entwurzelte und Heimatlose so lange Zuflucht, bis sie in die sich stabilisierende Nachkriegsgesellschaft eingegliedert werden konnten.
Den alten Gebäuden haftete jedoch nach wie vor der Ruf eines unreinen Ortes an und setzte sich intensiver in der Oberacher Erinnerung fest, als die jahrhundertealte Geschichte eines Ortes der Barmherzigkeit und der Wissensvermittlung und deren Weiterführung. St. Polykarp – das klang nach Flöhen und Läusen, dort lebten Fortgejagte und Hergelaufene und Habenichtse, und jeder behauptete, er habe ein prächtiges Haus besessen, reicher noch als die fest gefügten Oberacher Steinhäuser mit den kunstvollen Putzfriesen und den beschaulichen Ziergärten auf den Innenhöfen. Auch die Nonnen nebenan fanden keine Gnade in den Augen der Oberacher, sie waren und blieben anders, sie sprachen anders, und eigentlich waren sie doch halbe Polen.
Als Helga Schneider ins Haus der Nonnen kam, begriff sie sehr schnell, worin ihre einzige Chance lag: so zu werden wie die Oberacher, ohne es mit den Nonnen zu verderben. Als erstes musste sie die Sprache lernen, und diese Aufgabe bewältigte sie in allerkürzester Zeit. Worte und Sätze, die sie gehört hatte, sprach sie so lange nach, bis sie sich einheimisch anhörten.
Und sie verstand es meisterhaft, solche schwäbischen Errungenschaften so anzubringen, dass die Oberacher aufhorchten und sich fragten, ob die Frau Schneider wirklich eine Zuag‘reisde sei, eine von weither Zugereiste, oder nur eine Raig‘schmeggde, eine, die aus der näheren Umgebung kam und hier nur schnell einmal herein riechen wollte. Ganz echt klang es ja freilich nicht, aber auch nicht so abscheulich preußisch wie die Sprache der Nonnen, die man freilich selten genug zu hören bekam, besonders, seit sie die Frau Schneider als Zugehfrau hatten. Sie kaufte ein, sie bediente die Klosterpforte, sie verkaufte Äpfel von den Klosterbäumen, sie war Mädchen für alles.
Man erzählte sich in Oberach, Frau Schneider sei eine Meisterin in der Spätzleherstellung, allerdings hatte niemand jemals von ihren Produkten probiert. Dennoch sah man bald bewundernd zu ihr auf. Niemand hatte etwas dagegen, dass sie im Kirchenchor mitsang, zumal sie eine schöne volle Altstimme hatte. Da sie eine beachtliche Höhe erreichte, konnte sie in Notfällen auch im Sopran aushelfen. Sie sang vom Blatt, und die schwierigen lateinischen Texte sprach sie mühelos aus. Der Organist und Chorleiter Stenzle war außer sich vor Entzücken und überhäufte das neue Chormitglied mit Komplimenten, ohne dass bei den anderen eine neidvolle Regung entstand.
„Wo haben Sie das nur gelernt?“, fragte Herr Stenzle.
„Ach, lassen wir das … Es würde zu weit führen. Hauptsache, man kann es,“ entgegnete Helga Schneider und brachte somit viele Fragezeichen in die Leutemeinung. Man wusste nur so viel: die Schneider kam aus der Ostzone. Aus einem kommunistischen Kerker? War sie geflohen?“ Und damit zu den ausführlicheren Vorstellungen der anderen vier Sonderangebote dieses Newsletters:
Erstmals 2002 erschien im Ingo Koch Verlag Rostock „ICH WAR EIN SPITZELTÄTER. Aufzeichnungen eines Ahnungslosen“ von Wolfgang Eckert: Dies ist eine Geschichte, die auch VERRATEN UND VERKAUFT hätte heißen können. Die Akteure sind Fallensteller und Jäger. Es ist darin die Rede von solchen Leuten, die auf ausgefallene Ideen kommen, um Menschen habhaft zu werden und von jenen, die durch erfolgreiche Abschüsse selber kugelsicher werden wollen. Zwei Welten spiegeln sich: Eine vor 1989 und eine danach. Das alles, was hier verwundert zu lesen ist, stieß dem Autor zu, der einst Humorist war und daran gehindert wurde, weiter einer zu sein. Das Geschilderte macht atemlos, und man fragt sich: Kann es denn so etwas geben? Indem Wolfgang Eckert anhand von Unterlagen, die ihn betreffen, heiter, ironisch und manchmal bitter über sein Leben, seine Träume, Hoffnungen, Irrtümer und Enttäuschungen nachdenklich befindet, entsteht das Bild zweier unterschiedlicher Gesellschaftssysteme, einem Verlierer und einem Sieger, von denen manche Bereiche gar nicht so unterschiedlich sind, weil es in ihnen Betrug, Bedrohung, Hinterlist und Hass gleichermaßen gibt. Es sind die Aufzeichnungen eines Ahnungslosen, aber auch eines Menschen, der dennoch hofft, wieder Vertrauen zu finden. Aber hören wir erstmal den Anfang dieser ziemlich sonderbaren Geschichte, wo etwas passiert, was sich viel später auswirken wird:
„FÜR MEINE ENKEL
ERSTER TEIL
DER MANN MIT DER HORNBRILLE
Diese Geschichte ist wirklich geschehen und also banal. Die Wirklichkeit wird erst farbig durch die Fantasie. Aber hier wäre jede Fantasie die Verklärung des Geschehenen. So hätte es nicht sein können, so war es. Mit dem Abstand, den mir die Jahre brachten, verschwand allmählich die Bitterkeit. Jetzt kann ich darüber lächeln wie ein Clown. Nur die Namen der Personen sind der Fantasie preisgegeben. Sie heißen hier anders. Wer sich dennoch erkennt, den bitte ich, mir das nicht vorzuwerfen. Weil er aber nicht genannt ist, kann er immer noch auf einen anderen zeigen. Wer sich getroffen fühlt, muss nicht betroffen sein. Die Wirklichkeit schwankt zwischen Ernst und Komik. Jeder erkennt sie. Jeder versucht, sie zu verbergen. So läuft sie nackt zwischen der Rosinante und dem Esel. Er ist mir deshalb sehr nahe: Sancho Panza, der auf seinem kleinen dicken Esel neben seinem Herrn Don Quijote einherreitet und ihm immer wieder verzweifelt die Wirklichkeit klar machen will. Aber der Don stürmt ritterlich auf die bösen Windmühlenflügel los und lässt sich von ihnen gar schmerzlich aus seiner Rosinante hebeln. Sancho zerrt ihn, den unbesiegbar an das Gute Glaubenden, schließlich aus der Gefahrenzone und folgt ihm weiter zu neuen wahnwitzigen Abenteuern, weil er doch hofft, durch ihn eine Insel zu bekommen. Des Menschen Träume sind Inseln. Millionen von Sancho Panzas sind seitdem von ihrem Esel auf die Rosinante geklettert, um so in einer gehobenen Stellung der Wirklichkeit zu entfliehen. Und saßen sie einmal da oben, hörten sie nicht mehr auf die Panzas. „Bedenkt doch, die dort sich zeigen, sind keine Riesen, sondern Windmühlen!“ Wer für eine Welt der Ritterlichkeit reitet, holt sich Beulen. Und da der Mensch im Laufe der Zeit immer schmerzempfindlicher wurde, verzichtete er darauf und nannte das fortan Vernunft. Don Quijote wurde für die Vernünftigen zu einer Warnung und für die Unvernünftigen zu einem Versuch, es doch wenigstens einmal gewagt zu haben. Der Spötter Shaw schrieb:
„Der vernünftige Mensch passt sich der Welt an; der Unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab.“
Bei solchen Feststellungen wird es ersichtlich, dass ich in einem sehr vernünftigen Land lebe. Doch ich komme aus dem Land der Don Quijotes, einst DDR genannt. Unsere Herren rannten hurtig gegen die Mühlen des Kapitalismus und zerschellten daran, während diese unbeirrt alles weiter zu Mehl und Kleie zermalmen, was ihnen zwischen die Mahlsteine gerät. Aber wir haben es einmal versucht, auf einer klapprigen Mähre, die wir Sozialismus nannten. Und die jetzigen Herren wachen nun ängstlich darüber, dass wir nicht wieder auf solche Ideen kommen. Ihre Angst ist unbegründet. Es gibt mehr Satte als Hungrige. Und sobald einer ein bisschen hungrig wird, kriegt er gleich wieder etwas auf den Teller. Oder auf den Helm. Herren sind immer, ob wir nun auf einer Rosinante oder auf einem Esel reiten, um unsere Zielrichtung besorgt. Edle Ritter von der traurigen Gestalt und treuherzige Diener beunruhigen sie nicht. Wenn es hoch kommt, stellen sie ihnen zur Ablenkung Windmühlen hin.
Im Frühjahr 1970 dachten einige Herren aus der alten Zeit im Auftrag ihrer noch größeren Herren mehr über mich nach als ich über mich selber. Ich war soeben auf einem äußerst wackligen Gaul namens Pegasus gestiegen und machte mich auf, mit literarischen Worten, wohlbemerkt, mit Worten, für die Gerechtigkeit zu streiten. Weit und breit kein Sancho Panza, der mich hätte noch rechtzeitig vom Schlachtfeld zerren können. Ein paar kleine literarische Erfolge ließen mich wacker losreiten. Ich warf mich als Handweber weg und träumte von riesigen Leserscharen, die meinen Namen ausriefen, als sei ich für sie Manna. Das Leben lag vor mir wie eine weite Ebene, und ich ritt da hinein mit dem Ruf: Aufgepasst, hier kommt ein neuer heiterer Genius. Denn einige Leser hatten über meine Geschichten gelacht. Die literarischen Gedanken waren nun mein Besitz. Ich dachte, also irrte ich. Einen Nagel in ein Stück Holz treiben ist noch immer leichter als einen Gedanken in ein Stück Hirn. Aber ich denke seitdem unentwegt. Ich denke und denke, und wenn ich mich morgens beim Ausrasieren meines bärtigen Gesichtes im Spiegel betrachte, entdecke ich zwei lächerliche philosophische Fältchen über meiner Nasenwurzel als Ergebnis dieser fragwürdigen Beschäftigung. Das ist alles an Erfolg in dreißig Jahren. Sonst besitze ich noch eine Frau, damals 1970 eine hübsche Frau genannt und 1970 einen dreijährigen Sohn, später „ein lieber hübscher Junge“ genannt. Aber Geduld – darauf kommen wir noch. Eine Wohnung besaß ich auch mit Balkon, Bad, Vorsaal und Telefon, einer ungeheuren Errungenschaft in diesen Zeiten. Die Wohnung kostete nur 42 DDR-Mark Miete. Das noch heute zu wissen, verdanke ich eben jenen Herren, die damals mehr über mich nachdachten als ich über mich selber. Und das will schon etwas heißen.“
Erstmals 1982 erschien im Mitteldeutschen Verlag Halle-Leipzig der Roman „Familienfoto“ von Wolfgang Eckert: Fünfundzwanzig Jahre verheiratet und nur mich erschaffen! Was habt ihr denn die übrige Zeit gemacht? So fragt Matthias Weidauer seine Eltern, die ihre Silberhochzeit vorbereiten. Die übrige Zeit, das ist ein Stück DDR Ende der siebziger Jahre. Die DDR gibt es nicht mehr. Aus dem einstigen Gegenwartsroman ist ein historischer Roman geworden. Wolfgang Eckert erzählt oft heiter oder satirisch, manchmal auch ernst und jederzeit spannend, vom Leben einer Familie in einer kleinen Stadt. Zwischen den Zeilen war schon damals die Besorgnis und das Ahnen zu spüren, dieses Land DDR könnte durch eigene Fehler Schaden nehmen. Die deutsche Geschichte hat solchen Befürchtungen rechtgegeben. Vieles, was damals passierte, geschieht nicht mehr. Doch vieles, von dem hier zu lesen ist, geschieht noch immer. Die Menschen haben sich nicht gewandelt in ihren Hoffnungen, Irrtümern, Träumen, Sorgen, Freuden und Enttäuschungen. Als der Selbstauslöser des Fotoapparates zum traditionellen Familienfoto klickt, erstarren die Gesichter im grellen Blitz zu einem Gesellschaftsbild. Ein historischer Roman? Ja und nein. Aber zunächst lernen wir erst einmal die Stadt ein bisschen kennen, in welcher diese – und übrigens auch andere – Familiengeschichten dieses Autors spielen. Es ist seine Heimatstadt:
„Erstes Kapitel
In dieser Stadt war alles möglich. Wochentags schickten ein Dutzend Webereischornsteine künstliche Bewölkung in die Umgebung, die leicht hügelig war, eine Art verschüchtertes Gebirge. Die Schlote der Stadt konnten also schon gesehen werden, wenn ihre Häuser noch von einer Bodenwelle verdeckt wurden. Zum Glück, denn sie waren zu sehr das Produkt einstiger Bodenspekulanten. Sie standen reihenweise im Karree, Türme auf den Giebelfenstern, bärtige Köpfe an der Vorderfassade; meistens war das Baujahr angebracht: Achtzehnhundertneunundneunzig. Wer sich auskannte, wusste, was da alles zu Ende ging.
Die Hinterhöfe und -gärten waren das Produkt der Hausbesitzer: Blumen oder Kohlrabi, Klopfstangen, Hollywoodschaukeln je nach Lebenshaltung. Und Karnickel, die mit ihren Hinterläufen gegen die Stallwände schlugen. Paradies für Kinder – oder Grenze. In manchen Betten wurde auch vormittags geseufzt, die Schornsteinfeger wussten darüber Bescheid. Sie kletterten auf den ungleichen Dächern entlang und zeigten ihre weißen Zähne. So lange sie da oben waren, gab es unten welche, die sich noch freuten, wenn es ihnen gelungen war, ein richtiges flackerndes Feuer in Gang zu bringen. Ansonsten war die Stadt nicht die schlechteste, wohl aber auch nicht die beste. Sie lag hinter den großen Städten und vor den kleinen Dörfern. Es war alles möglich: Vergröberung und Verfeinerung. Im Ladenfenster des Kommissionshändlers Pinske kackten sechs mickrige Kücken immer noch aufgeregt in die effektvoll gestreuten Sägespäne, obwohl Ostern vorbei war. Aber hier verschwanden auch die Plakate viel zu spät. Die Mulde, unweit der Stadt, trug außer den üblichen Färbereiabwässern braunes Schmelzwasser aus dem Gebirge. Vom Eise befreit also – aber die Straßen waren noch nicht vom Streusand befreit. Sie wirkten nur neu in der Stille. Vier Sorten Vögel, die sich erstaunlicherweise mit der Stadt angefreundet hatten, spektakelten auf den Dachrinnen, und in manchen Radios machten jetzt Millionen Hausfrauen in Deutschland Schluss mit dem Grauschleier und Prinzessin zur Lippe-Biesterfeld (82) machte noch Jagd auf Wildschweine.
Das war im Mai, als Paul Weidauer auf die Idee kam, seine Frau das zweite Mal zu heiraten.
„Ich hab’s mir überlegt, Traude“, sagte er, „wir feiern im großen Stil.“
Er war plötzlich der Ansicht, so ein Ereignis muss für ewig in Erinnerung bleiben. Entweder man feiert eine Silberhochzeit unter vier Augen, was keine Hochzeit ist, oder man lädt Tod und Teufel dazu ein, also die Verwandtschaft. Seine Frau konnte sehr schöne große Augen machen, dunkelbraune. Immer dachte Paul dabei an eine neue Rehart, die einen auch anspringen kann, und das gefiel ihm. Seine Frau war fünfundvierzig und die Dachdecker pfiffen ihr von den Dächern hinterher, na ja, die Dachdecker hoch da droben, doch immerhin!
Diese springenden Rehaugen also guckten ihn an, voller Freude und Schreck. „Hast du das richtig überlegt, Paulus?“, fragte sie.
Und er erwiderte ohne Wimpemzucken: „Natürlich.“
Sie nannten ihn manchmal Paulus, weil er seine Brauen ganz langsam bis zum Haaransatz starten lassen konnte, wenn ihn etwas erfreute oder ärgerte. Als es seine Frau einst entdeckte, rief sie: „Wie ein Prophet! Wie irgend so ein Johannes oder Paulus. Ja, Paulus, ganz richtig, das passt!“
„Und wer war das?“, fragte Sohn Matthias.
„Ach“, erwiderte Traude, „eine uralte Gestalt.“
Darauf sprach Paul eine Woche lang nicht mehr mit ihr. Er griff sich ein Lexikon und suchte unter Paul, weil er ihnen beweisen wollte, wer er wirklich war. Dort stand: Paul – der Kleine, der Geringe. Da wollte er doch lieber Paulus heißen.
„Hast du dir das richtig überlegt, Paulus?“, fragte damals Traude.
„Natürlich“, hieß seine Antwort, und natürlich hatte er sich das nicht richtig überlegt. Mein Gott, ’n paar Leute einladen, was war denn das schon! Früher klatschte man in die Hände, und sie waren alle da.
„Wir müssen Einladungen drucken lassen“, sagte seine Frau in ihrer schnellen praktischen Art, „und Danksagungen gleich hinzu, denn nun wird es bekannt. Hoffentlich nimmt die Druckerei noch an, Oktober ist schnell.“
„Danksagungen!“, schrie er. „Wir sind doch nicht gestorben.“
Auf einmal war etwas anders. Gerade so, als würde ein Geigerzähler seinen Rhythmus ändern.
Zum Abendbrot sagte Traude: „Im großen Stil, erklär mir das mal.“
Er kaute in der Geschwindigkeit seines Gedächtnisses, nämlich langsam. „Tja“, erwiderte er, „Bier, ein paar Kästen, was Feines auf dem Teller und vielleicht dann Eisbombe.“
„Eisbombe“, wiederholte Traude, als meinte sie Zeitbombe, „ich ahnte es. Du die Idee, ich die Arbeit.“
„Du nicht“, widersprach er, „du bist die Braut.“
Und das war ungeheuer albern, denn das hieß ja, er war der Bräutigam.
Matthias nahm sein Zwergradio vom Ohr.
„Was ist ’n mit euch?“, wollte er wissen.
„Wir heiraten“, warf Paul ziemlich nebenbei hin, „Silberhochzeit. Nach fünfundzwanzig Jahren ist das Sitte.“
„Mann!“, staunte Matthias, „und nur mich erschaffen! Was habt ihr denn die übrige Zeit gemacht?“
„Gearbeitet“, erwiderte er. Und je mehr er darüber nachdachte, es stimmte. Feiern standen in ihrem Leben wie Oasen in der Wüste. Hochzeit, Geburt von Matthias, Schulanfang, Jugendweihe …
Seinen Fünfzigsten hatte er selber zu ’ner Bagatelle gemacht.
„Schön wär’ es schon“, sagte Traude und sah ihn ganz anders an als sonst.
Er holte Zettel und Bleistift. „Pass auf, die paar Leute haben wir schnell. Zuerst Alfred und Lenchen, die waren damals Trauzeugen. Dann Lilo und Theo.“
„Da musst du Britta hinzuschreiben“, ergänzte sie.
Sie stellten plötzlich fest, dass auch Alfred Kinder besaß und sogar Onkel Al, obwohl der wenig Zeit hatte. Und die Kinder besaßen Familien. Also ohne Kinder, das stand nun fest.
Zum ersten Mal kam Paul der Gedanke: Verwandte, das ist eine Organisation, die in dem Moment auf ihre Zusammengehörigkeit pocht, wenn man sie trennen will. Die Stammbäume der Köbners und Weidauers waren so ineinander verwachsen, dass immer ein Köbner mit herunterfiel, wenn sie am Stammbaum der Weidauers rüttelten. Als die Liste vollständig war, verlas Paul nochmals zur Kontrolle die Namen, und Matthias sagte, das klänge wie eine Anrufung, Geister in der Ferne und so, na ja, eine Karte käme im Jahr: Wir leben noch, lebt ihr? Oder zum Wochenmarkt in der Stadt stolperte ein Verwandter zufällig über einen anderen. Wie geht’s euch denn? Uns geht’s, und wie geht’s euch? Uns geht’s auch! Jetzt wüsste er erst, was entfernte Verwandte bedeuteten.
„Matthias!“, mahnte Traude.
Es war abends. Die Sonne färbte aus der Erkerwohnung einen roten Salon, er kam Paul deshalb geräumig vor. Die Türen aus den Angeln gehoben, die Betten auseinandergeschlagen, die brauchten sie für die eine Nacht nicht, ist doch klar nach fünfundzwanzig Jahren – der reinste Tanzsaal wartete auf seine Gäste. Paul sah Theo mit Lenchen über die Schwelle walzern und Traude am Tafelende, silbergekrönt, und er zählte noch einmal die Namen auf der Liste durch.
„Hatten wir die alle schon mal auf einen Haufen?“, fragte er ungläubig.
„Vor vierzehn Jahren“, sagte Traude sofort, „zu Matthias’ Schulanfang. Da hat Albert sogar ein Foto gemacht. Warte, das muss im grünen Karton liegen.“
Es war ihre Lieblingsbeschäftigung, Fotos der Verwandten in Schuhkartons einzuwecken oder an jede freie Wandstelle zu nageln. Hängte Paul seine Arbeitsjacke an den Haken, verdeckte er jedes Mal das Gesicht einer Großtante namens Sidonie. Nahm er die Jacke wieder weg, traf ihn ihr vorwurfsvoller Blick. Es war schon vorgekommen, dass er bei solcher Gesichtsverhängerei Besuch im Wohnzimmer reden hörte. Traude stellte Fragen, beantwortete welche und lachte. Es war klar, dass er nach der Mittagsschicht in seinen bequem ausgebeulten Trainingsanzug kriechen wollte. Nun musste er in die guten Hosen, in ein weißes Hemd und in ein besonders nettes Grinsen. So hergerichtet betrat er das Wohnzimmer. Traude wischte Staub.
„Oh!“, rief sie, als sie ihn so eingepackt sah, „das kann doch nicht wahr sein!“
„Ich denke, du hast Besuch“, sagte er.
„Besuch? Siehst du welchen?“
„Aber du hast gesprochen.“
„Habe ich das?“
„Und ob. Erst hast du etwas gefragt, danach tüchtig gelacht.“
„So“, sagte sie nachdenklich. „Es kann schon sein, Paul, manchmal rede ich.“´
Erstmals 1991 veröffentlichte Wolfgang Eckert im Chemnitzer Verlag und Druck Chemnitz „Der Meeraner Bote. Geschichten aus einer kleinen Stadt“: Wer kennt schon Meerane? Ist es nur eine jener kleinen hässlichen, grauen Industriestädte an der Grenze zwischen Thüringen und Sachsen? Wolfgang Eckert, getreuer Chronist seiner Heimatstadt, entdeckt die Überraschungen dieser „hässlichen Schönen“: Hier wurden der Schriftsteller Erich Knauf, der Schauspieler Ralph Arthur Roberts und der Komponist Werner Bochmann („Heimat, deine Sterne“) geboren. Hier war seit Jahrhunderten die Tuchweberei zu Hause.
Wolfgang Eckerts heiter-nachdenkliche Blätter erzählen von den Erlebnissen und Erfahrungen der Menschen im historischen Jahr der deutschen Einheit 1990. Ein Stück Deutschland en miniature wird sichtbar. Aber hier zunächst eine kurze Erklärung, wie diese doppelte Ermutigung begann:
„Vorbote
Im November 1989 wurde in Meerane ein kleines Wochenblatt, das Meeraner Blatt, gegründet. Es bot mir die Chance, regelmäßig dazu eine Unterhaltungsbeilage zu schreiben gegen eine bescheidene Geldprämie, die es mir gestattete, wenigstens von der Hand in den Mund zu leben. Mehr noch aber erwies sich als lebenserhaltend die Tatsache, dass ich aus meiner geistigen Lähmung erwachen und mich wieder zur Zeit äußern konnte.
Das wöchentliche Feuilleton blieb und findet seitdem seine Leser, die es nicht mehr missen wollen. Sie „zwingen“ mich jede Woche zu einer neuen Idee. Neu ist aber auch der Weg zur Veröffentlichung: Das Geschriebene unter den Arm nehmen, zur Druckerei gehen und dort mit den Beschäftigten über die technischen Varianten des Druckes beraten. Dabei erleben, wie ihnen das Spaß macht. Kein Redakteur streitet mehr darüber mit mir, dass dies oder jenes nicht drinstehen sollte, da es nicht objektiv genug sei oder man doch damit keine schlafenden Hunde wecken möchte. Und es geschieht auch nicht mehr, dass ich mein Gedrucktes dann voller Zorn lese, weil man, ohne mit mir darüber zu sprechen, genau die kritischen Sätze gestrichen hatte, auf die es mir angekommen war.
Das erste Feuilleton des vorliegenden Buches stammt vom 6. April 1990, das letzte vom 17. Mai 1991. Auf eine chronologische Folge und das jeweilige Datum wird verzichtet, da der Zeitbezug des Inhaltes auch so deutlich zu erkennen ist.
Ich danke allen, die mir halfen, dass fast ungewollt mit dieser Sammlung ein kleines Zeitdokument in einer für uns schweren Phase entstand und meine Geburtsstadt Meerane dazu der Hintergrund sein durfte.
Mir wurde beim Schreiben bewusst, dass viele Meeraner von mir eine Ermutigung erhofften. Aber ich habe solche wohl selber dabei dringend gesucht. Vielleicht war diese Suche das Motiv.
Liebe Meeranerinnen, liebe Meeraner!
An dieser Stelle möchte ich jetzt immer mit Ihnen ein bisschen durch die Stadt bummeln, mich an Meeraner Persönlichkeiten erinnern, heiter-besinnlich in Nebengassen verlieren oder hart in eines der zahlreichen Schlaglöcher sacken, mich tief in die Vergangenheit der Stadt verirren, um uns wiederzufinden. Wenn bei Ihnen dann das Gefühl entsteht, die Stadt sei ein guter alter Hund, dem man gerührt über das graue Fell streicheln muss, so ist das keine Tierliebe, sondern Stadtliebe und hoffentlich das Wachsen eines Verständnisses füreinander. Wir wollen zunächst ganz allgemein durch die Stadt schlendern – hoppla, hier sträubt sich schon die Feder! Es geht keiner allgemein, er geht immer subjektiv, denn er sieht nur das, was er sehen will, und er übersieht, was er hätte sehen müssen. Also gut, gehen wir trotzdem …
Als mich kürzlich ein Freund aus Hamburg besuchte, bemühte ich mich krampfhaft, ihm die Sehenswürdigkeiten von Meerane zu zeigen. Mit unserem schönen Rathausportal sammelte ich Punkte für die Stadt. Sofort verwies ich dann seine Blicke auf die neuen Stadthausfassaden. Und so gelang es mir geschickt, dass er keinen Kontakt zu unserem Kontakt-Kaufhaus fand, welches wie die Faust aufs Auge ins Marktplatzbild passt. Ich habe immer den Eindruck, das Gebäude wurde während des Transportes in eines der allbekannten DDR-Neubaukastengebiete hier an dieser Stelle verloren. Und so liegt es denn. Am Thälmannplatz rief mein Hamburger: „Oh, unser Thälmann!“ Sogleich legte er mit seinem Fotoapparat los. Ich gestehe, ich wollte zum sehenswerten Postamt, dessen Äußeres allerdings unübersehenswert restaurationsbedürftig ist. Wenn dies eines Tages geschehen ist, werden wir staunen, was für ein Postamt wir haben! Aber Thälmann also. Vielleicht haben Hamburger ein anderes Verhältnis zu ihm. Das ist nachdenkenswert. Thälmann hat seinen Kopf hingehalten, mehr noch, er wurde deswegen umgebracht von den Nazis. Könnte es die Scheu vor soviel Mut und Standhaftigkeit sein, die manchen Wahnwitzigen davon abhält, das Entfernen des Denkmals zu fordern. Manche möchten doch blindlings alles entfernen, um ja auch richtig als Revolutionär zu gelten. Vorher stand dort Bismarck. An seine eisernen Stiefel schmiegte sich halb oder krallte sich, wenn mich meine Kindheit nicht täuscht, ein prächtiger Reichsadler. War der Schöpfer des Denkmals ein ahnungsvoller Prophet? Fotos verfremden und zwingen zum genaueren Erkennen. Als ich später aus Hamburg ein Foto vom Thälmannplatz erhielt, sah ich hinter Thälmanns Rücken eine Häuserreihe mit der typischen Fassadenornamentik und Giebelgestaltung der Jahrhundertwende, die auch Meerane eine bestimmte, zwar nicht stilreine, Originalität gab. Da erkannte ich, dass der rechte Abschluss der Häuserreihe einst geschmack- und gewissenlos zu fantasiearmer Glätte verstümmelt wurde. Wer es nicht glaubt, der gehe hin und überzeuge sich. Und wenn ihm dann danach ist, laufe er die Thälmannstraße hinauf zur Kirche, wo er für die, die das getan, nachträglich um Vergebung bitten kann. Von der Kirche wäre viel zu reden. Aber wir wollen ja vorerst schlendern. Ab Oktober 1989 war sie montäglicher Schauplatz einer großen – der Kirche sei Dank! – friedlichen Erhebung. Zwei Männer unterhielten sich zu dieser Zeit draußen in meiner Nähe. „Gehst du ooch ‚rein?“, fragte der eine. „Nee“, erwiderte der andere, „ich bin gläubig“. Aber vielleicht sind manche damals wirklich gläubig geworden und haben hoffentlich bis heute nicht vergessen, was sie da ergriffen hatte. Es heißt ja, wenn der Mensch schwach wird, dann glaubt er. Am Fischladen wird eine freundliche Verkäuferin gesucht! Früher nur eine Verkäuferin. Jetzt könnte Unfreundlichkeit bestraft werden. Wie schön. Bald erleben wir ein Lächeln, zwar ein freies marktwirtschaftliches, aber immerhin ein Lächeln. Auf dem Weg zum Markt eine Galerie vergangener Wahlparolen: Eine neue Politik. Eine neue Moral. Es gibt immer nur die Moral. Alles andere ist keine. Freiheit statt Sozialismus. Was ist Sozialismus? Wir hatten keinen. Höchstens den real existierenden, und der ging in die Hosen – pardon, in die Binsen! Und was ist Freiheit? Die ich meine? Freunde helfen Freunden. Da gibt es im Leben höchstens eine Handvoll. Ein Schelm, wer eine Hand wäscht die andere liest. Links hatten sie schon – rechts wollen sie nicht. Aber wer in der Mitte zum Markt will, kann leicht überfahren werden. Auf dem Meeraner Marktplatz ein ECKERT–Reisebus. Erneut verkneife ich es mir, einen Klapptisch zu kaufen und – wo mich doch alle kennen – ihn neben die Bustür zu stellen mit einem Zettel vorn dran: Hier Kasse! Hier bezahlen! Die Kasse ist oben in der Marienstraße. Auf phosphoreszierendem Papieruntergrund leuchtet mir im Schaufenster entgegen, wohin wir jetzt können – sofern wir können. Sogar nach Spanien! Sofort sehe ich zwei leidenschaftliche Meeranerinnen in der Stierkampfarena von Madrid. „Karramba, itze kimmt dr Schdier!“, „Guckema, wie dar off dann kleen Schiedsrichdr losgitt!“ „Das is doch dr Dorrärooo!“ „Das heeßd nicht Dorräroo, das heeßd Ferrärooo.“ „Was isn das?“ „Das sinn die kleen Dingr, die se uns immr Weihnachdn rüberschiggn inner Bonkschäre.“
„Escha! Das heeßd Monk Scherrie. Und die kannsde itze selbr holn, wo mir doch nu oobald dr Wesdn sinn.“ „Guckema, itze haddn dar Ferrärooo abgekändscherd!“ „Nu ehm. Du, was wärndn die mit dann vieln Fleesch machn?“ „Nu Boggwärschde!“ Schon will ich mich abwenden, da lese ich im Schaufenster: Wer Eckert wählt, hat richtig gewählt. Aber meine Partei stand doch gar nicht auf der Liste! Machen Sie’s vorerst gut. Wir sind bei Uhren-Gnauck angelangt. Mal sehen, ob er meine repariert hat. Damit ich wieder weiß, was die Uhr geschlagen hat.“
Erstmals 2015 erschien im Ingo Koch Verlag Rostock der Roman „DER KINDERBAUM“ von Wolfgang Eckert: Die Kindheit ist eine Quelle für alles spätere Leben. Wenn eine Mutter in ihrer Kindheit keine Liebe erfuhr, kann sie eine solche auch nicht an ihre Kinder weitergeben. Sie besitzt ihre Kinder, aber sie liebt sie nicht. Es entsteht ein krankhaftes Verhältnis. Es gibt nichts Schlimmeres wie Eigensucht als Ersatz für eine verlorene Kindheit. Aber es gibt auch eine nicht unbeträchtliche Anzahl von Fällen benachteiligter Väter.
Die eigentlich Geschädigten aus solchen tragischen Missverhältnissen sind die Kinder.
In diesem Roman ist es Franz Weidauer. Wie in Brechts „Kaukasischem Kreidekreis“ wird an ihm gezerrt. Und wenn es keinen klugen Richter wie Azdak gibt, nimmt das Schicksal einen Lauf, gegen den nicht einmal Ämter etwas ausrichten können. In eine Last aus Lügen verstrickt, sucht Franz Halt. Und wie ein Mensch, der ins Moor geraten ist, versinkt er langsam darin.
Wolfgang Eckert erzählt diese Geschichte von Verstrickungen und Versäumnissen der so genannten Erwachsenen in leisen Tönen, hinter denen sich eine dramatische Tragik verbirgt. Und wenn es nur einen solcher Fälle gäbe, wäre es schon einer zu viel. „Es gibt keine großen Entdeckungen und Fortschritte, solange es noch ein unglückliches Kind auf Erden gibt“, schrieb Albert Einstein. Die Geschichte spielt in derselben Stadt wie der Roman „Familienfoto“ desselben Autors. Und sogar die Familie ist dieselbe – auch wenn alle handelnden Personen etwas älter geworden und sogar noch einige Kinder hinzugekommen sind:
„I. TEIL
- Kapitel
Die Stadt hätte einen Wettbewerb um ein bemerkenswertes Denkmal mit Sicherheit verloren. Sie hieß Narem. Rückwärts gelesen wäre sie ein beliebtes italienisches Touristenziel geworden. Sie hatte zwar eine italienische Treppe. Doch das half ihr nichts. So kommt die Stadt Narem unter tausend anderen Städtenamen überhaupt nicht in Erwähnung. Sie lag flach und wie kraftlos zwischen einzelnen Waldungen, die als Anhöhen bezeichnet, hochstaplerisch gewesen wäre. Ab und zu verschwand ein Linienbus aus dem benachbarten Gluchow im Bauch der Stadt, und es stiegen ein paar Leute aus zum Einkauf oder sie kamen zurück, weil sie geglaubt hatten, in Gluchow kaufe es sich besser ein. Immer ist der Mensch sein Verfolger. Auf dem Wunderlich-Platz schoben andere aus dem Simmel-Markt Einkaufswagen zu ihren parkenden Autos und blickten so liebevoll in die aufgehäuften Waren, als fahren sie kleine Kinder aus. Auf dem Markt boten Händler in ihren Ständen Backwaren, Fisch, Gemüse, Ziegenkäse, Musikkassetten und Mützen an. Hüte schon gar keine. Obwohl es in dieser Zeit besser gewesen wäre, gut behütet zu sein. Im Zeitungsständer vor der Tabakbörse grellte auf einer bunten Zeitung werbeclever der Titel „LEICHE WAR NOCH GUT ERHALTEN!“ als gäbe das allen Grund, optimistisch über ihren Gesundheitszustand zu sein. An diesem Tag ähnelte Narem in der Gegend des Marktes einem Großstadtzentrum. Es gab kaum noch Parkplätze. Autos fuhren langsam an den die Straße überquerenden Passanten vorbei. Auffallend viele ältere Naremer bevölkerten die Straßen. Man hätte glauben können, es gibt hier gar keine Jugendlichen. Auf den Gesichtern war eine freudige Erregung. Die Falten schienen geglättet. Es war die geheime Macht des Geldes, die da leuchtete und ausnahmsweise auch einmal die kleinen Leute befallen hatte. In ihren Börsen war der Euro vorübergehend gestiegen. Die rechten Seiten ihrer Kontoauszüge wiesen nach einer unendlichen sich stetig steigenden Abzocke von Minuszeichen plötzlich wie ein Blitz in der Nacht ein Pluszeichen auf: Die Rentenauszahlung. Von Monatsanfang zu Monatsanfang verbrauchten die Renten sich immer schneller ohne dass die täglichen Käufe gestiegen waren. Leise schlich sich die Altersarmut durch die Hintertür ein, beinahe schmerzlos. Sie kam nicht wie ein Absturz, sondern wie ein sanfter Gleitflug.
Sonst hatte die Stadt nichts weiter Aufregendes zu bieten. Ein altes Rathaus mit kleinem Heimatmuseum, das mit der neu getünchten Hauswand so aussah, als wollte es sein Alter verheimlichen. Schräg gegenüber fielen die zwei metallischen Kunstwerke eines hier ansässigen Bildhauers auf. Eine schmale silbrig glänzende Säule, an deren Ende mit Fantasie eine Frau im wehenden Gewand zu sehen war. Aber die Naremer mit ihrem lokalen Humor nannten das Gebilde Spargelstecher. Dann die metallische Darstellung eines Leinwandgewebes wie schwebend und leicht fallend dem Betrachter zugewandt, als müsse den Stoff ein Warenschauer nach Fehlern begutachten. Die stählernen Fäden verflochten sich ineinander und sollten an die einstigen, hier bestanden habenden Webereien erinnern. Doch die Jugendlichen, welche es durchaus in der Stadt gab, hatten keinerlei Erinnerung daran. Viele der alten Werkruinen waren längst abgerissen und das rhythmische Schlagen ihrer Webstühle eine verklungene Melodie.
Dann gab es hier noch eine Stadtbibliothek, die sich rührig bemühte, die Naremer zu ermuntern, das Lesen nicht zu verlernen. Als Konkurrenz gegenüber eine Buchhandlung und ein Kunsthaus mit Galerie. In dem Kunsthaus wurde an die hier geborenen Stadtsöhne, den Schauspieler Ralph Arthur Roberts, den Komponisten Werner Bochmann und den Schriftsteller Erich Knauf in einer mäßig besuchten Dauerausstellung erinnert. Aber diese Persönlichkeiten hatten schon als Kind oder Jüngling die Stadt für immer verlassen und dienten ihr nur noch als schmückende Beigabe. Manch einer der Naremer wusste gar nichts von Bochmann und Roberts und schon gar nicht, was Knauf widerfahren war. Den hatten die Nazis 1944 hingerichtet. Aber das war ja schon unendlich lange her. An der Vorderfassade des Kunsthauses prangte warnend Schillers Ausspruch: Die Kunst ist eine Tochter der Freiheit. Doch es lebten auch welche in der Stadt, die bei dem Namen Schiller eher an Schillerlocken dachten und welche, die es als eine Kunst ansahen, die so genannte überkommene Freiheit auch als eine solche zu empfinden. Viele leere Geschäfte gab es hier aus Mangel an Umsätzen, wegen zu hoher Ladenmiete oder weil die Kaufhausketten sie wie Staubsauger in sich hineingesogen hatten. In den ausgeräumten Schaufenstern boten sie sich zum Verkauf an. Das sinnlos gewordene Postgebäude blieb bisher vom Abriss unversehrt, dem Bahnhof drohte der Abriss im Schatten der stolzen Deutschen Bahn. Einige Apotheken machten Gewinn bringende Geschäfte an den Kranken. Kein Apotheker rief deshalb seinen Kunden nach: Bleiben Sie schön gesund! In einer Zeit, wo von Aufschwung und überwundener Krise gesprochen wurde, diagnostizierten Neurologen häufiger Depressionen und in Mode gekommene Burn-Outs, die sich wie Verkaufsknüller anhörten. Eine Kirche besaß die Stadt natürlich auch mit einem kaum über die Dächer ragenden Turm, so, dass man ihn nicht den Zeigefinger Gottes nennen konnte. Zur Wendezeit war die Kirche rappelvoll gewesen von plötzlich gläubig gewordenen Märtyrern. Jetzt versammelte der liebe Gott wieder seine Handvoll Schäfchen. Manchmal schlug bis zu Mittag einsam und wie verloren die Sterbeglocke zum nahen Friedhof hin, was aber die in der Stadt noch herum Laufenden nichts anging, sondern den, der auf seinem letzten Weg zur Grube begleitet wurde. Unterhalb der Kirche wellte die bereits schon erwähnte breite italienische Treppe zum Teichplatz hinunter, wo es statt einer italienischen eine deutsche Eisbar gab und wo einmal im Sommer zu später Stunde und zu gut Englisch ein Open-Air-Konzert stattfand, was einst zu gut deutsch Freiluftveranstaltung hieß. Einmal war der Teichplatz bis zur letzten Ecke mit Stühlen ausgefüllt. Und im Strahl der Scheinwerfer schwelgten die Naremer höchst großstädtisch geworden hinauf zu den Klängen des Orchesters, das auf der Treppe Melodien aus „My fair Lady“ spielte. „Ich hätt getanzt heut Nacht –“
Nein, es war nicht so, dass die Naremer fantasielos in ihren vier Wänden lebten. Aber über ihnen thronte eben kein fürstliches Schloss wie im nahen Gluchow oder Muldenburg, kein romantischer Fluss mit Gondolieres schlängelte sich durch die Stadt, sondern nur ein in Ziegelsteine eingefasstes Rinnsal namens Meerchen, stellenweise zum Glück unterirdisch, aber manchmal freigelegt mit dem Bemühen, das Gefühl für einen Lido zu erwecken. Hinter der Kirche stand als einziges Kleinod das Pfarrhaus mit Fachwerk. Hätte Narem noch hundert solche Häuser gehabt, es hätte sich mittelalterlich nennen können. Hätte, hätte, hätte– Man kann aus einem hundertsechzig Zentimeter kleinen braven Mädchen kein langbeiniges Model machen.
So ist die Stadt nur eine unter vielen ihrer Art mit etwa zwölftausend Seelen oder Unseelen und einem riesigen, den Stadtvätern das Steuersäckel gehörig füllenden und Arbeitsplätze bringenden Gewerbegebiet, das sich getrost Neu-Narem nennen könnte. Einst pflügten hier Bauern und lieferten zur Ernte Korn für das tägliche Brot. Nun brannte sommers die Sonne auf harten Beton und die Bauern saßen auf ihrer Entschädigung wie auf alten Schatztruhen. Neu-Narem klebte wie ein medizinisch verordneter Blutsauger an der Haut Alt-Narems und ödete es innerlich aus mit Werksgebäuden, Autohäusern, Supermärkten, Hotel, Gaststätte, Postannahme, Apotheke und anderen Serviceleistungen. Naremer, die im Crimmitschauer Viertel wohnten, verlernten den Weg in die Stadt. In anderen Stadtteilen wie der Crotenlaide, dem Böhmerviertel oder dem Schafshügel, einem Siedlungsgebiet ganz am Rande der Stadt, wo an jedem Fenster registriert wurde, wer da vorbeiging, entstand das trügerische Bild von Geruhsamkeit. Aber hinter den Hausmauern wurde geliebt, gehasst, geprügelt, jede Menge Porzellan zertrümmert und manchmal wieder geleimt, wurde gehofft und aufgegeben, Hirne durch die Mattscheibe des Glücksausstrahlers narkotisiert, alles eine Nummer kleiner und miefiger und weniger betäubt durch Ablenkungen als in einer großen Stadt. Doch die Menschen einer solchen hätten mit denen Narems ausgetauscht werden können und es wäre nicht aufgefallen.“
Narem also. Gleich in zwei Sonderangeboten spielt die nur leicht verschlüsselte Geburts- und Heimatstadt des Schriftstellers Wolfgang Eckert, Jahrgang 1935, eine Rolle. Denn eben dort leben mehrere Generationen der Familie Weidauer – sowohl vor als auch nach der Wende. Und es lohnt sich, die beiden Romane „Familienfoto“ (1982) und „Kinderbaum“ (2015) hintereinander und damit in der richtigen Reihenfolge zu lesen.
Viel Vergnügen beim Lesen, weiter einen schönen Dezember und bleiben auch Sie weiter vor allem schön gesund und munter und bis bald.
Ach, haben Sie eigentlich schon den diesjährigen Adventskalender von EDITION digital, der „Schweriner Volkszeitung“ und Hugendubel am Schweriner Marienplatz gesehen?
EDITION digital war vor 28 Jahren ursprünglich als Verlag für elektronische Publikationen gegründet worden. Inzwischen gibt der Verlag Krimis, historische Romane, Fantasy, Zeitzeugenberichte und Sachbücher (NVA-, DDR-Geschichte) sowie Kinderbücher gedruckt und als E-Book heraus. Ein weiterer Schwerpunkt sind Grafiken und Beschreibungen von historischen Handwerks- und Berufszeichen sowie Belletristik und Sachbücher über Mecklenburg-Vorpommern. Bücher ehemaliger DDR-Autoren werden als E-Book neu aufgelegt. Insgesamt umfasst das Verlagsangebot, das unter www.edition-digital.de nachzulesen ist, mehr als 1.200 Titel. E-Books sind barierefrei und Bücher werden klimaneutral gedruckt.
EDITION digital Pekrul & Sohn GbR
Alte Dorfstraße 2 b
19065 Pinnow
Telefon: +49 (3860) 505788
Telefax: +49 (3860) 505789
http://www.edition-digital.de
Verlagsleiterin
Telefon: +49 (3860) 505788
Fax: +49 (3860) 505789
E-Mail: editiondigital@arcor.de
![]()