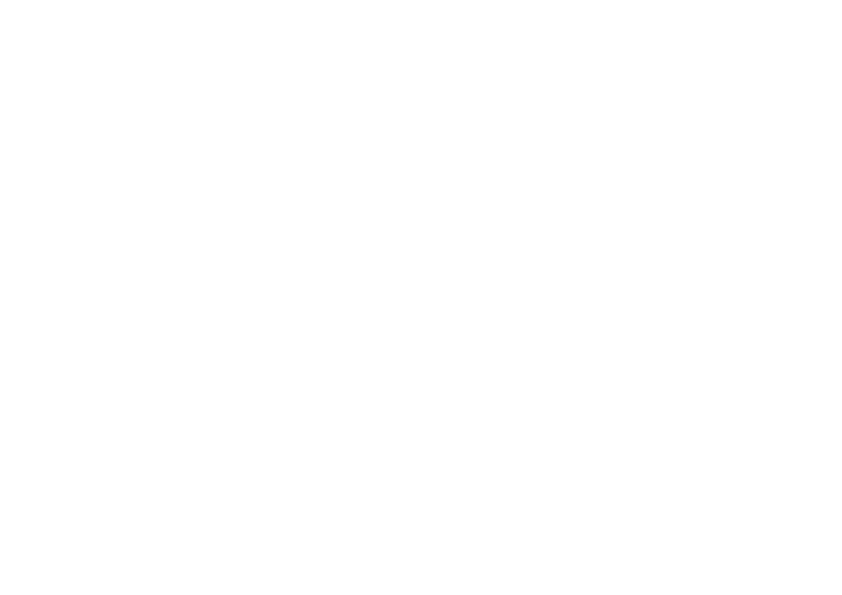Obwohl der Umgang mit der Volksrepublik China zu den Schlüsselfeldern deutscher Politik zählt, verfügt die Bundesrepublik allenfalls über Fragmente einer China-Strategie. Im Koalitionsvertrag zwischen SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP wurde vereinbart, eine solche zu erarbeiten. Ausgangspunkt ist die Einordnung des Umgangs mit der Volksrepublik China entlang den Dimensionen Partnerschaft, Wettbewerb und Systemrivalität – so die Wortwahl im Koalitionsvertrag, welche einer Formulierung der EU-Kommission von 2019 folgt. Darin spiegelt sich ein deutlicher Wandel in der Einschätzung der inneren Entwicklung Chinas, seiner Außenbeziehungen wie auch des deutsch-chinesischen Verhältnisses wider. Dass eine Strategie erst jetzt vorgelegt werden soll, zeigt aber auch die Schwäche deutscher Politik in der Formulierung und Umsetzung von komplexen Politikkonzepten in einem hochdynamischen Umfeld. Das jüngste und durchaus ambitionierte strategische Konzept der Bundesregierung, die 2020 erlassenen Leitlinien zum Indo-Pazifik, kann noch am ehesten als ein chinabezogenes Strategiepapier verstanden werden. Das rund 70 Seiten lange Papier versucht zwar den Eindruck zu vermitteln, es handle sich um eine umfassende, ausdrücklich nicht gegen China gerichteten Strategie. Doch ist das Dokument in all seinen Dimensionen ohne den China factor gar nicht sinnvoll zu verstehen. Es bleibt der Eindruck einer gewissen Scheu, dieses Papier als Teil einer Einhegungsstrategie gegen China interpretiert zu sehen.
Ein differenzierter und realistischer Blick insbesondere auf die Risiken einer immer engeren wirtschaftlichen Verflechtung mit der Volksrepublik China hat in Deutschland, anders als etwa in den USA oder Australien, reichlich spät begonnen. Erst um das Jahr 2015 begann ein Wandel, als mehrere Entwicklungen innerhalb Chinas deutliche Hinweise auf eine fundamentale politische Umorientierung des Landes auch in den Außenbeziehungen gaben. Mit einer weiteren wirtschaftlichen Liberalisierung und Stärkung von privaten Unternehmen war vorerst nicht mehr zu rechnen; im Gegenteil, die Rolle von Staatsunternehmen wurde wieder gestärkt und ebenso der Einfluss der KP auch in der Privatwirtschaft. Die rigiden NGO-Gesetze machten klar, dass eine weitere Pluralisierung der Kontakte mit ausländischen Nichtregierungsorganisation zugunsten einer strikten Kontrolle durch die Partei unterbunden werden sollte. Und Chinas aggressiv vorgetragene Ansprüche im Südchinesischen Meer wurden im wahrsten Sinne des Wortes betoniert, als Vorzeichen geopolitischer Veränderungen.
Die Hoffnung, sich mit der Dreifaltigkeit von „Partner, Wettbewerber und systemischem Rivalen“ einen flexiblen Handlungsraum deutscher (und europäischer) China-Politik schaffen zu können, dürfte sich allerdings als trügerisch erweisen. Denn hier wird doch suggeriert, dass die europäische, insbesondere aber deutsche Politik noch einen erheblichen und eigenständigen Einfluss darauf hätte, wie die bilateralen Beziehungen zu Peking ausgestaltet werden können – und dies gegebenenfalls auch im Widerspruch zu den Vereinigten Staaten, sollten hier Interessengegensätze existieren. Ein solcher Gestaltungsanspruch kann aber nur in engem Verbund mit den anderen Mitgliedsstaaten der EU, den USA und weiteren demokratischen Partnerländern in Asien-Pazifik erreicht werden. Das bedeutet jedoch auch, dass offen über die Kosten verschiedener Handlungsoptionen debattiert werden muss. Davor scheut die deutsche Politik bislang zurück, insbesondere vor einer klaren Positionierung etwa in einem möglichen Konflikt zwischen den USA und China um Taiwan. Darunter leidet im Übrigen die internationale Reputation Deutschlands, gerade auch bei unseren asiatischen Partnerländern.
Eine wesentliche Ursache für die unzureichende strategische Herangehensweise an die Beziehungen zur Volksrepublik liegt darin, dass politisch Verantwortliche und deren beratendes Umfeld sich viel zu lang geweigert haben, eingefahrene politische Wahrnehmungs- und Reaktionsmuster kontinuierlich den sich ändernden Rahmenbedingungen anzupassen. Verhaltensstabilität und Erwartungssicherheit haben Deutschland in den letzten Jahrzehnten zwar zur Recht ein hohes Maß an Vertrauen und internationaler Anerkennung gebracht. Doch könnte diesem ‚Kapital‘ eine rasche Entwertung drohen, wenn zentrale Annahmen über Motive anderer Akteure nicht mehr zutreffen. Die tektonischen Erschütterungen in der deutschen Verteidigungs- und Energiepolitik nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine sind ein lehrreiches Beispiel hierfür. Denn deutsche China-Politik wurde die längste Zeit eindimensional als bilaterale Außenwirtschafts(förderungs)politik betrieben, ohne dass je eine kritische Reflexion über die strategischen, insbesondere sicherheitspolitischen Implikationen von Investitionen in und Handelsbeziehungen mit China stattgefunden hätte. Wie steht die deutsche Politik also zur Volksrepublik China? Welche Optionen und Instrumente stehen uns für eine Fortentwicklung dieser Beziehungen zur Verfügung? Wie müsste eine neue „Verfasstheit“ deutscher China-Politik aussehen?
Dimensionen und Empfehlungen für eine strategische China-Politik Deutschlands
Ausgangspunkt einer strategischen Revision deutscher China-Politik muss zunächst die nüchterne Einsicht sein, dass die bisherigen, bisweilen auch nur eingebildeten Einflussmöglichkeiten auf die inneren Entwicklungsdynamiken der Volksrepublik beinahe vollständig zum Erliegen gekommen sind. Die Geschwindigkeit und das Ausmaß, mit dem sich das Land in den letzten Jahren – und zwar schon vor der Coronapandemie – nach außen hin abgeschlossen hat, kam selbst für viele langjährige Beobachterinnen und Beobachter überraschend. Dies betraf alle Interaktionsebenen, von zunehmend substanzlosen Rechtsstaatsdialogen über die drastische Streichung akademischer Austauschprogramme bis hin zu massiven Devisenkontrollen und komplizierten Gewinnrückführungen für ausländische Unternehmen. Diese Situation ist maßgeblich Teil einer seit dem Amtsantritt Xi Jingpings verschärften ideologisch motivierten Systemrivalität. Dies hat dazu geführt, dass die über mehr als drei Jahrzehnte aufgebauten, vielfältigen Beziehungsnetze zwischen Deutschland und China immer mehr reißen. Die „epistemische Herausforderung“ (Klaus Mühlhahn) mit Blick auf die Volksrepublik wächst von Tag zu Tag, und damit die Gefahr von Fehlwahrnehmungen, Sprachlosigkeit und schrumpfenden Einflussmöglichkeiten.
Diskussionen um die Entwicklung außenpolitischer Strategien finden häufig statt, ohne die zur Verfügung stehenden Ressourcen zu berücksichtigen. Entsprechend vage und politikfern geraten sie oft. Deshalb greifen die folgenden Überlegungen für eine zukünftige deutsche China-Politik ganz konkret zwei Aspekte heraus: (1) die bessere Koordination sowohl zivilgesellschaftlicher als auch staatlicher Chinaexpertise und (2) die europäischen, transatlantischen und pazifischen Dimensionen sowie den deutschen Mangel an strategischem Denken in alternativen Szenarien. Diese Aspekte adressieren eher die Voraussetzungen für strategisches Denken als dieses selbst. Sie gelten aber weit über den Fall Chinas hinaus und sind deshalb von grundsätzliche Bedeutung für die Zukunftsfähigkeit deutscher auswärtiger Politik.
1. Bessere Koordinierung von China-bezogener Expertise und Politikfeldern
Zu der gebetsmühlenartig vorgetragenen Kritik an deutscher China-Politik gehört die Aussage, es mangele in Deutschland an ausreichender China-Expertise. Dies trifft in keiner Weise zu! In den letzten Jahren hat es einen beeindruckenden Zuwachs an hervorragenden, gerade auch jüngeren Expertinnen und Experten an den Universitäten, Thinktanks und Stiftungen gegeben. Deren Vernetzung innerhalb Deutschlands, aber auch mit den europäischen Nachbarländern, hat quantitativ und qualitativ deutlich zugenommen. Allerdings bleibt, verglichen mit der transatlantischen oder allgemein asiatisch-pazifischen Expertise, durchaus noch Raum zu weiterer Verbesserung. Die Herausforderungen in diesem Zusammenhang liegen in Deutschland vor allem in zwei Bereichen:
a) Deutschland und Europa müssen sich eine autonome Wissensinfrastruktur mit Blick auf China erhalten, die vor jeglichen Manipulationsversuchen und externen Abhängigkeiten geschützt werden muss. Diese Gefahr ist erst jüngst im Zusammenhang mit der Diskussion über die Konfuzius-Institute oder der Finanzierung von Thinktanks durch chinesische Institutionen und Unternehmen in ein breiteres Bewusstsein getreten. Das heißt nicht, dass nicht nach wie vor alle Anstrengungen unternommen werden sollten, die ‚große Mauer‘, die das Pekinger Regime selbst um das Land gezogen hat, zu durchbrechen und möglichst vielfältige Austauschkanäle soweit wie möglich offen zu halten. Nur muss dies deutlich kritischer geschehen als bisher, an klar definierten und kommunizierten eigenen Interessen orientiert und mit deutlichen roten Linien versehen sein. Jegliche Form von (Selbst-)Zensur chinabezogener Lehre und Forschung muss klar unterbunden werden. Bei der Auswahl von Studierenden und Forschenden für Austauschprogramme und zu besetzende Stellen sollte weniger die Zahl als vielmehr Persönlichkeit, Offenheit und ehrliche Dialogbereitschaft (jenseits einer rein fachlichen Qualifikation) zentrales Auswahlkriterium für Bewerberinnen und Bewerber sein. Auch sollte die Ausbildung eigener China-bezogener Expertise in Deutschland gezielter gefördert werden.
b) Die größere Schwäche deutscher China-Politik liegt nach wie vor in deren institutioneller Fragmentierung. Hier hat es in den letzten Jahren Fortschritte gegeben, etwa durch die Einrichtung eines Referates „Politische Ordnungsmodelle und wehrhafte Demokratie“ im Bundesministerium des Innern, das die interministerielle Koordination chinabezogener Politiken verbessern soll. Dieser Ansatz zielt gegenwärtig aber im Wesentlichen auf eine bessere horizontale Koordination. Mit den verstärkten Aktivitäten chinesischer Unternehmen auf kommunaler Ebene stellen sich vergleichbare Herausforderungen aber auf allen Ebenen unseres politischen und administrativen Systems. Eine bessere vertikale Koordination und Kompetenzbildung ist deshalb ein nächster, überfälliger Schritt. Das muss nicht als top-down-Ansatz geschehen, wie etwa durch ein systematisches Investmentscreening. Ein verbesserter interkommunaler Erfahrungsaustausch mag oft hilfreicher für die Gemeinden sein. Deutschland kann hier von umfangreichen Erfahrungen in Australien oder Taiwan lernen. Die damit einhergehenden vielfältigen Möglichkeiten der Einflussnahme staatlicher und „privater“ chinesischer Akteure in den politischen Bereich sollten ferner ein Anlass sein, die – nicht nur aus diesem Grunde notwendigen – Anstrengungen für eine größere Transparenz im Bereich des Lobbyismus gerade ausländischer Akteure zu verstärken, sowohl auf Bundes-, als auch auf Landes- und sogar auf Kommunalebene.
2. Europäische, transatlantische und pazifische Dimensionen
Am Ausgangspunkt jeder Strategieentwicklung muss die Einsicht stehen, dass der Handlungsspielraum einer eigenständigen deutschen und europäischen China-Politik seit Jahren schrumpft. Ein Papier der Stiftung Wissenschaft und Politik stellt fest: „Europa hat keine belastbare außenpolitische Position im geopolitischen Ringen Amerikas und Chinas um die Hegemonie im asiatisch-pazifischen Raum“1 – und das gilt nicht nur dort. Fortschritte im Bereich der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) der Europäischen Union bleiben strategisch und operativ hinter den Anforderungen eines hochdynamischen, konfliktträchtigen und maßgeblich durch China bestimmten Umfeldes zurück, sowohl im Nahbereich der östlichen und südlichen Nachbarschaft wie gerade auch East of Aden. Die Interessengegensätze innerhalb der EU mit Blick auf China bleiben erheblich. Und der Vorwurf der anderen europäischen Partnerländer, dass Deutschland aufgrund seiner außergewöhnlich hohen wirtschaftlichen Verflechtung oft eine zuvor deutliche Position der Union verwässert hat, ist sicherlich nicht ganz von der Hand zu weisen. Gleichwohl sind in den letzten Monaten klar erkennbare Fortschritte auf der Ebene der EU erzielt worden, etwa bei der Sanktionierung von Verstößen gegen die Menschenrechte („EU-Magnitski-Gesetz“) oder die Eröffnung eines Verfahrens vor der WTO wegen des Vorgehens Chinas gegenüber Litauen in der Taiwan-Frage. Dies zeigt, dass der außenpolitische Handlungswillen der EU wächst.
Das gilt auch für das Vereinigte Königreich. Es wäre sinnvoll, würde Deutschland – als Schlüsselstaat der EU – die enge Abstimmung auch mit diesem Partner in der China-Politik aktiver suchen. Offene Handelsfragen zwischen Großbritannien und der EU infolge des Brexit dürfen das gemeinsame strategische Interesse gegenüber China nicht verdecken.
Grundsätzlich dürfte die Zeit weitreichender Vereinbarungen zwischen Deutschland und China, wie etwa die „umfassende strategische Partnerschaft“ aus dem Jahr 2014, vorerst zu Ende sein. Der letzte große Versuch eines vergleichsweise weitreichenden Abkommens, das EU-China Comprehensive Agreement on Investment (CAI), hat wohl kaum mehr Chancen auf eine Ratifizierung durch das Europäische Parlament, nicht zuletzt wegen des Verhaltens der Volksrepublik im Ukraine-Krieg. Es würde wohl auch keinen wesentlichen Beitrag mehr zu einer Verbesserung des gegenseitigen Verhältnisses leisten, da wesentliche Konfliktelemente außerhalb der ökonomischen Sphäre liegen und dadurch nicht beseitigt würden.
Die transatlantischen Beziehungen sind auch nach dem Amtsantritt von US-Präsident Joe Biden in Bezug auf die Volksrepublik keineswegs konfliktfrei. Zum einen werden sich die US-China-Beziehungen in den nächsten Jahren nicht substanziell verbessern; bestehende Konfliktfelder lassen sich im besten Fall moderieren, aber nicht auflösen. Mit ‚Kollateralschäden‘ für Europa ist deshalb immer zu rechnen. Umso wichtiger ist es, dass Deutschland und Europa klar ihre eigenen Interessen definieren, diese gegenüber beiden Großmächten USA und China deutlich markieren und gegebenenfalls auch Konflikte durchzuhalten in der Lage sind.
An erster Stelle geht es im transatlantischen Verhältnis darum, eine gemeinsame westliche Positionierung in ordnungs- und sicherheitspolitischen Fragen gegenüber China zu erreichen. Der laufende NATO-Strategieprozess und der im März 2022 verabschiedete Strategische Kompass der EU sind ein deutlicher konzeptioneller Fortschritt, weil Europa seine eigenen strategischen und operativen Handlungsspielräume massiv ausweiten möchte und damit auch langjährigen Forderungen der USA nachkommt. Zugleich wird die Bedeutung asiatisch-pazifischer Partner, etwa von ASEAN, hervorgehoben, was ebenfalls im Interesse der Vereinigten Staaten liegt.
Der Krieg in der Ukraine hat einen unerwarteten Quantensprung in der strategischen Kultur Europas und Deutschlands bewirkt. Das wird sich auch positiv auf eine Reihe von transatlantischen, nichtmilitärischen Kooperationsfeldern auswirken, etwa bei der Entwicklung von Hochtechnologien und der Resilienz von Lieferketten, aber auch bei Klimaschutz und der Durchsetzung von Standards und Normen. Alle diese Felder sind essentiell im geopolitischen Wettbewerb und setzen eine engere Koordination im Kreise der demokratischen Staaten (Alliance for Democracy) voraus. Der 2021 etablierte EU-US Trade and Technology Council könnte hierfür eine Blaupause abgeben. Doch bergen die genannten Felder gleichzeitig auch ein erhebliches Konfliktpotential mit unseren Partnern, übrigens auch im indo-pazifischen Raum. Denn konzeptionelle Unterschiede, etwa in der Digitalwirtschaft mit Blick auf den Datenschutz oder bei sozialen und ökologischen Mindeststandards, sind immer noch erheblich.
3. Strategischer Weitblick und Denken in alternativen Szenarien
Ein Mangel an Phantasie und Mut in der deutschen Außenpolitik würde der etablierten chinesischen Linie in die Hände spielen. Die Verführungskraft des offiziellen Narrativs der Kommunistischen Partei Chinas zur Überlegenheit und angebliche Alternativlosigkeit des eigenen Politikmodells ist hoch und wird nach innen wie außen als herrschaftsstabilisierende Ressource eingesetzt. Die Furcht vor politischer Instabilität im Falle eines Regimewechsels kann aber wie auch im Falle Russlands kein Argument sein, keine Kontakte zu einem „anderen China“ zu suchen. Innerhalb und außerhalb der Volksrepublik gibt es Intellektuelle, Künstler und Unternehmer, die für ein anderes, offenes und liberales China stehen. Wir sollten diesen Stimmen Raum und Gehör schenken. Natürlich sollte man auch mit dem bestehenden Regime nach gemeinsamen Ansatzpunkten zu suchen, um globale Herausforderungen anzugehen. Die vielfach erwähnte Zusammenarbeit in Feldern wie Klimaschutz und globale Standards und Normen ist allerdings zweischneidig. Denn China ist immer auch Wettbewerber. Nur eine einheitliche Position der EU, besser noch zusammen mit den transatlantischen und weiteren like-minded-Partnern, bietet Aussicht auf eine Kooperation mit reziprokem Nutzen.
Angesichts eines massiven Zuwachses an soft power-Aktivitäten durch Peking2 muss Deutschland sich auf die Stärken seines vielfältigen Instrumentenkastens in den auswärtigen Beziehungen besinnen. China-Politik geht, wie erwähnt, weit über die klassische bilaterale Beziehungsarbeit hinaus und ist ein integraler Bestandteil aller Politikfelder. Als Antwort hierauf sind in den letzten Jahren in Deutschland eine Reihe von nichtstaatlichen Initiativen und Gesprächsrunden, zum Beispiel beim Mercator Institute for China Studies (MERICS) und bei den politischen Stiftungen entstanden, die einen erheblichen Zuwachs an Ein-sichten in die Mechanismen chinesischer Politik im In- und Ausland erbracht haben.
Grundsätzlich ist Deutschland durch die Vielfalt seiner staatlichen und privaten (Mittler)Organisationen und deren jahrzehntelange Erfahrung und globale Präsenz gut aufgestellt, wenn es um die Vermittlung von demokratischen Werten und den Aufbau gleichberechtigter Beziehungen mit Partnernationen geht. Verbesserungswürdig bleibt eine engere Bindung an klar definierte politische Ziele Deutschlands. Dazu ist ein stärkerer Austausch zwischen den deutschen Mittlerorganisationen im Ausland erforderlich. Denn diese sind gerade auch in Drittstaaten mit einer immer stärkeren Konkurrenz durch chinesische Einflüsse konfrontiert, sei es auf dem Feld der Parteienkooperation oder der Journalismus-Ausbildung.
Und zuletzt: Wer über China-Strategien spricht, darf von Taiwan nicht schweigen. Aus geopolitischen, demokratiepolitischen und auch wirtschaftlichen Gründen sollte die deutsche Politik ihre extreme Zurückhaltung gegenüber intensiveren Beziehungen zur Inselrepublik aufgeben. Hier bestehen deutlich mehr Möglichkeiten zur Kooperation, ohne damit sofort das Prinzip der Ein-China-Politik zu verletzen. Neben wirtschaftlichen Kooperationen, zum Beispiel in der Innovations- und Energiepolitik, bleiben der wissenschaftliche Austausch, aber auch etwa das Feld Cybersicherheit, deutlich ausbaufähig. Die ‚chinesische Welt‘ ist deutlich größer als es die bisherige deutsche Chinapolitik wahrhaben möchte. Mehr Realitätssinn und mehr Phantasie schließen sich deshalb nicht immer gegenseitig aus, sondern erweitern – klug betrieben – politische Handlungsspielräume.
Dr. Peter Hefele ist seit 2022 Policy Director des Wilfried Martens Centre for European Studies (WMCES) in Brüssel. Zuvor war er Leiter der Asien-Pazifik-Abteilung der Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) und Büroleiter der KAS in Shanghai und Hongkong SAR. Der Autor gibt seine persönliche Meinung wieder.
[1] Lippert/von Ondarza/Perthes (Hrsg.) (2019): Strategische Autonomie Europas: Akteure, Handlungsfelder, Zielkonflikte (Berlin: Stiftung Wissenschaft und Politik), eingesehen am 10.02.2022, S. 32-33.
[2] Siehe zum Beispiel Dams/Martin/Kranenburg (Hrsg.) mit Seaman/Julienne (2021): China’s Soft Power in Europe: Falling on Hard Times. A report of the European Think-tank Network on China (Paris: Institut français des relations internationales), eingesehen am 10.02.2022.
Alle Ausgaben der Arbeitspapiere Sicherheitspolitik sind verfügbar auf:
www.baks.bund.de/de/service/arbeitspapiere-sicherheitspolitik
Bundesakademie für Sicherheitspolitik
Ossietzkystr. 44-45
13187 Berlin
Telefon: +49 (30) 40046-420
Telefax: +49 (30) 40046-421
http://www.baks.bund.de
Telefon: +49 (30) 40046-415
E-Mail: presse@baks.bund.de
![]()