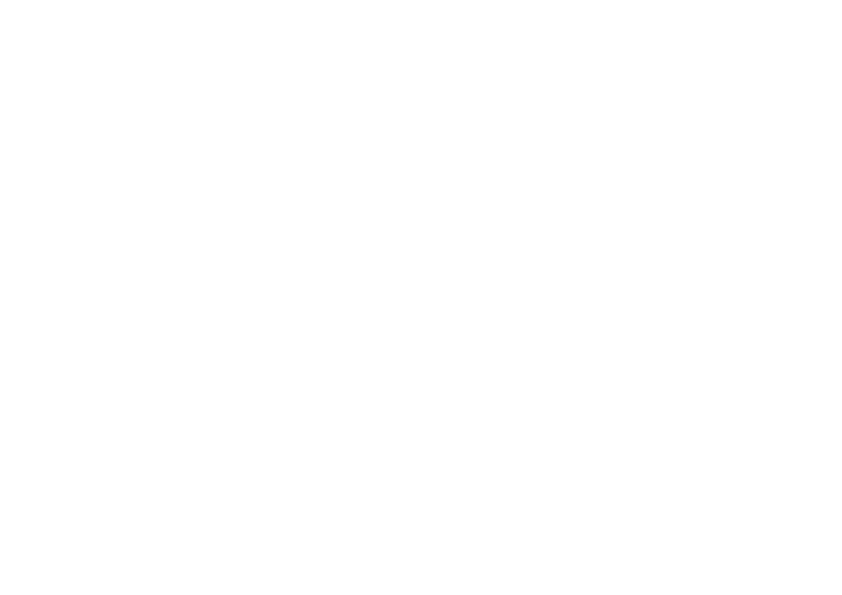Ein Mann ist in einer Kutsche zu der Stadt seiner Sehnsucht unterwegs. Sein Name ist Forster, Georg Forster. So beginnt die Erzählung „Forster in Paris“ von Erik Neutsch.
Von einer ganz anderen Reise lesen wir in „Bei den Schmetterlingen in Surinam“ von Ingrid Möller.
Das vielleicht raffinierteste literarische Angebot dieser Ausgabe liefert „Der Geist des Nasreddin Effendi“ von Alexander Kröger, in dem es auch um den Eulenspiegel des Orients geht, aber nicht nur, sondern auch um ein gewagtes Experiment.
Und damit sind wir wieder beim aktuellen Beitrag der Rubrik Fridays for Future angelangt. Jede Woche wird an dieser Stelle jeweils ein Buch vorgestellt, das im weitesten Sinne mit den Themen Klima, Umwelt und Frieden zu tun hat – also mit den ganz großen Themen der Erde und dieser Zeit. Heute geht es um das oft schwierige Verhältnis zwischen Deutschland und Polen, nicht zuletzt während des zweiten Weltkriegs, als viele Polen unter den deutschen Besatzern zu leiden hatten. Was war damals genau passiert? Und wie hat es sich nach dem Ende des Krieges entwickelt? Nach den Schrecken des Krieges schien eine Zeit des Friedens und der Freundschaft gekommen, in der in Polen wie in der DDR ein gleiches Gesellschaftsideal angestrebt wurde. Vordringlichstes Ziel war eine friedliche Welt.
Erstmals 1976 veröffentlichte Egon Richter im damaligen VEB Hinstorff Verlag Rostock „Eine Stadt und zehn Gesichter“: Egon Richter schrieb über die große Hafenstadt Szczecin (Stettin): Stadtarchitekten, Hochseefischer, Werftingenieure, Arbeiter, Direktoren, Kunstmaler, Gelehrte, Taxifahrer, Polizisten, leichte Mädchen – ihre Erlebnisse, Probleme, eingebettet in die Geschichte der Stadt seit 1945 und die Erlebnisse der polnischen Bewohner unter der deutschen Besatzung. Sein Buch beginnt mit einer fast philosophischen Einleitung zu einem wichtigen Thema, obwohl dieses es gerade in dieser Wissenschaft offenbar schwer hatte, wie wir gleich bemerken werden:
„Erinnerungen
Zuerst habe ich nicht für möglich halten wollen, was sich nach eifrigem Forschen als unabänderliche Wahrheit darzustellen schien: es gibt keine Erinnerung.
In der kontinuierlichen bunten Zeilenfolge unseres Jugendlexikons klafft zwischen „Ergussgestein“ und „Erkältungskrankheiten“ keine Lücke, in welcher die „Erinnerung“ hätte auftauchen können. Die Jugend also hat keine Erinnerungen – oder sie bedarf ihrer nicht.
Was ist Erinnerung?
In philosophischen Wörterbüchern unterschiedlichen Umfangs findet sich keine Erklärung. Erinnerung fehlt. Die Philosophie nimmt sich ihrer nicht an. Sie scheint demnach unvereinbar mit exakter Wissenschaft zu sein, nicht einzuordnen in funktionstüchtige Kataloge und Systeme; etwas Diffuses also, Unzuverlässiges, Unerklärbares.
Was ist Erinnerung?
Die großen Rechtschreibwerke machen es sich einfach. Sie definieren das Wort lediglich als weiblich: Erinnerung Komma femininum Strich die. Sie begründen nichts, sie erklären nichts, dazu sind sie nicht da: sprachliche Objektivität. Erinnerung ist weiblich, das genügt. Jedoch, da findet sich ein Nachsatz in jedem guten Sprachführer: Doppelpunkt Ordnungsbuchstabe a Klammer sich erinnern Ordnungsbuchstabe b Klammer jemanden erinnern. Ende der Aussage. Zumindest die Dubiosität dieses Begriffsphänomens ist deutlich ausgesprochen, wenn das Verlangen nach Erklärung auch unbefriedigt bleibt.
An diesem Punkte mangelhafter Erkenntnis angelangt, bin ich geneigt zu sagen: Mir fehlt jede Erinnerung. Denn wenn, sage ich mir, dieser Begriff nur als inhaltloses sprachliches Etwas existiert, wenn er nicht wissenschaftlich katalogisiert werden kann und demnach höchst obskur ist, wie wir gern zu sagen bereit sind (obskur – dunkel, unbekannt, unberühmt), dann bin ich weder verpflichtet noch imstande, mich seiner als sachlicher Kategorie zu bedienen: Also, ich habe keine Erinnerung an die Stadt, um die es im folgenden gehen wird.
Dieser Zustand verursacht Unbehagen: Ein Mensch ohne Erinnerung fühlt sich wie Chamissos Schlemihl ohne Schatten.
Dank sei dem Zufall, den es, wissenschaftlich betrachtet, auch nicht gibt und der mir jenes fünfzehn Jahre alte Dünndruck-Lexikon in die Hände spielte, welches mich aus dem schattenlosen Vakuum zurückriss auf den Boden konkreter Begriffsbestimmung: Damals gab es noch Erinnerung.
Mein Gott, welche Offenbarung: Erinnerung Doppelpunkt Reproduktion früherer Bewusstseinsinhalte oder Erlebnisse durch das Gedächtnis mit dem Bewusstsein Komma diese schon einmal gehabt zu haben. Das muss man ganz auskosten.
Aber es ist schön, dass da von „Bewusstseinsinhalten“ oder „Erlebnissen“ die Rede ist, denn manches, was mich an die Stadt erinnert, von der bald zu berichten sein wird, ist weniger mit Erlebnissen als viel mehr mit Wissen, Kenntnissen und Erfahrungen verknüpft, die durch andere Einflüsse möglich geworden sind. Erlebnisse dagegen, wenn auch verfärbt oder verklärt durch die Jahrzehnte, frühere und „reproduzierbar“ gewordene Erlebnisse mit oder in der erwähnten Stadt sind außerordentlich gering.“ Und damit zu den ausführlicheren Vorstellungen der anderen vier Sonderangebote dieses Newsletters:
Erstmals 2006 erschien im Wiesenburg Verlag Schweinfurt „Das Liebespaar vom Körnerplatz“ von Jutta Schlott: Ein getrenntes Paar trifft unvermutet aufeinander, eine Journalistin reist in den Irak, ein Mädchen sucht nach seiner Mutter, die es nie kennengelernt hat, eine junge Frau versucht, eine Umwelt-Bibliothek aufzubauen und stößt auf Schwierigkeiten. Jutta Schlott erzählt Alltagsgeschichten, die oft eine überraschende Wendung nehmen. Ohne Sensationshascherei, aber spannend und mit leisem Humor stehen diese Erzählungen vor dem politischen Hintergrund der Neunzigerjahre bis in unsere Gegenwart. Hier der Beginn der Geschichte, die zugleich den Titel für das gesamte Buch liefert:
„DAS LIEBESPAAR VOM KÖRNERPLATZ
Durch den nachträglichen Bau einer Hochgarage Mitte der neunziger Jahre entstanden aus der großen Freifläche im Ziolkowskij-Ring zwei Innenhöfe, jeweils von einem Elfgeschosser und fünfstöckigen Wohnblöcken begrenzt.
Etwa zur gleichen Zeit wurden auf dem Gelände der ehemaligen Russenkaserne, um Baufreiheit zu schaffen, drei riesige Pappeln gefällt. Der Krähenschwarm, der die Kronen der Bäume besetzt hatte, suchte sich neue Stammplätze und siedelte auf das Dach der Hochgarage über. Die Vögel partizipierten von den Resten weggeworfener Brötchen und Pommes frites. Die Krähen ließen sich durch Passanten oder bolzende Halbwüchsige nicht davon abhalten, die Papierkörbe des Innenhofes zu inspizieren. Henriette Sternberg, den heißen Kaffeebecher zwischen beiden Händen, stieß die Balkontür auf und zündete sich ihre Morgenzigarette an. Seit zwei Jahren versuchte sie, nur noch auf dem Balkon zu rauchen, um die Kinder nicht zusätzlich zum Qualmen zu animieren.
In der Morgendämmerang war die Luft feucht und mild, sie ließ den Herbst schon ahnen. Die Birken ließen lautlos gelbe Blättchen fallen. Die Dolden der Eberesche leuchteten korallenrot.
Vom vierten Stock des Wohnblocks hatte man freien Blick über das umbaute Viereck. Im Hochhaus brannte noch das Nachtlicht auf den Treppenfluren und äußeren Umgängen. Das Karree lag menschenleer. Henriette seufzte: Alle Rentner, alle Arbeitslosen, alle Asylanten schlafen noch.
Der Motor eines Mopeds jaulte auf. Ein junges Mädchen in schwarzen Klamotten, mit lila gefärbten Haaren raste quer über den Spielplatz. Sie umkurvte die Müllcontainer und preschte auf dem Fahrradweg zwischen zwei Wohnblöcken davon. Ein paar Saatkrähen, pechschwarz wie der Dress des Mädchens, stoben auf.
Die Black Angels vom Großen Laasch, dachte Henriette und drückte die Zigarette aus.
Als sie die Balkontür aufstieß, schnellte die Tür zurück. Der Rahmen schlug gegen die Tasse. Wie in Zeitlupe sah die Frau, dass zuerst das Gefäß vom Henkel absprang und sich in zwei symmetrische Hälften teilte, die innen auf den Spannteppich fielen. Die Scherbe mit dem Henkel blieb in ihrer Hand. Ein merkwürdiger, irritierend geräuschloser Vorgang.
Die Sonne würde am 26. August um sechs Uhr dreißig aufgehen, in ungefähr zwanzig Minuten, entnahm Henriette Sternberg dem allmorgendlichen Blick auf den Tageskalender. Er empfahl, frische Fettflecke mit Kartoffelstärke zu bestreuen und mittags gefüllte Paprikaschoten mit Naturreis zuzubereiten. Sie zerknüllte das Blatt und warf es in den Papierkorb.
Wie jeden Morgen legte sie ihr Bettzeug auf der Couch zusammen, verstaute es im dafür vorgesehenen Kasten und klappte das Möbel in Sitzposition. Die Kinder hatten am Abend Teller und Besteck stehen lassen. Henriette räumte das Geschirr in den Spüler und legte zweimal vier Euro auf den Küchentisch. Damit müssten die beiden, auch wenn sie sich nicht selber etwas zu essen machten, über den Tag kommen.
Vorsichtig öffnete Henriette die Tür zu Konrads Zimmer. Ein Poster mit Madonna, einer Sängerin, die seine Großmutter sein könnte, klebte an der Zimmertür. Die Gitarre lehnte am Regal mit Büchern und CDs. Der Vierzehnjährige hatte sich die Decke über den Kopf gezogen, nur die dunklen Haare fielen in Strähnen auf das Kissen. Am Fußende des Bettes verknäuelten sich mehrere Paar Schuhe.
Auf dem Bildschirm des Computers trugen massige Elche in Endlosschleife ihre schweren Schaufeln hintereinander her. Henriette kontrollierte den Wecker.
Die Tür zu Katarinas Zimmer ließ sich nur mit Mühe öffnen. Ein Berg aus Büchern, Zeitschriften, Kuscheltieren und Klamotten türmte sich auf dem Boden. Es sah aus, als hätte jemand den gesamten Inhalt des Kleiderschrankes und der Regale auf den Boden gekippt. Das Mädchen lag bäuchlings in voller Montur auf der Liege. Die Ohren hatte sie sich mit den Enden eines In-Ear-Hörers zugestöpselt. Die zerlatschten Sandalen hingen an ihren Füßen.
Den Impuls, die Tochter wach zu rütteln und sie wegen des chaotischen Zustands ihres Zimmers zur Rechenschaft zu ziehen, konnte Henriette im letzten Moment bremsen. Sinnlos.
Wenigstens den Wecker hatte Katarina auf kurz vor sieben gestellt. Henriette atmete durch. Ob die Tochter, wenn sie morgens das Haus verließ, wirklich immer den Weg zur Schule einschlug, dessen war sie sich durchaus nicht sicher.
Als ich sechzehn war, dachte die fast Vierzigjährige und brach den Gedanken ab – Schnee von vorvorgestern!
Im Flur kontrollierte Henriette ihren Rucksack. Handy, Portemonnaie, Kalender, Schlüsselbund. Sie zog die Wohnungstür hinter sich ins Schloss, sprang mehrere Stufen auf einmal nehmend, die Treppen nach unten und wuchtete ihr Mountainbike aus dem Fahrradkeller.
Vor dem Hauseingang lagen Prospekte mit Werbung und die kostenlosen Anzeigenblätter auf dem Boden. Das Tageshoroskop für die im Sternkreis des Skorpions Geborenen verkündete Henriette, dass ihre Ansprüche hoch, sehr hoch seien und dass sie es besser in den Griff kriegen solle – fett gedruckt – ganz entspannt in Hier und Jetzt zu sein. Trotzdem sei das Leben für sie leicht und unkompliziert.
Na danke, sagte sie laut. Sie stopfte die Zeitung in den Papierkorb, zog den Reißverschluss der Jacke zu und fuhr in schnellem Tempo Richtung Innenstadt.“
Erstmals 1981 veröffentlichte Erik Neutsch im Mitteldeutscher Verlag Halle (Saale) seine Erzählung „Forster in Paris“, die auf Wunsch des Autors nicht auf neue Rechtschreibung umgestellt wurde: Ein Mann, einsam im Paris des Jahres 1793. Verlassen von Freunden, verlassen vor allem von seiner Frau Therese, die ihm einen anderen vorgezogen hat, getrennt von den geliebten Kindern, ohne Einkünfte, von tödlicher Krankheit gezeichnet, der Mann Georg Forster, Weltreisender, Naturforscher, Deputierter der Mainzer Republik im Pariser Konvent.
Erik Neutsch zeichnet die letzten Lebensmonate dieses Revolutionärs und in ihnen zugleich die Geschichte dieser ereignisreichen Biografie. Aus Briefen, Dokumenten, zeitgenössischen Aussagen wird deutlich, wie da ein Mann das einmal als richtig Erkannte auch in schwierigen Zeiten nicht aufgibt, wie er nicht in die Leiden seiner persönlichen Konflikte versinkt, sondern mit dem Blick auf seine und die künftigen Feinde der Revolution noch auf dem Sterbebett schreibt: „Paris ist immer unsere Karte, und ihr habt verloren!“ Hier der Anfang der Erzählung, die in einer Kutsche beginnt:
„ERSTES KAPITEL
Wenn wir jung sind, meinen wir immer: das oder nichts; und werden wir älter und bekommen das nicht, was wir eigensinnig verlangten, so behelfen wir uns doch.
[*]11. 1793
Am Sechsten des Monats Frimaire kam Forster von Pontarlier. Er saß in einer nach südlicher Art breit und bequem gebauten Kutsche, die gut noch für drei oder vier Personen Platz gehabt hätte: für Therese, die beiden Töchter und – Huber. Aber er fuhr allein. Des wiederholten Wartens müde, hatte er endlich in Troyes die Extrapost genommen, die ihm in seiner Eigenschaft als Gesandtem des Konvents ohnehin zustand.
Er konnte nur hoffen, nicht mehr, aber auch nicht weniger tun als das, was ihm seit Jahren nun schon zur Gewohnheit geworden war, spätestens seit der Abreise Thereses von Mainz, die einer Flucht geglichen hatte. Auch die Tage im Val de Travers, wo er noch einmal sein Glück zu zwingen versucht hatte, verschwammen, verdunkelten sich. Zerschmolz die Erinnerung? Nein, natürlich nicht. Nur überwog jetzt die Bitterkeit; die Freude über das lang entbehrte, heftig ersehnte Wiedersehen erlosch. Die Erinnerung drückte ihn nieder. Mit dem Abstand von heute lag sie auf seinem Kopf wie eine Last, so, als wollten sich nachträglich die Enttäuschungen rächen, die kalten und kargen, verregneten, bleich von Nebeln umhüllten Berge des Juramassivs über ihn stürzen und seinen Mut verschütten. Er spürte die Brust sich verkrampfen. Er war Mediziner genug, um zu wissen, daß es von diesem scheußlichen Rheuma herrührte, das er sich unter den Segeln Cooks in den eisigen Stürmen des Südkontinents geholt hatte.
Ein Leben zu dritt… Dieser Gedanke aber, fest in ihm eingeprägt nach zahllos durchwachten Nächten, wollte ihm nicht aus dem Sinn. Therese und Huber hatten ja auch versprochen, ihm nach Paris zu folgen. Es war in den Wiesen gewesen, die verwelkt lagen und kahl, unterm bedeckten Himmel in ein merkwürdig gelbes, sehr müdes Licht getaucht. Oder geschah es nicht doch im Hotel de l’Ours, dem stillen Gasthof zum Bären im Hain der Nußbäume? Abends, gewiß, als sie sich am offenen Feuer die fröstelnden Glieder wärmten und Rotwein tranken, die Kinder schon schliefen. Röschen und Claire. Er trug sie ins Bett. Sie drängten sich an ihn, und ob sie wohl ahnten, was war? Er hatte sie geküßt und getröstet, daß die Trennung nun bald ein Ende nähme. Seht eure Mutter. Sie weint und wird uns vereinen.
Paris, Polarstern der Republik, du heilige Weltstadt, dir entgegen, meinem Paris. Zum letzten Mal waren die Pferde gewechselt worden. Seit dem frühen Aufbruch im Morgengrauen hatte er kaum noch etwas gegessen. Es trieb ihn zur Eile. Der rheumatische Schmerz in der Brust. Ein Viertelpfund Brot – es müßte genügen. Viel zu oft schon hatte er unterwegs wegen des Übelseins Nachtlager halten müssen. Er zog den Vorhang am Fenster zurück und sah an den mächtigen Buchen und den verstreut umherliegenden rundgeschliffenen Felsblöcken, daß er sich in den Wäldern um Fontainebleau befand.
Er gab dem Kutscher ein Zeichen. Schneller, schneller. Allez, Postillon, allez! Sein Ruf erstickte im Husten.
Alle Bemühungen waren gescheitert. Auch darunter litt er. Seine Versuche, Bittgänge, Beschwörungen in der Munizipalitat von Pontarlier, Thereses Wünschen gemäß, ihr auf französischem Boden und nach französischen Gesetzen die Scheidung von ihm zu ermöglichen, hatten nichts eingebracht. Selbst ihr Gönner, der schleimige und nach seiner Ansicht noch immer den Royalisten verbundene Rougemont in Neuchâtel, wußte daraufhin keinen Rat mehr. Nun schrieb sie, sie wolle doch in der Schweiz bleiben und übersiedeln in das weniger bigotte Zürich. Mehr als ihr aber traute er Huber diesen Plan zu. Doch wenn er sich irrte? Wenn Caroline mit ihrer Verachtung für ihn schon damals in Mainz zu ihrem Recht kam? Ach, dachte er, die Notwendigkeit der Umstände, die so sehr in die großen Weltbegebenheiten verwebt sind – sie wird uns Gesetz, dem wir uns nicht entziehen, gegen das wir nicht anstreben können. Lächerlich ist natürlich, daß ein so unendlich Kleines wie das Schicksal von ein paar ganz unbedeutenden Privatpersonen davon abhängt. Aber wir müssen uns beugen. Zwar rechnen wir dabei auf die glücklichen Würfe, doch sollten wir nicht auch das rechnen, was widrig sein kann? Wenn wir die Asse bekommen, wollen wir unsrer Besorgnis lachen. Bleiben sie aus, so müssen wir uns noch übrig bleiben.
Ein Träumer war Forster nicht.
Und war er denn abhängig von seiner Frau?
Das ganze Deutschland mitsamt seinen Bütteln und Narren konnte ihm inzwischen den Buckel herunterrutschen, jedes kleine und kleinste, stücklige, bröcklige Fürstentum einzeln. Ein Preis von hundert Dukaten war ausgesetzt worden, um seiner habhaft zu werden. Er hatte geantwortet: Der arme Schelm von einem General, da er nicht besser zu schätzen weiß, was so ein Kopf wert ist. Ich gebe keine sechs Kreuzer für den des Generals… Er lachte. He, Kutscher, he! Peitsch deine Pferde …
Ja, er sehnte sich nach Paris. Seit Anfang August – und der kurze Aufenthalt zwischen seinen Reisen nach Arras und dieser hier, beide im Regierungsauftrag, zählte wohl nicht – hatte er die Stadt nicht mehr gesehen. Zuletzt war ihm die Stelle eines Bibliothekars angeboten worden. Er rechnete mit einer Einkunft von 6000 Livres und hoffte, auch für Huber etwas Passendes zu finden. Davon könnten sie ordentlich leben. Er hätte wieder die Kinder um sich, Therese… Doch bei ihrem Namen wurde ihm kalt. Er wickelte fest die Decke um sich. Er entsann sich, was er einmal einem Freund – Lichtenberg wohl, vor einem Jahr oder länger – geschrieben hatte, und es war doch auch damals schon eine Ewigkeit her gewesen, seit seiner Rückkehr aus Flandern, Brabant und England: Ich fühle mich erstorbener, als ich’s sollte; wie eine Pflanze, die vom Frost gerührt ist und sich nicht wieder erholen kann.
Die beiden Letztgeborenen waren von Krankheiten bald hinweggerafft worden, der Sohn von den Blattern. Warum gerade hier diese Verkettung, hier diese Schläge? Sollte es nicht wie eine Warnung geklungen haben? Ach Therese, liebes Kind, mein Mädchen! Erinnerst du dich, wie ich zum ersten Mal Gast deines Vaters war und dir den Stoff von buntem Bast aus Otahaiti schenkte? Nein, er zweifelte nicht, daß es ihm niemals gelingen würde, ihr Bild aus seinen Gehirnfasern zu reißen, aus dem heißen Lavastrom seiner Gedanken. Ihre Gestalt und mehr noch ihr Wesen… Zwar hatte er sich tausendmal dran gerieben, sie aber auch tausendmal während ihrer Ehe genossen. Nun rückte seine Frau ihm wieder ganz nahe. Er wähnte, sie in den Armen zu halten, ihre Stimme zu hören, den Atem von ihren Lippen zu trinken. Vielleicht lag es am Fieber, das ihn erhitzte. Aber wäre er denn gereist wenn er geahnt hätte, was ihn in jenem Dorf, im Wirtshaus de I’Ours erwartet hatte?
Die Sonne, selten genug in diesen Novembertagen, brach aus den Wolken und versank hinter den Hügeln. Rotrot war ihr Widerschein. Die Seine verbarg sich hinter buschigen Ufern. Hohe Pappeln, deren kahles Gezweig von Misteln dicht bewuchert war, stachen in den Himmel, und da auch kein Windhauch sie bewegte, stimmten sie die Landschaft seltsam starr und traurig. Schon das Laub in den Weinbergen der Champagne hatte nicht mehr gefunkelt wie vor Wochen.
Braun war es und schwarz, von Feuchtigkeit vollgesaugt. In der Luft schwebte der fette Geruch der Vermoderung. Die Natur starb. Darüber konnte auch nicht das rosige Flimmern hinwegtäuschen, mit dem sich das Abendlicht jetzt über den Fluß goß. Der Weg wurde steinig und holprig. Die Räder knarrten, und Forster lehnte sich tief ins Polster zurück. Er stellte sich vor, seine Töchter säßen mit ihm im Wagen. Ahnen würden sie wohl, fürchten ja, doch um zu begreifen, waren sie noch zu jung, Röschen sieben und Claire erst vier. Mit dem Verstande konnten sie nicht erfassen, was geschehen war. Nun nach Paris? Nein, um Glück zu verbreiten, heute schon, war die Stadt noch nicht geschaffen. Paris hungerte, Paris fror. Aber trotzdem… Mit den beiden, Therese und mit Huber – vielleicht garantierte es wenigstens eine Art Ruhe, Geborgenheit inneren Friedens. Er glaubte noch an ein Weiterleben zu dritt. Und zugleich kam ihm wieder das Frösteln. Als er mit Humboldt gereist war… Da hatte dieser kursächsische Legationssekretär aus Dresden seine Abwesenheit genutzt und freien Zutritt gehabt. Wohin? Bis ins Schlafzimmer jedenfalls. Und dann, vor ihrer Flucht aus Mainz, ausdrücklich gegen seinen Willen, hatte Therese es auch Caroline überlassen. Wollte sie ihm damit nur zumuten, was sie sich selber seit langem gestattete? Er sei ein Mensch, hatte er gesagt, dessen Gesinnungen und Gefühle zu wenig wandelbar sind…
Der Berg wälzte sich über ihn. Forster spürte den Druck auf seinem Kopf, wie von einer Zwinge, die sich fester und fester um seine Stirn schloß. Auch die Brust wurde ihm wieder eng. Ein erneuter Hustenanfall begann ihn zu quälen, und ihm war, als stieße mit jedem Schlag sein Herz gegen die Rippen.“
Erstmals 2008 erschien in der edition NORDWINDPRESS Dalberg-Wendelstorf „Bei den Schmetterlingen in Surinam. Die Reise der Maria Sibylla Merian“ von Ingrid Möller: Dieses Buch hat eine lange Vorgeschichte, wie die Autorin berichtet: Als ich nach der Veröffentlichung mehrerer Künstlerromane gebeten wurde, ein Kinderbuch über einen Künstler zu schreiben, schlug ich spontan Maria Sibylla Merian vor. Was mich selbst als Kind so fasziniert hatte – das Wunder schöner Blüten und die Verwandlung der Raupe über die Puppe zum Schmetterling – musste doch auch heutige Kinder noch begeistern! So entstand das Manuskript „Ein Schmetterling aus Surinam. Die Kindheit der Maria Sibylla Merian“. Nach der Auszeichnung mit dem Peter-Härtling-Preis erschien das Buch 1995 im Beltz-Verlag und hatte zwei Taschenbuch-Nachauflagen. Fragen blieben. Wie mochte wohl die beschwerliche Reise nach Surinam verlaufen sein? Nach weiteren Recherchen und etlichen Fernreisen wurden die Ereignisse in mir lebendig und drängten aufs Papier. Ja, so könnte es gewesen sein!
Bei dem Begriff „Merian“ mag mancher an den gleichnamigen Reiseverlag denken, ein anderer an die Städtepanoramen in dicken Kupferstichbänden von Matthäus Merian dem Älteren und seinem Sohn Caspar, kaum jemand an Maria Sibylla Merian (1647-1717), die eine Tochter des älteren Merian und eine spätgeborene Halbschwester seiner Söhne war. Wie die spätere Blumen- und Insektenmalerin ihre Kindheit in Frankfurt am Main verbrachte, war Thema des Kinderbuches „Ein Schmetterling aus Surinam“.
Dieses Buch hier schildert, wie Maria Sibylla Merian als reife Frau von über 50 Jahren sich ihren langgehegten Wunsch erfüllt und mit ihrer jüngeren Tochter die mehrmonatige Schiffsreise nach Surinam wagt, um dort an Ort und Stelle Pflanzen und Kleintiere zu beobachten und zu zeichnen. Geschwächt von einer schweren Tropenkrankheit kehrt sie zurück, kann die großen Kupferplatten für den umfangreichen Sammelband nicht mehr selbst stechen, erlebt aber noch die Fertigstellung und Kolorierung und ihren großen Ruhm. Kunstagenten erwerben den Prachtband im Auftrag von Königen und Fürsten. Hier der Anfang dieser spannenden Reisebeschreibung:
„Vor zehn Jahren erschien mein Buch Ein Schmetterling aus Surinam – Die Kindheit der Maria Sibylla Merian.
Immer wieder wurde ich seitdem gefragt: Und? Kam Maria Sibylla nach Surinam? Dieses Buch ist die Antwort darauf.
Ingrid Möller
Beim Notar. April 1699
„Und Ihr seid wirklich fest entschlossen, diese lange gefahrvolle Schiffsreise auf Euch zu nehmen, Mevrouw Merian?“
Über die Brillengläser hinweg mustert der Notar sein Gegenüber. Maria Sibylla setzt sich noch eine Spur gerader.
„Ja, Mijnheer Wijmer“, sagt sie mit Nachdruck, „mein ganzes bisheriges Leben steuerte – wenn auch über Umwege – auf diese Reise zu. Und jetzt sind alle Voraussetzungen geschaffen. Endlich. Ein weiterer Aufschub ist nicht möglich.“
Nein, das gewiss nicht, denkt der Notar im Stillen, denn die Frau ist schon längst nicht mehr jung. Wie alt mag sie sein? Fünfzig doch mindestens. Mut hat sie – das muss man ihr lassen.
„Und Ihr wollt allen Ernstes dorthin wegen der tropischen Schmetterlinge, Blumen und Insekten? Da gibt es hier in Amsterdam doch so schöne Sammlungen und Gewächshäuser, um dieses alles zu studieren und zu zeichnen.“
Maria Sibylla sieht hinaus aus dem offen stehenden Fenster auf die ziehenden Wolken, um die Ruhe zu bewahren.
„Ja, Mijnheer Wijmer, diese Sammlungen kenne ich sehr wohl und auch Gewächshäuser wie das berühmte der Agneta Block. Aber Ihr müsst doch zugeben, dass es nicht dasselbe ist, ob man es mit aufgespießten oder in Spiritus eingelegten Tierlein zu tun hat oder mit lebenden. Und in einem Tropenhaus mag man wohl eine Ahnung bekommen, welche schwülwarme Luft voller exotischer Düfte im Regenwald herrschen mag, aber der natürliche Lebensraum für die Pflanzen und Tiere ist eben auch das nicht.“
„Da habt Ihr sicher Recht“, gibt der Notar zu, „nur – verzeiht – es ist ein so ungewöhnlicher Gedanke für mich, mir Euch im Urwald auf Schmetterlingsjagd vorzustellen. Bisher hatte ich nur mit Damen zu tun, die als Gattinnen von Plantagenbesitzern nach Surinam gingen. Seid Ihr Euch der Gefahren wirklich bewusst?“
Maria Sibvlla wird ungeduldig.
„Glaubt Ihr wirklich, ich hätte das nicht alles gründlich bedacht: die Strapazen der langen Fahrt auf dem Segler, die Hitze, mögliche Krankheiten, Überfälle durch Seeräuber, Sklavenaufstände, Tierbisse. Aber ich fühle mich in Gottes Hand und vertraue auf ihn. Wenn er mir schon diese ungewöhnliche Leidenschaft in die Wiege gelegt hat, wird es auch sein Wille sein, dass ich meinen Weg konsequent zu Ende gehe. Und – falls Euch das beruhigt – ich reise ja nicht allein.“
„Wie ich hörte, hatte Euer Schwiegersohn Jacob Hendrik Herolt aus Bacharach schon als Kaufmann in Surinam zu tun. Er gilt als sehr tüchtig. Dann wird wohl er Euer männlicher Begleiter sein?“
„Da muss ich Euch leider enttäuschen. Aber gut, dass Ihr ihn so schätzt. Ihn und den Bildnismaler Michiel van Musscher habe ich nämlich als Bevollmächtigte und Testamentsvollstrecker eingesetzt.“
„Und wer fährt mit Euch?“
„Meine jüngere Tochter Dorothea.“
Ungläubig reißt der Notar die Augen auf, sagt aber nichts mehr.
Maria Sibylla reicht ihm ein Papier über den Tisch, säuberlich beschrieben mit ihrer schönen gleichmäßigen Handschrift.
„Kommen wir also zur Sache. Dies ist mein Testamentsentwurf. Viel hab ich nicht zu vererben. Nur meine Arbeiten.“
Der Notar überfliegt den Text. Die nötigen Angaben sind enthalten. Er muss nur noch einen Vermerk in der umständlichen Juristensprache verfassen, Siegel und Beglaubigungsunterschriften einholen.
Neugierig sucht er nach ihrem Geburtsdatum: 2. April 1647. Er rechnet: dann ist sie also jetzt zweiundfünfzig. Nein wirklich, was mutet sich diese Frau nur zu!
Er legt das Testament in einen Aktenordner.
„Soviel zum Geschäftlichen. Gestattet mir noch ein paar neugierige Fragen, Mevrouw Merian: Ihr fahrt also mit einem Kauffahrteischiff der Westindischen Kompanie und habt ein Empfehlungsschreiben unseres Bürgermeisters Nicolas Witsen. Das wundert mich nun wirklich.“
„Was wundert Euch daran?“
„Dass nicht einmal der Bürgermeister Euch von Euerm Vorhaben abbringen konnte, da er doch vier Töchter in Surinam verloren hat. Und Ihr beabsichtigt doch, mehrere Jahre dort zu verbringen.“
„Gewiss ist es sehr traurig, dass der Bürgermeister dort seine Töchter verloren hat, aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass das Schicksal mir und Dorothea so Schlimmes zugedacht hat. Ich möchte in Surinam bleiben, solange es meine Gesundheit zulässt und solange es mein Vorhaben erfordert.“
„Und die Finanzierung? Verzeiht, aber Juristen haben nun mal viel mit Geld zu tun. Es wird gemunkelt, Ihr hättet ein Stipendium von den Generalstaaten bekommen.“
Maria Sibylla seufzt.“
Erstmal 1984 hatte Alexander Kröger im Verlag Neues Leben Berlin seinen Science Fiction-Roman „Der Geist des Nasreddin Effendi“ als Band 186 der Reihe „Spannend erzählt“ veröffentlicht. Dem E-Book liegt die überarbeitete Auflage zugrunde, die 2013 im Projekte Verlag Cornelius Halle unter dem Titel „Der Geist des Nasreddin“ erschienen war: Ein Mann erwacht in der Gegenwart auf dem Basar in Chiwa. Er erinnert sich, dass er wegen seiner Liebe zu einer Frau des Chans enthauptet werden sollte. Er glaubt, Nasreddin Chodscha, der Volksheld und Schalk (der Eulenspiegel des Orients), zu sein. Da er geistig zunächst in seiner mittelalterlichen Welt verhaftet ist, stößt er auf Unverständliches und Ungeheures, auf Bekanntes und schrecklich Unbekanntes und stürzt so von einem spannenden Abenteuer ins andere.
Der jungen Wissenschaftlerin Anora gelingt ein unerhörtes Experiment mit menschlichen Gehirnen, in dessen Folge spannende Verwicklungen für Aufregung und für eine ungewöhnliche Liebe sorgen. Anora folgt Nasreddins Weg, auf dem er seinem Image treu bleibt.
In einer Rezension der Abteilung Literatur und Medien in der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft des Landesverbandes Hessen hieß es damals sehr lobend: „Die raffinierte Mischung aus Märchen, Geschichte und SF ist äußerst spannend und witzig und kann den Leser jeden Alters durch ihre Spannung in Atem halten. Nebenbei vermittelt sie auf amüsante Weise eine gehörige Portion an historischem, völker- und länderkundlichem Wissen, ohne im Mindesten pädagogisch-lehrhaft zu wirken.“ Und so gehen Nasreddins neue Abenteuer los:
„In Chiwa
Ganz behutsam drang es in sein Bewusstsein – als zersprängen Wassertropfen auf heißem Stein, und jedes Kügelchen verzische mit eigenem Geräusch: Da murmelten Stimmen, ein Esel schrie; von dorther scholl das Knirschen eisenbeschlagener Räder auf Kies. Auch undefinierbares Brummen war zu hören. All das aber klang wie unter einem Tontopf hervor, gedämpft, entfernt, unwirklich.
Und dann war alles wieder vorbei, bis auf ein dumpfes Rauschen vielleicht, von dem man nicht wusste, ob es vom Umfeld oder von innen aus dem Kopf kam. Es schien, als bilde sich irgendwo einer jener Tropfen neu, würde schwerer und schwerer, bis er sich schließlich löst und abermals auf dem Stein zerschellt; denn wieder und wieder sprangen die Geräusche auf.
Zu irgendeinem Zeitpunkt wurde ihm bewusst, dass sich der Abstand zwischen den Tropfen verringerte, als bahne sich das Wasser mehr und mehr Durchgang durch ein löchriges Gefäß.
Plötzlich gellte eine schrille Frauenstimme: „Willst du wohl den Apfel zurücklegen, du Schlingel!“
Ein Kind rief: „Aua!“
Gelächter kam auf.
Dann drängte ein Mann: „He Onkelchen, wach endlich auf. Dein Zeug ist sonst verschwunden, bevor du einen einzigen Sum dafür eingenommen hast.“
Und wieder die Frau: „Dieser Gottlose wird sich einen angetrunken haben. Und Allah straft ihn mit einem Brummschädel, kein Auge kriegt er auf. Schaut ihn euch an, Leute, diesen Saufbold.“
Auf einmal rief der Mann in einem anderen Tonfall: „Komm, kauf! Die besten Trauben, die wunderbarsten Granatäpfel von Chiwa, süß und billig, eingefangene Sonne!“ Und nach einer kleinen Weile murmelte er: „Der Scheitan soll dich holen!“
„He, wach auf, du Taugenichts!“ Diesmal war die Stimme des Mannes barscher, vielleicht vor Ärger, weil der Kauflustige seine Ware verschmäht hatte.
„Dummkopf!“, sagte die Frau gedämpft. „Seine Granatäpfel sind viel schöner als unsere, und er hat angeschrieben, dieser Esel, dass er fürs Kilo nur sechshundert Sum haben will. Der schnappt uns die Käufer weg. Lass ihn also in Ruhe, wenn Allah ihn schon mit Dummheit geschlagen hat.“
>Basar, ich bin auf dem Basar!Ah! Gewürze!< Und sofort verspürte er ihren Duft, glaubte die Aromen zu schmecken. Und einmal gerochen, gab’s da noch mehr: Rauch, Eselsdung und Schweiß. Darüber lagen dumpfes Gemurmel, das Schlurfen unzähliger Schritte und Staub, den man ebenfalls roch. Basar!
>Basar?Wie stets?Ich lebe ja, ich lebe!Ein Irrtum des Emirs, eine Unachtsamkeit der Häscher? Ich lebe!Ich will leben!< Und fieberhaft jagten die Gedanken.
Eine Sekunde wurde er sich bewusst, dass er nicht an sein lumpiges Leben gedacht hatte, als sie ihn gebunden zum Richtplatz führten, als er zusehen musste, wie das Haupt der Geliebten in den Sand rollte.
Und es war, als wollte der Schmerz den Mann erneut überfallen. >Nilufar – du bist gestorben, weil wir uns liebten. Glaube mir, ich bin dir gern in den Tod gefolgt. Es ist Allahs Wille, muss Allahs Wille sein, dass ich lebe.Wie, bei Allah, bin ich vom Richtplatz auf den Basar geraten? Und weshalb sind hier unverschleierte Frauen, ebenso viele wie Männer? Ah, es ist ein Traum, du träumst, Nasreddin, du bist in der Welt der Toten.< Einen Augenblick war ihm nach diesem Gedanken leicht.
Ein Granatapfel, der ihm mit ausgestrecktem Arm entgegengereckt wurde, brachte ihn in die momentane Wirklichkeit zurück. Es war ein Apfel aus seinem – >Weshalb eigentlich meinem?< – Bestand, und ihn hielt eine sehr schöne hellhäutige Frau, und der Arm war nackt bis zur Schulter. Diese Frau redete ihn in einer fremden Sprache an.
Der Mann blickte sich noch einmal um, aber nach wie vor zeichnete sich keine Gefahr ab. Mit der Rechten wehrte er die zudringliche Nachbarin ab, nahm den Apfel verwirrt aus der Hand der Frau und sagte sanft und wunderte sich über seine wohlklingende tiefe Stimme: „Ein Akscha.“
Die Nachbarin lachte hell auf, wies mit ausgestrecktem Arm auf den Verkäufer, tippte sich mit der anderen Hand nachdrücklich an die Stirn und ermutigte andere, in ihr schrilles Lachen einzustimmen. „Ein Akscha“, gluckste sie nachäffend mit zahnlückigem Mund.
Verunsichert blickte der Mann, sah auf den Apfel in seiner Hand, in das Gesicht der schönen Käuferin, die dem Geschehen offenbar ebenfalls nicht folgen konnte, und zur Nachbarin.
Da lächelte die Kaufwillige, die zu einer Gruppe eigenartig angezogener hellhäutiger Passanten – zu denen noch viele Frauen gehörten – zählte.
Und als wurde es dem Mann erst jetzt bewusst: In der Tat, die Frauen zeigten ihre Gesichter ohne Scham, als sei es für sie etwas Alltägliches. >Oh Allah!< Und er schaute in den Himmel, der blau war, und sah über die niedrigen Schuppendächer jenseits der Straße die schlanke Spitze des Minaretts, eines Minaretts. >Ja, bin ich denn nicht in Chiwa?< Er blickte die Straße hinunter, und dort sah er, zwischen den Körpern der Leute hindurch, das Eingangstor zur Karawanserei. >Doch Chiwa …! Aber das Minarett? Was ist geschehen? Die Frauen ohne Schleier, ein falsches Minarett? Also doch tot, in einer anderen Welt. Aber in einer, die nicht minder schön ist.< Und er sah in das Gesicht der Frau und nickte ihr froh zu.
Diese steckte den Apfel in einen Beutel und legte ein grünliches Scheinchen auf das Brett.
Dann drängten andere aus der Gruppe vor, hielten ebensolche Papierchen oder auch Münzen hin, und der Mann, verwirrt, aber dennoch ein wenig geschmeichelt ob des regen Zuspruchs, verteilte seine Waren mit beiden Händen. Auf das ausgebreitete Tuch purzelten Scheine und Münzen, er achtete nicht darauf.“
Aber wie war der hingerichtete Nasreddin eigentlich auf den Basar in Chiwa gekommen? Und war er überhaupt Nasreddin? Um Antworten auf diese beiden und eine Reise anderer Fragen zu bekommen, muss man diesen historisch-utopischen Roman lesen. Und es lohnt sich. Viel Vergnügen beim Lesen (und wundern), einen schönen Frühlingsanfangssonntag und bleiben auch Sie weiter vor allem schön gesund und munter und bis demnächst.
Und vielleicht noch ein kleiner Tipp: Es lohnt sich auch wieder einmal zu den Geschichten von Nasreddin Hodscha zu greifen, diesem orientalischen Eulenspiegel und Schlitzohr, der die ganze Gesellschaft und auch sich selbst auf den Arm nimmt. Wer kann das schon von sich behaupten.
Außerdem ist Nasreddin ein Menschenkenner und – ein Menschenfreund. Und noch eine interessante Bemerkung von Celal Özcan, dem Chefredakteur der Europaausgabe der türkischen Tageszeitung „Hürriyet“: „Nasreddin fordert die Leute immer auf, die Dinge von einer ganz anderen Seite zu betrachten. Dabei bricht er natürlich viele Tabus. Das ist meines Erachtens ein ganz wichtiger Aspekt seiner Geschichten, der Tabubruch. Er ist einer, der sich wirklich über Konventionen, Regeln und Gesetze total hinwegsetzt. Und dass er ein muslimischer Würdenträger ist, wenn auch nur ein kleiner Hodscha, macht ihn ja als Figur noch reizvoller. Denn er feilscht mit Allah gleichsam auf Augenhöhe und beschwerliche religiöse Vorschriften wischt er einfach beiseite.“ Und das ist doch keine schlechte Idee, oder?
EDITION digital war vor 27 Jahren ursprünglich als Verlag für elektronische Publikationen gegründet worden. Inzwischen gibt der Verlag Krimis, historische Romane, Fantasy, Zeitzeugenberichte und Sachbücher (NVA-, DDR-Geschichte) sowie Kinderbücher gedruckt und als E-Book heraus. Ein weiterer Schwerpunkt sind Grafiken und Beschreibungen von historischen Handwerks- und Berufszeichen sowie Belletristik und Sachbücher über Mecklenburg-Vorpommern. Bücher ehemaliger DDR-Autoren werden als E-Book neu aufgelegt. Insgesamt umfasst das Verlagsangebot, das unter www.edition-digital.de nachzulesen ist, mehr als 1.100 Titel. E-Books sind barrierefrei und Bücher werden klimaneutral gedruckt.
EDITION digital Pekrul & Sohn GbR
Alte Dorfstraße 2 b
19065 Pinnow
Telefon: +49 (3860) 505788
Telefax: +49 (3860) 505789
http://www.edition-digital.de
Verlagsleiterin
Telefon: +49 (3860) 505788
Fax: +49 (3860) 505789
E-Mail: editiondigital@arcor.de
![]()