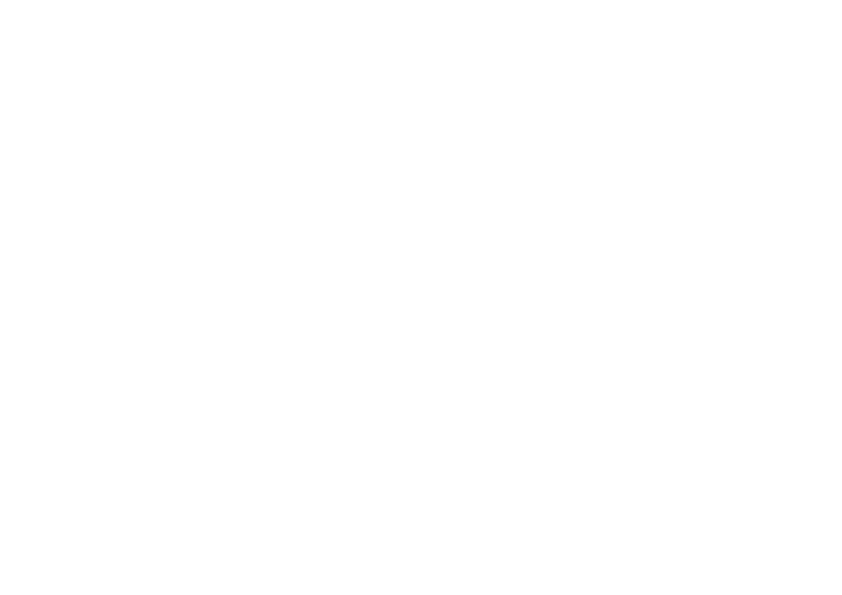Vom selben Autor stammen auch drei weitere Sonderangebote dieses Newsletters: In dem Märchen „Der verliebte Glasbläser“ geht es gleich um zwei Zauber, um den des Glasblasens und um den der Liebe. In „Der Verbannte von Tomi“ hat der Autor drei Historische Erzählungen versammelt. In der titelgebenden Geschichte des Buches schreibt er über den berühmten Dichter Ovid, der sich zu Unrecht verurteilt und verbannt fühlt und der vor allem eines will – wieder zurück nach Rom …
Und in „Der träumerische “ stellt Ebersbach mehr als 200 Anekdoten zu Heinrich Heine vor.
Und damit sind wir wieder beim aktuellen Beitrag der Rubrik Fridays for Future angelangt. Jede Woche wird an dieser Stelle jeweils ein Buch vorgestellt, das im weitesten Sinne mit den Themen Klima, Umwelt und Frieden zu tun hat – also mit den ganz großen Themen der Erde und dieser Zeit. Diesmal geht es wieder um Krieg und Frieden. Anfangs der achtziger Jahre des vorigen Jahrhunderts denkt der Held jedoch anscheinend nur an seinen Karriere, will einen Auftrag möglichst problemlos hinter sich bringen. Alles andere interessiert ihn nicht. Darf man unpolitisch sein?
Erstmals 1982 veröffentlichte Wolfgang Schreyer im VEB Militärverlag der Deutschen Demokratischen Republik Berlin seinen Roman „Die fünf Leben des Dr. Gundlach“: Köln, Herbst 1980. Hans Gundlach, Werbemann der Rheinischen Industriebau AG, fliegt nach El Salvador, um die Auslösung des dort entführten Filialleiters zu überwachen. Ein Detektivbüro soll ihn für 1,5 Millionen Dollar freikaufen. Gundlach kümmern nicht die politischen und sozialen Kämpfe in dem kleinen Land, er sieht nur seinen Auftrag; erledigt er den, steigt er auf der Leiter des Erfolgs noch höher. Also schaltet er aus, was ihn stört, handelt ganz auf eigene Faust. Im Dschungel des Machtkamps setzt er alles aufs Spiel und verliert die Existenz.
Doch Hans Gundlach steht immer wieder auf. Zwei Anläufe hat er schon hinter sich: als Teilnehmer der Studentenunruhen 1968 und als linker Journalist; später als junger Mann der Konzernführung. Nun wagt er von neuem den Sprung in die Politik. Ihm ist als habe er fünf Leben. Nichts scheint unmöglich. Er kann sich eine Geheimdienst-Laufbahn ebenso vorstellen wie ein Wirken für die Befreiungsbewegung. Ist ihm jeder Start recht? Sind Taktik, Karriere und Träume vom Erfolg die Leitlinien seines Handelns? Hier ein Auszug, der schon in El Salvador spielt:
„3
Der internationale Flughafen Ilopango lag im Morgenschlaf, einziger nichtprivater Flugplatz eines Landes ohne inneren Luftverkehr. Abseits der Rollbahn sah Gundlach Militärmaschinen – leichte Kampfhubschrauber und „Magister“-Strahljäger aus Frankreich, am Bug schwarz vom Qualm der Bordwaffen. Trotzdem, das Ganze wirkte ländlich, leblos bis auf das Rundsuchradar und den Sonnenglanz auf all dem Glas und Aluminium der Abfertigungshalle: die Visitenkarte seiner Firma.
Und dort erwartete ihn Hertel, Leiter der Transportabteilung, ein junger Mann aus Dorpmüllers Stab, klein, zappelig, wie aus dem Ei gepellt. Kein Visum, bestätigte Hertel, selten Gepäckkontrolle, nicht mal die Pockenschutzbescheinigung wolle man; der Stempel im Pass sei einen Dreimonatsaufenthalt wert. Wer im Privatjet lande, gelte als wichtiger Mensch, den man kaum behellige. Den Rest habe er schon erledigt.
„Seit wann warten Sie auf mich?“
„Seit halb sechs, Herr Doktor Gundlach. Von neun bis fünf ist ja Ausgangssperre.“ Draußen auf dem Parkplatz sah Hertel sich mehrmals um, ohne den Redefluss zu bremsen. „Doktor Seitz hatte Sie bereits gestern erwartet, mit der Iberia aus Madrid, doch das war wohl nicht zu schaffen… Es ist ganz ruhig in der Stadt. Sie sind sehr gut im Camino Real untergebracht, absolut erstklassig.“
„Wir fahren zuerst ins Büro.“
Auf der vierspurigen Autobahn sagte Hertel: „Es sind nur fünfzehn Kilometer. Oft gibt es allerdings Kontrollen.“ Er sah in den Rückspiegel. „Links hinter uns der berühmte Ilopango-See, war auch mal ein Krater, riesenhaft, vierzehn Kilometer Durchmesser…“ Hertel räusperte sich, wohl um das Zittern auszulöschen, das sich in seine Stimme schlich. „Wenn es jetzt am Ende der Regenzeit einen der üblichen zwei Erdstöße gibt – das Epizentrum liegt immer genau im See.“
„Beschäftigt Sie der See?“
„Weshalb fragen Sie?“
„Weil Sie dauernd nach hinten sehen.“
„Ach, das… Nein, vorhin war mir nur, als hätte sich wer angehängt. Ein gelber Datsun, glaube ich.“
„Immer ruhig bleiben.“
„Es fiel mir nur auf. Hier achtet man auf so was.“
„So wichtig sind wir beide nicht.“ Die Stadt kam auf Gundlach zu, chaotisch, ein Millionending, nach rechts aufsteigend, an einen Berg geschmiegt, der auch wieder ein Krater war. „Wie lebt sich’s denn mit der Ausgangssperre?“
„Man passt sich halt an. Der Salvadoreño ist äußerst flexibel, wissen Sie. Mit dem nötigen Kleingeld tanzt er vergnügt auf dem Vulkan. Da geht man also in Ihr Hotel zur ‚Copacabana Rollerdisco‘ oder ins Sheraton, das bietet spezielle ‚Sperrzeit-Wochenenden‘: Dinner, Tanz und Show am Samstag mit Übernachtung und Sektfrühstück – perfekt.“
„Business as usual?“
„Genau, Herr Doktor. Auch das älteste Gewerbe geht mit der Zeit. Der Stoßbetrieb in Häusern wie ‚La Guadeloupe‘ im San-Marcos-Viertel und bei ‚Gloria‘, nicht weit vom Sheraton, hat sich von nachts eben auf die Mittagsstunden verlagert. Den Taxifahrern gibt man als Gloria-Kunde ein solides Fahrtziel an – das Bestattungsinstitut ‚Sinaí‘. Das ‚Sinaí‘ liegt nämlich direkt gegenüber. Und es hat gleichfalls Konjunktur.“
„Danke für den Tipp. Aber ich hätte gern mehr über Dorpmüller gehört.“
„Da möchte ich Herrn Doktor Seitz lieber nicht vorgreifen.“
Beim Aussteigen gewahrte Gundlach einen gelben Datsun, der fünfzig Schritte hinter ihm rückwärts in eine Parklücke stieß. Er behielt es für sich. Wozu Hertel ängstigen, diesen Wicht, der flott und abgebrüht tat, während ihm die Nervosität doch aus jedem Knopfloch sah. Die Rheinische Industriebau saß, als verkaufe sie Kosmetika, an dem eleganten Boulevard de los Héroes, sie hatte in bester Lage eine Hochhausetage belegt. Aber Dr. Seitz, Dorpmüllers Bürochef und zweiter Mann der Niederlassung, war noch gar nicht da.
Es ging erst auf acht. Seitz‘ Sekretärin, eben angelangt, reichte Gundlach Kaffee. Sie hieß Lucie Binding. Es habe ja niemand gewusst, wann er kommen werde, klagte sie und rief ihren Chef an. Sie war um die Dreißig, recht gepflegt und attraktiv mit dem Nackenknoten, doch auf jene Art, die Gundlach kalt ließ. Etwas in ihm, das sich auch in Momenten wie diesem seiner Kontrolle entzog, tastete jede Frau gleich auf das Maß an Lust hin ab, das sie ihm womöglich bringen konnte; das Resultat war unwiderruflich, diesmal Null.
Man habe Herrn Dorpmüller nahe seinem Apartment oben in Escalón überfallen, teilte Frau Binding mit; das Auto blockiert, seinen Fahrer herausgezerrt und ihn im eigenen Wagen entführt. Sie fügte ein paar Details hinzu, die durchgesickert waren, Gundlach hörte kaum hin. Die Umstände der Tat waren ja belanglos. Dorpmüller befand sich in fremder Gewalt, es ging um Lebenszeichen, Modalitäten des Austauschs, Signale der Kidnapper also – davon aber wusste sie nichts, vermutlich weil Dr. Seitz äußerst schweigsam war.
Nun endlich traf er ein, ein hagerer älterer Herr, gelblich, leise und zäh. Seitz wirkte steif, formell und ziemlich autoritär. Bei aller Höflichkeit ließ er durchblicken, dass er mit einem Ranghöheren als Gundlach gerechnet hatte. Sein Sinn für die Hierarchie schien verletzt, die Unterstellungsfrage in seinen Augen völlig offen: Wer musste wem jetzt folgen, der junge Abgesandte aus Deutschland dem erfahrenen Mann vor Ort – oder umgekehrt? So etwas entschied Gundlach stets durch Überrumpelung, durch freundliche Weisungen und raschen Zugriff, doch Seitz leistete ihm Widerstand. „Nur Geduld“, riet er kühl. „Es lässt sich nichts tun, ohne Herrn Dorpmüller zu gefährden. Da ist kein Spielraum für Verhandlungen. Man muss die Bedingungen leider akzeptieren…“
„Die sind akzeptiert. Nur, was geschieht denn?“
„Das liegt bei unseren Beauftragten, der Detektei Ward, Webster und Willoughby.“
„Haben Sie die eingeschaltet?“
„Ich hab es der Zentrale fernschriftlich empfohlen und bin dazu ermächtigt worden, ja. Das ist auch der hier übliche Weg. Ward, Webster und Willoughby sind auf diese Fälle spezialisiert. Bei denen ist das in besten Händen. Wir sind dauernd in Verbindung und bekommen außerdem täglich ihren Tätigkeitsbericht.“
„Und, was stand in dem letzten?“
„Es gibt erst einen, um exakt zu sein.“ Dr. Seitz schloss den inneren Teil der Doppeltür zum Vorzimmer, dann entnahm er seinem Safe ein Papier. „Bitte, lesen Sie selbst.“
Unter ihrem pompösen Firmenkopf (vornehmer Graudruck mit einer Anschrift in México City und dem Kürzel WWW als Wasserzeichen) zählte die Zentralamerika-Filiale der Agentur zwei Kontakte der Kidnapper auf. Danach hatten sie sich gestern telefonisch mit ihrer Forderung im RIAG-Büro gemeldet und später ein Tonband geschickt, das Dorpmüller besprochen haben sollte. Doch hätte die Tonqualität nicht ausgereicht, den Entführten zu identifizieren. Der Rest war Geschwätz. Unterzeichnet hatten ein Mr. Hilary als WWW-Regionalvertreter in San Salvador und ein Mr. Pinero als Sonderagent, was auch immer das heißen mochte.“ Und damit zu den ausführlicheren Vorstellungen der anderen vier Sonderangebote dieses Newsletters.
Erstmals 1986 erschien im Buchverlag Der Morgen Berlin „Die Schatten eines Satyrs. Historischer Roman um Titus Petronius“ von Volker Ebersbach: Im Jahre 66 unserer Zeit öffnet sich der Dichter Titus Petronius Arbiter die Adern, um einem Todesurteil durch Nero zuvorzukommen, dessen Erzieher und Berater in Fragen feinen Geschmacks er ist. Außer einer Stelle bei Tacitus und Fragmenten seiner „Satyrgeschichten“ gibt es kein Zeugnis über diesen geistreichen, mutigen, zwiespältigen Mann. Doch seine Umrisse lassen sich wie die eines Schattens in der bewegten Geschichte der römischen Kaiserzeit von Tiberius bis Nero verfolgen. Volker Ebersbach erzählt auf historischem und kulturgeschichtlichem Hintergrund den aus Wahrheiten und Wahrscheinlichkeiten erschlossenen Lebensweg eines feinsinnigen, gebildeten Römers, der, lange bevormundet als Opfer eines Justizirrtums, in die Freiheit des Landstreichers gestoßen, von Agrippina, der Urenkelin des Augustus und Neros Mutter – in die er verliebt ist -, aufgegriffen, rehabilitiert und in den ersehnten Staatsdienst aufgenommen wird. Aber er scheitert an Intrigen, Neros erwachender Brutalität und nicht zuletzt an eigenen Widersprüchen. Der satirische Dichter findet zu sich selbst. Er hat sarkastisch gelebt und wird Meister sarkastischer Prosa. Angesichts der Verkommenheit der Herrschenden und ihres Staates dient er seinen Römern als Künstler, hoffend, dass er Nero überlebe. Intrigen holen ihn ein. Sein Werk überlebt. Hier der Beginn dieses Historischen Romans:
„I. BUCH: VOR DEN SCHÄCHTEN DES ORKUS
Igneus est ollis vigor et caelestis origo
eminibus, quantum non noxia corpora tardant …
Urhauch des Feuers und himmlische Herkunft wohnt jenen Keimen
inne, soweit nicht die Schwere der Körper sie hindert im Wandel …
Vergil, Aeneis, VL, 730 f.
Der Satyr erwacht
„Woher komme ich?“, fragte das Kind.
Es war allein in seiner engen, dämmrigen Schlafkammer und erinnerte sich keines Traumes. Blinzelnd rieb es sich die Augen und erkannte die ockergelbe, rostrote und lorbeergrüne Bemalung der Wände. Der Lichtschein des schmiedeeisernen Kandelabers taumelte darüber. Es roch nach frisch aufgegossenem Lampenöl, der Vorhang bewegte sich. Jemand musste dagewesen sein. Ein Luftzug strich vom Innenhof herein.
Das Kind erwartete keine Antwort. Wie immer war es sehr zeitig erwacht. Nach dem traumlosen Schlaf ängstigten Titus die Lorbeergirlanden in ihrer gemalten Starre und die dicklichen, geflügelten Amoretten, die auf schwarzem, Wand für Wand zwischen rostfarbenen Feldern fortlaufendem Fries kindlichen Beschäftigungen nachgingen. Auf dem großen Wandbild über dem Bett wurde Achilles von dem Zentauren Chiron unterrichtet. Der junge, muskulöse, sonnengebräunte Held und sein Lehrer, halb Greis, halb Pferd, schienen in gelblichem Nebel zu schweben. Die Ohren des weisen Halbmenschen liefen tierhaft spitz aus, um sein zottiges Haar rankte sich Lorbeer, eine Hand fasste Achilles bei der Schulter, die andere wies auf eine Saite der Lyra, die der Schüler zwischen Hüfte und Armbeuge hielt. Bei der schwachen Beleuchtung war nicht zu erkennen, wohin in den halbgeschlossenen Augen des Zentauren die Augäpfel blickten. Titus fühlte sich scheel angestarrt und erschrak.
Der Vorhang bewegte sich stärker. Ein kurzgeschorener Kopf mit freundlichem Gesicht lugte herein.
„Harpocrates, woher komme ich?“, rief das Kind.
Der Leibsklave verdrehte fragend den Kopf, trat einen Schritt näher und öffnete den Vorhang hinter sich ganz. Das Morgenlicht überstrahlte die Kandelaberflamme. Seine Farbe verriet, dass die Sonne aufgegangen war.
„Harpocrates“, wiederholte Titus, „du Verschwiegenster unter den Schweigern, sag, woher komme ich?“
„Aus dem Schlaf“, antwortete der Sklave.
„Nicht aus dem Orkus?“
„O nein! Siebenmal habe ich während der Nacht zu dir hereingeschaut, wie du es wünschtest. Immer lagst du in deinem Bett, und nur zweimal hast du die Seite gewechselt. Wer in der Unterwelt weilt, bleibt lange fort.“
„Bist du sicher?“, beharrte das Kind. „Lügst du auch nicht?“
„Ich bin sicher“, sagte Harpocrates. „Denn aus dem Orkus kommt man in menschlicher Zeitspanne nur einmal, und nur einmal steigt man wieder hinab.“ Er goss Wasser aus einem Zuber in die silberne Waschschüssel und brachte Tücher.
„Nein, lass das!“, rief Titus und sprang aus dem Bett. „Ich laufe hinunter ans Meer und bade.“
Mit ausgebreiteten Armen pflanzte sich Harpocrates in die Tür.
„Deine Mutter verbietet es!“
„Weshalb?“
„Du vergisst das Wiederkommen und lässt den Lehrer warten.“
„Es ist noch so viel Zeit!“, seufzte Titus und tat, als wollte er sich waschen.
Harpocrates sagte, er werde die Grütze ins Esszimmer bringen. „Nein!“, widersprach Titus. „Ich will sie in der Küche mit dir essen, solange meine Mutter noch schläft.“
Kaum war der Sklave fort, streifte sich Titus die Tunika über, lauerte am Vorhang, bis Harpocrates in der Küche verschwand, lief barfuß in entgegengesetzter Richtung durch den Säulengang, durchquerte den Vorraum des Kellers und gewann den Hinterausgang, der in die umfriedeten Gärten des Landhauses führte. Hecken trennten das Blumengärtchen der Mutter vom Kräutergarten des Kochs und dem Wurzelgarten des Arztes. Ein Laubengang führte hinaus in den Park. Im Weinlaub hingen schwere Trauben mit gelbgrünen Beeren, groß wie Pflaumen.
Das Gelände stieg sanft an. Morgensonne schien durch die fleischigen, geschlitzten Blattwedel der Feigenbäume, zwischen denen zwiebelförmige Früchte der Reife entgegenschwollen. Sie verfing sich in gelbblühenden Hibiskusbüschen und in rotblühenden, lanzenblättrigen Oleanderbäumchen. Der Hang wurde steiler. Weitausladende Platanen beschatteten ihn, überragt von den dichten Schöpfen eines Pinienwäldchens. Zwischen den Stämmen schimmerte weiß der Himmel. Wo das Gras unter dem Nadelteppich hervorquoll, brach der Boden jäh ab, stürzte der graugelbe Felshang in eine schwindelnde Tiefe. Auf Vorsprüngen, in den Fugen halbabgespaltener Gesteinsplatten und am Rand eines Saumpfades, der sich hinabschlängelte, trieb der Feigenkaktus seine blutroten Früchte. Unten spielte zwischen Riffen der Golf.
Titus warf sich auf den Rasen. Grell stieg die Sonne über den langgestreckten Rücken des Vorgebirges Pausilypon. Im Dunst verschwamm der schmauchende Kegel des Vesuv, der sich fern über Neapel erhob. Zur Mitte des Golfes hin klarte die Luft auf. Vor der Stirn des Pausilypon, die sich wölbte wie die eines Delphins, wuchs felsig, von einem kleinen Tempel gekrönt, die Insel Nesis aus der Flut, die sich in immer zarteren Farben dem offenen Meer zu weitete. Das Meer kräuselte sich schwach. Geglättet wie Straßen durchzogen es die Spuren heimkehrender Fischerboote. Im Westen ragte ein Kegelstumpf auf Kap Misenum herein. Dahinter staffelten sich die Gebirge der Inseln Prochyta und Aenaria, die ferneren höher, aber flauer. Weiß schimmerten die Villen von Bajae. Hoch über den Kolonnaden der Badestrände thronte der kaiserliche Palast, die Villa Caesaris. Vorn aber, wo die Felsenküste im Bogen abflachte, lehnte die Stadt Puteoli an vielfach gefalteten Hängen. Bis hinüber nach Bajae zogen sich die Landhäuser in ihren Gärten, Weinbergen, Zypressenhainen und Olivenpflanzungen. Weit liefen die Hafenmolen, bestückt mit ruhenden Schiffen, hinaus in den Golf. Gestern war die ägyptische Kornflotte aus Alexandria eingelaufen. Ihre plumpen Frachter glichen eher Häusern als Schiffen. In der Nähe des Hafens rauchten die Eisenwerkstätten aus rußigen Pyramidenstümpfen. Um eine weit über den Hafen vorspringende Felsnase mit Festungsmauern und Tempeldächern drängte sich, ein bunter Haufen von Häuserwürfeln, die griechische Altstadt. Draußen, unter dem Mittagsstand der Sonne, ragte über den Horizont eine Woge, die zur Wolke wurde, aber mehr noch wie die Silhouette eines gigantischen verwitterten Schiffes, die Insel Capreae.
Titus sog die heraufwehende Salzluft ein. Es verlangte ihn, nicht nur mit Blicken, sondern leibhaftig zwischen dunklem Wasser und lichtem Äther zu schweben. Löste er sich von diesem Felsrand – ob er wirklich fiele? Finge ihn nicht ein Windhauch auf wie den Vogel dort, der sich, einem Stein ähnlich, aus überhängendem Gebüsch hatte fallen lassen, doch dann, weit unten schon, mit ausgebreiteten Schwingen dahinflog und reglos an Höhe gewann? Da war ihm, als würde er von innen zu Stein. Unter seinen Hüften senkte sich der Boden. Steine polterten voraus. Das Rasenstück, auf dem er gelegen hatte, sauste mit einer Staubfahne in die Tiefe. In seinem Hals würgte es. An den Fersen aber spürte er den Griff großer kräftiger Hände, die ihn zurückrissen. In panischer Angst warf er sich herum. Harpocrates sah ihn an.
„Nur einen Atemzug hattest du noch bis zum Orkus“, sagte der Sklave.
„Welche Göttin hat dich mir nachgeschickt?“
„Ich war dir von Anfang an auf den Fersen.“
„Nicht umsonst, Harpocrates, lieh dir der Gott des Schweigens seinen Namen.“
Schwindel verspürte der Junge erst auf dem Rückweg im Park. Er wankte und brach in Tränen aus. Die Knie knickten ein, seine Schultern wurden von innen geschüttelt. Harpocrates musste ihn führen. Vor dem Laubengang trat ihnen mit grazil erhobenen Armen, verzückt zurückgeworfenem Kopf und tänzelndem Schritt ein bronzener Satyr entgegen, ein vollkommener, fast göttlich schöner Männerleib, dessen Muskelwölbungen in der Sonne glänzten. Nur das dünne Gehörn, das aus seinen Locken ragte, die tierhaft spitzen Ohren, wie sie auch der lehrende Zentaur hatte, und am Steiß ein kleines buschiges Schwänzchen verrieten die Mischnatur dieses Wesens.
„Schau ihn an, Titus!“, sagte Harpocrates. „Tanze wie er!“ Der Junge mit den großen, dunkelblauen Augen schwieg.
„Das tut deinem Eigensinn gut!“, sagte der Sklave.
Titus schüttelte den Kopf.
„Sieh! Dein Schatten!“, rief Harpocrates und hielt ihm zwei gespreizte Finger über den schwarzen Scheitel, so dass dem Schatten des Kindes zwei dünne Hörner wuchsen.“
Ebenfalls erstmals 1986 veröffentlichte Volker Ebersbach im Kinderbuchverlag Berlin „Der verliebte Glasbläser“: Ein prahlerischer Fuchs und ein listiger Kater werden zu Kumpanen. Da ihre Gaunerei sie beide leer ausgehen lässt, wird der Gerechtigkeit gleich zwiefach zum Triumph verholfen. Über die bizarren Gebilde, die die Glasbläser gestalten, sind wir des Wunderns voll. Im Märchen vom verliebten Glasbläser und dem glühenden Baum fing der Autor den Zauber des Glasblasens ein, aber mehr noch geht es um die Liebe. Jan bemüht sich erfolglos um die schöne Renata. Als er der Hexe Nihil einen Zauberbaum aus Glas fertigt, bietet sich ihm doch noch eine Chance, das Mädchen zu gewinnen. Hier aber der Anfang der Geschichte vom Fuchs und vom Kater und ihren gemeinsamen Kumpaneien:
„Für Andreas und Clelia
Der Fuchs mit dem brennenden Schwanz
Ein Fuchs, der sich für das schönste und stärkste Wesen im ganzen Revier hielt, schlich allnächtlich durch den Wald. Besonders stolz war er auf seinen langen, roten, buschigen Schwanz, und er bedauerte es manchmal, dass er ihn, wenn er jagte, nur selten anderen Tieren zeigen konnte. Lautlos schnürte er auf seinem Pfad durch Kräuter und Büsche, bis er an den Zaun eines Hühnerhofes gelangte. Der Zaun war zwar an vielen Stellen ausgebessert, aber überall sehr fest, und selbst wenn der Fuchs noch schlanker gewesen wäre, hätte er nirgends hindurchschlüpfen können. Doch an einer Stelle war im Lauf der Jahre ein großer, dichter Haselstrauch in den Zaun hineingewachsen. Dort schob der Fuchs nahe bei den Wurzeln oft seine hungrige Schnauze zwischen den unteren Lattenenden hindurch. Die Hühner rochen so lecker, dass er immer wiederkam, obwohl alle seine Versuche aussichtslos schienen. Eines Tages gab eine morsche Latte nach, und nun befand sich im Zaun ein Loch, das nur der Fuchs kannte.
Noch ehe der Morgen graute, lag der Fuchs reglos im Haselgebüsch. Den buschigen roten Schwanz breitete er sorgfältig hinter sich über die Wurzeln. Mochten wenigstens die Finken und Meisen darüber staunen! Seine schlauen Augen richteten sich auf die Klappe des Hühnerstalls. Mit spitz aufgerichteten Ohren wartete der Fuchs auf das erste Krähen des Hahnes. Er zog die Lefzen zurück, als er die erste Henne die Hühnerleiter herabsteigen sah. Gleich würde er durch das Loch schlüpfen, freilich auf der Hut, dass die Latten ihm keins der kostbaren Haare aus dem Schwanz rissen, würde über den Hof streichen und seine scharfen Zähne in den Federbalg eines ahnungslosen Huhnes schlagen.
Ein Huhn genügte ihm nicht. Bald saß er wieder in seinem Versteck und lauerte. Als er in den Hof geschlüpft war und gerade ein Huhn gepackt hatte, lief mit langen Schritten der Hahn auf ihn zu, reckte seinen bunt gefiederten Hals und hackte zu. Der Fuchs ließ seine Beute fallen und flüchtete. Im Schnabel des Hahnes klemmte ein kleines Büschel roter Haare. Und als der Fuchs sich putzen wollte, entdeckte er im Haarkleid seines Schwanzes ein hässliches Loch.
Da bemerkte er im Gezweig des Haselstrauches einen mageren Kater, der scheinbar gelangweilt die Vögel beobachtete. Der Fuchs fing an, über den dünnen schwarzen Schwanz des Katers zu spotten.
Da fauchte der Kater und machte einen Buckel. Auf seinem Schwanz sträubten sich die Haare, doch gegen den Fuchsschwanz wirkte er nur wie eine alte Flaschenbürste. Ärgerlich darüber, dass nun noch jemand sein Loch kannte, spreizte der Fuchs die Vorderpfoten, bleckte die Zähne, und als sich auf seinem langen roten Schwanz die Haare sträubten, schien der Haselstrauch zu brennen. „Gock-gock-gock!“ warnte der Hahn und scheuchte seine Hennen aus der Nähe
des Loches, wackelte mit seinem Kamm und drohte mit dem Schnabel.
Der Fuchs hatte gedacht, der Kater be ache den Hühnerhof. Aber am nächsten Morgen beobachtete er, wie geduckt der Kater den Hühnerhof überquerte. Die Hühner flatterten ihm zwar gackernd aus dem Weg, der Hahn aber lief mit langen Schritten auf den Kater zu, sprang in die Höhe und hackte ihn ins Ohr.
„Wie ich sehe“, sagte der Fuchs, „hat der Hahn auch für dich nicht viel übrig.“
„Es war das letzte Mal, das schwöre ich!“ knurrte der Kater und fuhr sich mit seiner Pfote, nachdem er sie angeleckt hatte, über das verletzte Ohr, das noch andere Scharten aufwies.
Mit dem Kater muss ich mich gut stellen, dachte der Fuchs. Fortan brachte er ihm hin und wieder eine Maus mit,
die er auf seinen nächtlichen Pirschgängen im Wald gefangen hatte. „Du bist doch eigentlich ein tapferer Kerl“, sagte er, wenn er den Kater traf. „Aber dein Schwanz ist ganz dürr vom vielen Hungern! Du musst zu Kräften kommen. Dann wirst du es dem Hahn schon zeigen.“
„Ich wusste, dass du mich verstehst“, entgegnete schnurrend der Kater. „Schon lange bewundere ich dich, wie geduldig du hier lauerst, wie flink du in den Hof schlüpfst und dir eins dieser dicken dummen Hühner schnappst, ehe dich der Gockel erblickt hat. Das schönste an dir ist aber, finde ich, dein langer, roter, buschiger Schwanz mit der weißen Spitze.“
„Danke“, sagte der Fuchs und leckte sich geschmeichelt das Fell. „Leider hat ihn der Gockel mir ein bisschen verschandelt.“
„Ach, man sieht es kaum“, entgegnete der Kater. „Aber mein Ohr! Es tut sehr weh! Dabei habe ich ihm gar nichts getan.“
„Wenn ich dir damit einen Gefallen tun kann, hole ich beim nächsten Mal den Hahn.“
„Das wäre sehr aufmerksam“, miaute der Kater, „aber ich glaube, das ist eine außergewöhnlich schwierige Aufgabe.“
„Gemeinsam schaffen wir es“, sagte der Fuchs und blinzelte.
„Ja! Versuchen wir es!“, fauchte der Kater. „Ich will meine Rache!“
Der Hahn passte genau auf seine Hühner und ihre Küken auf. Er stolzierte, während die Morgensonne in sein Gefieder schien, so dass es bunt schillerte, zwischen ihnen umher. Er dachte: Wenn der Fuchs meinen prächtigen feurigen Schwanz sieht, überlegt er es sich vielleicht noch einmal, ob er es mit mir aufnimmt. Fand er ein paar Würmer, ein paar Körner oder eine Raupe, rief er sein Federvieh. Zuerst pickte er selbst ein wenig, dann überließ er großzügig den Hennen seinen Fund. Auch wenn er sich mit ihnen in den Sand legte und sein Gefieder darin badete, hatte er seine Augen überall. Er wollte nicht noch eine Henne verlieren. Meistens gelang es ihm, den Kater zu vertreiben, wenn er sich an die Küken heranschlich. Sobald der Fuchs auftauchte, fühlte sich der Hahn machtlos. Wenn der Rotpelz sich morgens in den Hühnerhof schlängelte und ein Strahl der aufgehenden Sonne in seinen buschigen Schwanz leuchtete, erstarrten alle Hühner, wo sie gerade standen, und das Korn blieb ihnen im Schnabel stecken. Gemächlich konnte der Fuchs zwischen ihnen herumspazieren und sich seinen Leckerbissen aussuchen. Nur dem flügelschlagend herbeilaufenden Hahn brauchte er auszuweichen. Aber die Flügel des Hahnes waren verschnitten. Immer kam er zu spät, der Fuchs hatte schon eine Henne gepackt. Selbst wenn es ihm gelang, dem Räuber den Weg abzuschneiden, blieb ihm als Waffe nur sein Schnabel. Damit drang er nicht durch den Pelz des Fuchses. Selten riss er ihm ein paar rote Haare aus. Nie erwischte er ein Ohr. Auch die Sporen an den Füßen des Hahnes waren gestutzt. „Meinem Onkel in Spanien“, seufzte er, wenn er wieder um eine seiner Hennen trauerte, „werden sogar kleine Messerchen an die Sporen gebunden. Aber wozu? Nur damit er einen anderen Hahn im Kampf tötet! Was gäbe ich darum, wenn ich mit solchen Waffen auf den Fuchs losgehen könnte!“
Erst wenn der Fuchs jenseits des Zauns waldwärts lief, die Schnauze mit seinem Raub hocherhoben, kam wieder Leben in die Hühner. Sie pickten weiter, badeten in ihren Sandlöchern und waren froh, dass der Fuchs sich ein anderes ausgesucht hatte. Die fleißigste Henne suchte ihr Nest auf, um für Herrn Meier ein Frühstücksei zu legen. Wenn sie fertig war, gackerte sie laut: „Herbei! Herbei! Hol dir dein Ei! Hol dir dein Ei!“
Eigentlich hätte der Hund aufpassen müssen. Er schwänzelte auch manchmal zwischen den Hühnern umher und brummte gutmütig, wenn sie aufgeregt gackerten. Den Hahn lud er sogar an seinen Fressnapf ein, um sich mit ihm zu unterhalten. „So ein Lümmel!“, knurrte der Hund, wenn sich der Hahn bei ihm über den Fuchs beklagte, leckte sich das satte Maul, schlug müde mit dem zottigen Schwanz, legte dann den Kopf auf die Vorderpfoten und schlief ein. Der Hund schlief viel und fraß gern. Er hatte seinem Herrchen in einem langen Hundeleben viele Dienste geleistet und wurde noch immer, obwohl er nichts Nützliches mehr tat, jeden Tag reichlich gelobt. Der Fuchs, dachte er, ist mir ohnehin über. Deshalb tue ich lieber so, als bemerke ich ihn gar nicht.“
1984 erschien im Buchverlag Der Morgen Berlin „Der Verbannte von Tomi. Historische Erzählungen“ von Volker Ebersbach: Eine Ehebruchsaffäre ließ ihn stolpern, den berühmten Verfasser der „Liebeskunst“: Ovid, unfreiwillig Mitwisser einer Liaison der Julia, Enkelin des Kaisers Augustus, und kurze Zeit danach verbannt nach Tomi, dem heutigen Constanta am Schwarzen Meer in Rumänien. Der Zusammenhang geht dem Dichter erst allmählich auf, glaubte er doch mit seiner „Ars amatoria“ politisch verfänglichen Tendenzen aus dem Wege gegangen zu sein. Erst in der Verbannung, in den Gesprächen mit seinem Bewacher und der uneingestandenen Liebe zu dessen Tochter Lilla, entdeckt er allmählich den tieferen Zusammenhang zwischen erotischem Freimut und politischem Liberalismus. Augustus, der mit verschärften Ehegesetzen restaurativ in die römische Gesellschaft eingriff, musste Ovids Liebesdichtung, die gerade die Ehe ausklammert, als subversiv ansehen. Ovids Hoffnung, der Kaiser werde seine Verbannung aufheben oder mildern, erweist sich als trügerisch.
Ovid, Seume und Dostojewski – um diese Berühmten der Literatur rankt Volker Ebersbach seine drei historischen Erzählungen. Immer ist es die aktuelle Krisensituation, die ihn reizt, dem Dichter in der Auseinandersetzung mit sich und seinem Werk nachzuspüren. Authentisches Material und frei Erfundenes gehen eine gelungene Synthese ein, die den Leser auf historischem Hintergrund mit dem geistigen Ringen um Wahrhaftigkeit in der Kunst vertraut macht. Hier der Beginn der titelgebenden Erzählung über Ovid:
„Der Verbannte von Tomi
- Ankunft
1
Am späten Nachmittag verbreitete sich in der Stadt das Gerücht, das Gepäck eines römischen Verbannten sei eingetroffen. Der Stadtpräfekt Sextus Quillius Postumus wurde aus seinem Wohnhaus zum Hafen gerufen. Zunächst fertigte der Türhüter den Boten des römischen Schiffes „Cassis“ mürrisch ab. Der Präfekt werde sich morgen darum kümmern. Doch der Seemann, nicht willens, sich von einem Sklaven abweisen zu lassen, betrat mit seinen knarrenden Stiefeln den Vorraum, ohne auf die Einwände des Türhüters zu achten. Da durchquerte die Frau des Präfekten, eine Getin, mit langen Schritten das Atrium und verstellte dem Boten keifend den Weg. Aus dem holprigen Gemisch griechischer und getischer Satzfetzen, denen das Weib mit barbarischer Wucht Beschimpfungen in ihrer Muttersprache nachschleuderte, schloss der Bote, dass sie die Stille zu schützen vorgab, in der sich der Hausherr um die rhetorischen Übungen seines Sohnes Lucius kümmerte. Sie verstummte erst, als Quillius Postumus selbst hinter ihr erschien, seinem beherrschten, an langes Schweigen gewohnten Gesicht mit Mühe die Fassung bewahrte und unter Anrufung der Götter sein tristes Schicksal beklagte. Klatschend schlug er sich mit dem Stock, der den Fleiß seines Sohnes überwachte, in die Handflächen, warf wie eine dritte und siegreiche sprachliche Streitmacht knappe lateinische Befehle in das Gefecht aus griechischer Rede und getischer Widerrede und stiftete einen Römischen Frieden im Kleinen.
Der Bote gab nun das Griechische auf und wiederholte seine Meldung in der Sprache der Weltbeherrscher. Die Getin schlurfte in die Weiberstube und schnatterte dort mit ihrer Tochter weiter. Auch der Präfekt wandte ein, die Gepäckstücke könnten getrost eine Nacht auf dem Schiff bleiben. Er habe keinerlei Nachricht, dass ein Verbannter aus Rom unterwegs sei nach Tomi: Was er denn mit diesem Gepäck zu tun habe! Was für eine Schlamperei, ihm noch einen Verbannten in die schlecht befestigte Stadt zu schicken! Der eine, den er schon habe, der hundertjährige Lump aus Athen, sei ihm lästig genug. Alle seine Kräfte binde hier der äußere Feind. Die Bewachung eines Staatsverbrechers – es sei doch wohl einer? – stelle für ihn eine Zumutung dar. Was man sich auf dem Palatin in Rom denn dächte!
Der Bote wartete respektvoll, ohne etwas Neues zu erwidern: Das Gepäck müsse in Tomi ausgeladen werden, der Besitzer komme von Thrakien her auf dem Landweg nach und wolle es ordnungsgemäß hier vorfinden. Die kaiserliche Anweisung trüge der Verbannte selbst bei sich. Die Wetterlage lasse in den nächsten Tagen Sturm befürchten, das Schiff lichte deshalb noch vor Tagesanbruch den Anker und segle nach Histria weiter.
„Aha“, sagte der Präfekt und wies dem Boten im Atrium eine Sitzgelegenheit zu. „Und man lässt ihn so einfach den Landweg benutzen? Man ist sicher, dass er hier ankommt? Gerade Thrakien ist unzureichend befriedet, für Staatsverbrecher ein idealer Schlupfwinkel!“
Der Bote radebrechte, der Verbannte sei ein vornehmer Herr. Er habe sein Wort gegeben und dafür einen Begleitsoldaten erhalten. Die kaiserliche Anweisung ordne schonendste Behandlung an und schlösse jeden Fluchtversuch aus. Sie trage das persönliche Siegel des Kaisers.
„Also tatsächlich ein Staatsverbrecher“, seufzte der Präfekt und erhob sich, um den Boten zum Hafen zu begleiten.
„Vielleicht kein so schwerer“, stammelte der griechische Seemann. „Denn er ist zwar verbannt worden, hat aber weder sein Vermögen noch sein Bürgerrecht verloren. Er beteuert jedermann seine Unschuld und nennt sich einen in Ungnade gefallenen Dichter.“
Der Präfekt lachte auf. „Das glaube ihm, wer will. Ich kenne die Ungnade des Augustus. Wegen eines Dichters bemüht er sie nicht.“
Er nahm seinen Mantel, schickte einen Sklaven hinüber zur Präfektur, um den Schreiber zu benachrichtigen, und folgte dem Boten zum Hafen.
2
Lucius Quillius, der Sohn des Stadtpräfekten, rollte die rhetorischen Abhandlungen zusammen und legte sie ins Regal. Er beschloss, diesen unerwarteten Urlaub vom Lateinischen zu feiern, und nahm sich die griechischen Dichtungen vor, die sein Vater stillschweigend duldete, obwohl er sie verachtete, wenige Gesänge des waffenklirrenden Homer, ein paar Oden des taktgewandten Pindar, eine Sammlung des süßen und zugleich kenntnisreichen Kallimachos, alles Papyrusrollen, die Artemisios, der reichste griechische Kaufmann des Ortes, bei seinem Ableben vor zwei Jahren dem Präfekten für die Erziehung seines lesehungrigen, aufgeweckten Jungen vermacht hatte.
Er las nicht lange. Immer wieder stellte er eine faustgroße Bronzebüste seines Lieblingsdichters Kallimachos, ebenfalls ein Erbstück des Kaufmanns, auf die Stelle der Rolle, wo er seine Lektüre unterbrach, blickte zur Decke des Raumes, murmelte etwas und skandierte dazu mit der Hand das Versmaß. Die hehre „Ilias“ des Homer, die ihm der Vater im Gegensatz zu der zweiflerischen, wehleidigen und, wie er sich ausdrückte, östlich zwiespältigen „Odyssee“ erlaubt hatte, regte ihn zu eigenen Versen an, zu einem kleinen Epos über den Bürgerkrieg der Römer, einer bescheidenen poetischen Darstellung des für die ganze Welt heilsamen Aufstiegs Oktavians zum Augustus, zum ersten Bürger Roms, zum weisen, gütigen und gerechten Lenker der Staatsgeschicke, den bei seinem, wie zu hoffen war, noch fernen Hinscheiden gewiss die Götter unter sich aufnehmen würden.
Der Vater, froh, dass der frühreife Knabe dafür die unverbindlichen Lyrismen aufgab, mit denen er begonnen hatte, erlaubte ihm das Versemachen unter der Bedingung, dass er das zunächst griechisch entworfene Werkchen anschließend ins Lateinische übersetzte. Anfangs hatte der Stadtpräfekt versucht, ihm „die Verse aus dem Hintern zu trommeln“. Doch von Artemisios war der gutnachbarliche Rat gekommen, ein so begabtes Kind nicht in allzu strenge Verbote zu zwängen. Was man früh lerne, könne man später einmal gewinnbringend anwenden. Es sei vielleicht schon unklug gewesen, den freundschaftlichen Umgang mit dem hundertjährigen athenischen Philosophen zu unterbinden. Von ihm hatte das Kind Griechisch gelernt, noch ehe der Vater es aus der Weiberstube holte, um ihm das Lateinische einzubläuen. Der hundertjährige Lump in seiner hündischen Hütte am Stadtrand hatte in den Halbgeten, der gleichsam in den Hosenbeinen seiner barbarischen Mutter herangewachsen war, zum ersten Mal das wohlgestaltete Gewächs einer Kultursprache gepflanzt, denn auch das Griechisch der Ortsansässigen klang wild und hart.
Der Stadtpräfekt hoffte nach mehr als dreißig Jahren Dienst nicht mehr, in das heimatliche Rom zurückberufen zu werden. So setzte er seinen Ehrgeiz daran, seinem Sohn Lucius, sobald ihm die getische Mutter nicht mehr anzumerken wäre und sein Latein ebenso leicht dahinflösse wie das Griechische, mit einem Zehrgeld nach Rom zu schicken. Quillius hatte in jungen Jahren, ehe der Bürgerkrieg zwischen Oktavian und Antonius ihn unter die Soldaten rief, selbst eine rhetorische Ausbildung begonnen und kannte ihren Wert. Vielleicht schaffte es Lucius, in der Hauptstadt die Kunstfertigkeit seiner Rede zu vervollkommnen und Advokat zu werden. Vielleicht gelänge es ihm, in den Kanzleien die längst zugesagte, nur immer wieder verschleppte Rückgabe der väterlichen Güter in Apulien zu erwirken. Der Präfekt schloss nicht aus, ein Gedicht in lateinischen Versen über die Taten des Kaisers, des Vaters des Vaterlandes, werde seinem Sohn in Rom alle Türen öffnen.
Lucius nahm die kleine Bronzebüste vom Text des Homer, rollte ihn wieder ein und verschnürte die Bänder. Die Nachricht, das Gepäck eines Verbannten sei eingetroffen, beschäftigte seine Gedanken so sehr, dass ihm die Verse zerrannen wie verschütteter Wein, der den Kelch nicht erreicht, weil man, erregt durch ein Gespräch bei Tisch, den Lederschlauch ungeschickt angefasst hat. Wenn das Gepäck eintraf, musste der Verbannte bald selbst erscheinen. Und er käme aus Rom.“
Erstmals 1997 veröffentlichte Volker Ebersbach im Hans Boldt Literaturverlag Winsen/Luhe und Weimar (Weimarer Reihe) „Der träumerische Rebell Heinrich Heine. Anekdoten“: In Heinrich Heines Leben hat sich vieles ereignet, das sich anekdotisch erzählen lässt, das geradezu darauf wartete. Das hat Volker Ebersbach zum 200. Geburtstag des Dichters getan.
In mehr als zweihundert Anekdoten rollt das Leben Heines vor uns ab, seine Kindheit und Jugend in Düsseldorf, die Studentenzeit in Göttingen und Berlin, seine Aufenthalte in Hamburg und Lüneburg, die Reisen, das Leben im Exil in Paris, sein rührendes Verhältnis zu Mathilde und die Leidensgestalt in der Matratzengruft. Wir erleben den Dichter als romantisch-zerrissenen Jüngling und als heiteren wie ernsten Spötter, auch über sich selbst.
Dabei begegnen wir vielen bekannten Persönlichkeiten, so insbesondere Robert Schumann, Ludwig Börne, Friedrich Hebbel, Giacomo Meyerbeer, Ferdinand Lassalle, Karl Marx und Honoré de Balzac. Hier ein paar Beispiele für die insgesamt 206 Heine-Anekdoten:
Pressemitteilung
Der „Frankfurter Telegraf“ enthielt 1837 eine Notiz, in der Heine auf die Frage, ob er nach Deutschland zurückkehre, antwortet: „Recht gern, wenn mir erst sämtliche deutschen Festungen ausgeliefert werden.“
Vorauseilender Gehorsam
Der mit Karl Marx befreundete Publizist und Politiker Arnold Ruge, den Heine einen „Trommelschläger der Hegelschen Philosophie“ nannte, und ein Freund plauderten in der Rotunde des Palais Royal mit Heine. „Wie geht’s in Deutschland?“, fragte Heine. „Sind die Gefängnisse bald voll? Wie viele Staatsfeinde haben sich schon bereit erklärt, ihr Zimmer als Zelle einzurichten, um der Regierung die Kosten zu ersparen?“
„Damit beziehen Sie sich wohl auf Preußen“, meinte Ruge.
„O nein, im Gegenteil! Die Preußen sind es schon gewohnt, Staatsgefangene zu sein. Aber andere eifern ihnen nach.“
„Sehen Sie dort“, mischte sich flüsternd Ruges Freund ein, „da sitzt ein preußischer Spitzel.“
Ruge schüttelte den Kopf. „Es gibt keine preußischen Spitzel. Die Preußen sind zu geizig, Spitzel zu bezahlen.“
„Aber die unbezahlten“, sagte Heine, „die unbezahlten Spitzel sind die schlimmsten.“
Qual der Wahl
Ruge schrieb am 4. September 1843 aus Paris an seine Mutter, Heine übertreibe seine Furcht vor deutschen Kerkern: „Es ist ihm ebenso unangenehm, nicht die Festung zu verdienen, als es ihm unangenehm wäre, sie zu genießen.“
Trauerspiel
In einem Pariser Salon las der dänische Dichter Adam Gottlob Oelenschläger auf Deutsch, aber mit dänischem Akzent, sein neues, recht schwaches Trauerspiel vor. In die betretene Stille danach sagte Heine: „Ich hätte nie gedacht, dass ich so gut Dänisch verstehe.“
13 Spitze gegen sich selbst
Bis 1846 hatte Heine die Idee nicht aufgegeben, auch als Dramatiker werde er noch zu Ruhm kommen. Der Dichter Gérard de Nerval übersetzte ihm gern einige Szenen einer Komödie, damit er sie einreichen könne. Als sie einander nach etwa zwei Monaten wiederbegegneten, fragte Nerval, ob die Komödie angenommen worden sei. Heine schüttelte missmutig den Kopf. „Ich habe sie zurückgehalten. Ich wollte die Kulissen nicht in Versuchung führen, statt des Publikums zu lachen.“
1 Sehergabe
Dem jungen Ferdinand Lassalle, der 1846 nach Paris kam, sagte Heine eine große Zukunft in Deutschland voraus. „Was nennen Sie eine große Zukunft?“, fragte Lassalle.
„Von einem Ihrer Schüler erschossen zu werden“, lachte Heine.
Bei der nächsten Begegnung entschlüpfte dem späteren Sozialistenführer: „Ich will Deutschlands Mirabeau werden.“
„Sie sind nicht pockennarbig“, gab ihm Heine zu bedenken. „Sie sind ein hübscher Junge. Sie könnten ein großer Schauspieler werden. Eine verkrachte Schauspielerin wird Sie kapern.“
Alles traf fast genauso ein.
Nicht zu Hause
Für Deutsche, die er nicht kannte, war Heine grundsätzlich nicht zu Hause. Mathilde pflegte sie freundlich lächelnd abzuweisen: „Monsieur Eene n’est pas chez lui.“ Sie hatte sich angewöhnt, „Eene“ zu sagen, da „Heine“ in französischer Aussprache wie das französische Wort für „Hass“ klang. Mancher Besucher fragte weiter: „C’est déjà longtemps qu’il est sorti?“ Blieb er unverdächtig, ein revolutionärer Handwerker oder ein neugieriger Tourist zu sein, konnte es geschehen, dass eine dünne, hohe Stimme aus dem Nachbarzimmer rief: „II n’est pas encore sorti.“
Ein besonders aufdringlicher Besucher traf Heine in der Tür. „Herr Heine ist nicht zu Hause“, war der Bescheid.
„Wenn ich nicht irre, sind Sie selbst Herr Heine.“
„Wenn ich es auch bin, so bin ich doch nicht zu Hause.“
„Ich komme von Herrn Börnstein, der hat mich sehr freundlich aufgenommen und sagte …"
„Wenn er Sie so freundlich aufgenommen hat, dann gehen Sie doch wieder hin! Und sagen Sie ihm, er soll mit Besuchern erst mal meine Erfahrungen machen.“
Zensur 1
In seiner Erregung über Verstümmelungen seiner Publikationen sagte Heine einmal: „Dante hätte eine eigene Höllenstrafe für Redakteure erfunden, wenn er Florentiner Korrespondent der Allgemeinen Zeitung gewesen wäre.“´
Das dürfte genügen, um auf diese Anekdoten-Sammlung und nicht zuletzt auch wieder einmal auf Heine und sein vielfältiges Werk aufmerksam zu machen. Vielleicht haben Sie (hoffentlich) Lust bekommen, wieder einmal Heine zu lesen?
Viel Vergnügen dabei, weiter ein schönen Februar und bleiben Sie weiter vor allem schön gesund und munter. Und bis demnächst.
EDITION digital war vor 27 Jahren ursprünglich als Verlag für elektronische Publikationen gegründet worden. Inzwischen gibt der Verlag Krimis, historische Romane, Fantasy, Zeitzeugenberichte und Sachbücher (NVA-, DDR-Geschichte) sowie Kinderbücher gedruckt und als E-Book heraus. Ein weiterer Schwerpunkt sind Grafiken und Beschreibungen von historischen Handwerks- und Berufszeichen sowie Belletristik und Sachbücher über Mecklenburg-Vorpommern. Bücher ehemaliger DDR-Autoren werden als E-Book neu aufgelegt. Insgesamt umfasst das Verlagsangebot, das unter www.edition-digital.de nachzulesen ist, mehr als 1.100 Titel. E-Books sind barrierefrei und Bücher werden klimaneutral gedruckt.
EDITION digital Pekrul & Sohn GbR
Alte Dorfstraße 2 b
19065 Pinnow
Telefon: +49 (3860) 505788
Telefax: +49 (3860) 505789
http://www.edition-digital.de
Verlagsleiterin
Telefon: +49 (3860) 505788
Fax: +49 (3860) 505789
E-Mail: editiondigital@arcor.de
![]()