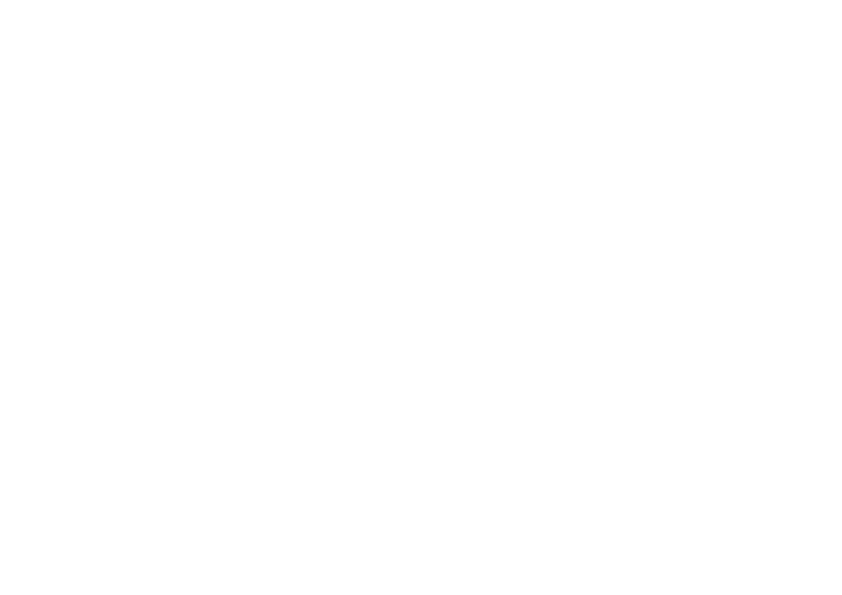HSV-Grundstücksdeal mit fadem Beigeschmack
Anfangs klang es nach einem vernünftigen Deal: Die Stadt Hamburg kaufte dem Fußballverein Hamburger SV das Grundstück, auf dem unter anderem das Volksparkstadion steht, für 23,5 Mio. Euro ab – nicht das Stadion selbst. Gleichzeitig vergab die Stadt an den HSV ein Erbbaurecht bis 2087 mit einer Verlängerungsoption bis 2117. Der jährliche Erbbauzins beträgt 1,8 Prozent des Verkehrswerts. Zu diesen Konditionen unterzeichneten die Verantwortlichen im September 2020 eine Absichtserklärung („Letter of Intent“). Die Vereinbarung steht im Zusammenhang mit der Bewerbung Hamburgs als Austragungsort der Fußball-Europameisterschaft 2024. Der Plan schien vernünftig, denn er versetze den klammen Club in die Lage, die notwendigen und von der UEFA verlangten Investitionen in sein Stadion „aus eigener Kraft zu schultern“, sagte Hamburgs Finanzsenator bei der Vorstellung der Absichtserklärung. Nach ersten Schätzungen sind für die Renovierung des Stadions zwischen 20 und 30 Mio. Euro notwendig.
Bereits diese Vereinbarung hatte der Bund der Steuerzahler kritisiert. Es bestanden erhebliche Zweifel, ob das privatwirtschaftliche Risiko des HSV nun per Grundstücksverkauf auf die Stadt Hamburg übertragen werden sollte. Offensichtlich waren die Bedenken begründet. Wie aus dem erst Anfang des Jahres öffentlich gewordenen Kaufvertrag zwischen der Stadt und dem HSV hervorgeht und wie beide Parteien bestätigten, darf der Club die Einnahmen für den Grundstücksverkauf auch anderweitig einsetzen – zum Beispiel für die laufenden Kosten. Die 23,5 Mio. Euro dienen zwar als finanzielle Unterstützung, um das Volksparkstadion zu modernisieren, explizit dafür eingesetzt werden muss die Zahlung aber nicht.
Petra Ackmann: „Die Steuerzahler haben nicht die Aufgabe, für die Managementfehler von Fußballvereinen geradezustehen. Der BdSt sieht die Gefahr, dass Hamburg im Falle einer Zahlungsunfähigkeit des HSV am Ende weder ein saniertes Stadion hat noch Erbpachterlöse erzielt. Kritik üben wir zudem an der Art der Kommunikation: Hier fehlte von Beginn an Transparenz.“
Fahrradparkhaus Kellinghusenstraße:
Millionen-Flop statt Vorzeigeprojekt
3 Mio. Euro hat das öffentliche Fahrradparkhaus direkt an der U-Bahn Kellinghusenstraße in Eppendorf gekostet, doch genutzt wird es auch Monate nach der Eröffnung so gut wie nicht. Platz ist dort für 600 Räder, 145 Stellplätze davon sind extra gesichert und lassen sich für 1 Euro am Tag mieten. Doch wie sieht es in der Realität aus? Kein Rad im Obergeschoss – und das seit Monaten! Und die Auslastung im kostenpflichtigen, abschließbaren Teil ist spärlich. Vielen ist der Umweg zu weit – sie lassen ihr Rad lieber irgendwo im Bahnhofsumfeld stehen. Ein weiteres Manko: Eine viel zu schmale Rampe am Eingang macht es denjenigen, die mit Satteltasche unterwegs sind, fast unmöglich, leicht und sicher zum Stellplatz zu kommen. Auch die Stufen sind zu hoch. Ein weiterer Kritikpunkt ist die Anbindung des Fahrradparkhauses selbst: Eine spezielle Zufahrt gibt es nicht, sodass Nutzer kompliziert die Straße beziehungsweise den Bürgersteig queren müssen.
Der Verkehrssenator hält trotzdem an seinem Plan fest, weitere Fahrradparkhäuser zu bauen – das nächste am „Schlump“, weitere Standorte sind in Hamburg-Harburg, der neue Fernbahnhof Diebsteich sowie der Hauptbahnhof.
Petra Ackmann: „Auch wenn Fahrradparkhäuser grundsätzlich sinnvoll sind, kommt das Hamburger Konzept bei Radfahrern offensichtlich nicht an. Durch eine Befragung ließen sich die Gründe dafür herausfinden. Die Ergebnisse müssten dann in die Planung der weiteren Fahrradparkhäuser einfließen, um zu verhindern, dass aus einem Flop vielleicht fünf oder noch mehr werden.“
„Haus der Erde“ wird zum Millionen-Desaster
Im „Haus der Erde“ (Geomatikum) sollen mehrere Institute mit verschiedenen und zum Teil erhöhten Anforderungen an die Raumluft (etwa Temperatur, Luftfeuchtigkeit) untergebracht werden. Dieser Neubau der Universität Hamburg wird nun deutlich teurer als geplant. Statt der vorgesehenen 177 Mio. Euro werden für das „Haus der Erde“ mindestens 303 Mio. Euro fällig. Das geht aus einem Antrag des Senats zur Nachbewilligung von insgesamt 157 Mio. Euro hervor. Ursprünglich sollte der Neubau bereits 2019 fertig sein, nun gehen die Planer von 2024 aus.
Gründe für die Verzögerungen sind laut zuständiger Finanzbehörde im Wesentlichen Planungsmängel im Bereich der Lüftungs- und Klimatechnik, deren komplexe Anforderungen von den externen Planungsbüros erst zu einem sehr späten Zeitpunkt erkannt wurden. Auch Planungsüberarbeitungen führten zu erheblichen Mehrkosten. Folgekosten ergeben sich auch aus den notwendigerweise veränderten Bauabläufen und Beschleunigungsmaßnahmen. Die zuletzt sehr hohen Baupreissteigerungen verstärken diesen Effekt. Laut Finanzbehörde laufen gegen verschiedene Projektbeteiligte bereits Klagen, um die entstandenen Schäden erstattet zu bekommen. Diese Kostensteigerungen haben noch einen weiteren Aspekt: Die Universität, die das Haus von der landeseigenen Vermietungsgesellschaft Gebäudemanagement Hamburg (GMH) mieten soll, wird laut Medienberichten wegen der höheren Baukosten am Ende jährlich 17 Mio. Euro statt 11 Mio. Miete bezahlen müssen – vorausgesetzt, die aktuellen Planungen bleiben bestehen.
Petra Ackmann: „Die erneute Kostensteigerung beim „Haus der Erde“ macht deutlich, dass der Senat trotz vieler Beteuerungen zum kostenstabilen Bauen nichts gelernt hat. Das Bedauerliche: Die gleichen Themen, die bereits beim Bau der Elbphilharmonie und beim CCH zu enormen Kostensteigerungen geführt haben, sorgen auch bei diesem Projekt für eine Eskalation. Offensichtlich ist die Stadt mit großen Projekten überfordert.“
Großer Flop statt „Kleiner Wildnis“
Nachdem im Spätsommer 2018 eine parkähnliche Fläche in Osdorf, die einst Teil einer Gärtnerei war, für circa 660.000 Euro aufwendig hergerichtet worden war, verlangen Altonas Bezirkspolitiker nun eine erneute Umgestaltung. Die ursprüngliche Gestaltung der Anlage wird als Fehlinvestition, Unfug und sogar als „totaler Mist“ bezeichnet. Die Anlage wird in der Gegend inoffiziell „Kleine Wildnis“ genannt – und das aus gutem Grund: Der kleine Park wird nur sporadisch gepflegt.
Rückblick: Nach langer Planungsphase mit großer Bürgerbeteiligung und einem aufwendigen Umbau, hatte sich der Mini-Park in neuer Aufmachung gezeigt. Neue Wege waren in der Grünzone angelegt worden und Böschungen befestigt. Als besondere Attraktion wurden grüne, futuristisch gestaltete Möbelgruppen präsentiert. Daneben schlängeln sich aus toten Ästen gebildete sogenannte Benjeshecken durchs Unterholz. Die Kosten für 1.100 m dieser Totholzhecken belaufen sich laut zuständiger Behörde auf 28.180 Euro. Inzwischen ist von der anfänglichen Zustimmung nichts geblieben. Die Möbel werden so gut wie nie genutzt und von vielen auch gar nicht richtig wahrgenommen. Die Kunststoffobjekte – immerhin 21.100 Euro teuer – wurden zudem in so großem Abstand zueinander aufgestellt, dass man sie gar nicht sinnvoll nutzen kann. Außerdem sind sie unbequem, und auf den Tischen sammelt sich das Regenwasser. Auch eine Grundidee der Gestaltung erwies sich nach der Umsetzung als problematisch: Von Anfang an gehörte es zum Konzept, die Grünanlage so natürlich wie möglich zu belassen. Überall wuchert es nun also. Die kleinen und unübersichtlichen Wege sind zwar mit Schottersteinen belegt, wirken aber eher wie Trampelpfade. Und da sich gleich in der Nähe ein befestigter Weg befindet, werden sie auch kaum genutzt.
Altonas Bezirkspolitiker wollen nun reagieren und ihren schlimmen Fehler mit noch mehr Steuergeld korrigieren: In einem entsprechenden Antrag wird das Bezirksamt aufgefordert, „Ausstattungsalternativen für die beschädigte Möblierung vorzustellen“. Einige Politiker in der Bezirksversammlung, die einst für die Umgestaltung gestimmt haben, lehnen diese jetzt vehement ab: „Uns wurden damals Computeranimationen vom Bezirksamt gezeigt, auf denen das alles ganz prima aussah.“
Petra Ackmann: „Was am Computer wunderschön aussieht, kann in der Realität schnell schiefgehen. Die Verantwortlichen hätten sich besser vor Ort ein Bild machen sollen. So aber bleibt der Eindruck, dass die Politik hier ein Prestigeobjekt schaffen wollte und dabei nicht auf Funktionalität und Akzeptanz geachtet hat. Wenn das Konzept von vornherein vorsah, dass der kleine Park sich selbst überlassen wird, hätte man das auch für wenig Geld haben können.“
Schranken-Wahn auf dem Ohlsdorfer Friedhof
Eine Verkehrszählung hat ergeben, dass mehr als 5.000 von 8.600 Fahrzeugen, die täglich auf den Ohlsdorfer Friedhof fahren, das Areal lediglich zur Durchfahrt nutzen. Dadurch würde laut Friedhofsverwaltung die Ruhe des Friedhofs gestört. Das sollte eine Schranke ändern. Während sich einige Friedhofsbesucher über die neu gewonnene Ruhe freuen, kritisieren andere, dass selbst ein kurzer Besuch nicht mehr möglich sei, weil man jetzt – abhängig vom Wohnort – um den ganzen Friedhof herumfahren müsse. Wegen der Umstellung bekam die Friedhofsverwaltung in der Anfangsphase laut Medienberichten täglich mehr als 100 Beschwerden. Der Bau der Schranke sorgte nicht nur unter den Pendlern und Friedhofsbesuchern für Unruhe. Auch die Kosten dafür waren sehr hoch. Laut Medien soll das Projekt „Schranke“ 448.000 Euro gekostet haben – das ergab eine Antwort des Senats an CDU-Abgeordnete. Diese Zahl bestätigte die zuständige Behörde nicht: Das Schrankensystem habe 114.172 Euro gekostet. Zusätzlich sei ein Glasfasernetz ausgebaut worden. Die Endabrechnung weise dafür Kosten in Höhe von 249.639 Euro aus – macht zusammen also 363.811 Euro. Wegen technischer Probleme musste Personal an der Schranke bereitgestellt werden. Von Oktober bis Dezember fielen daher auch Personalkosten in Höhe von 18.606,80 Euro an. Unter anderem konnte die Schranke nicht von der weit entfernten Zentrale geöffnet werden, wenn ein Autofahrer um die Durchfahrt bat. Da sind die Kosten für nachträglich angeschaffte Hinweisschilder in Höhe von 1.500 Euro fast zu vernachlässigen. Petra Ackmann: „Die schlecht gemachte Durchfahrtsbeschränkung kommt die Steuerzahler teuer zu stehen. Eine intelligente Schrankenlösung, die die Durchfahrtszeiten der Autos kontrolliert und den unerwünschten Durchgangsverkehr damit unterbindet, wäre deutlich kostengünstiger gewesen, als neues Personal für die Bedienung der Schranke zu beschäftigen.“
Updates zu Fällen aus dem vorigen Schwarzbuch:
Nutzlos-Brücke kostet Millionen
Bereits seit mehr als 30 Jahren ist der Wiederaufbau der im Zweiten Weltkrieg zerstörten Maurienbrücke im Hamburger Stadtteil Barmbek-Süd geplant. Über sie soll man mit dem Rad oder zu Fuß den Osterbekkanal überqueren können. Dabei gibt es ganz in der Nähe schon zwei Brücken – die Hufnerstraßenbrücke und die Bramfelder Brücke (zwischen 100 und 200 m von der geplanten Brücke entfernt). Auch Anwohner hatten gegen den Brückenneubau mobilgemacht, weil er wertvolles Grün zerstöre. Sie hatten sogar eine Unterschriftenaktion gestartet. Der zuständige Bezirk Nord bleibt aber bei seinen Plänen und so wurde in diesem Jahr mit den Arbeiten begonnen.
Das allein ist schon schlimm genug. Doch die Behörde bekommt auch die Kosten nicht in den Griff: Das zuständige Bezirksamt Hamburg-Nord ging noch 2018 von Kosten in Höhe von 1,85 Mio. Euro aus. Ein Jahr später hieß es plötzlich, die Kosten würden sich auf rund 2,5 Mio. Euro belaufen. Inzwischen teilte die Behörde mit, dass auch diese Summe nicht ausreichen wird. Man rechne inzwischen mit 2,7 Mio. Euro. Davon entfallen 2,1 Mio. Euro auf die Baukosten und 600.000 Euro auf die Planungskosten.
Und es wird sogar noch teurer für die Steuerzahler: 250.000 Euro für die Bepflanzung rund um die neue Brücke möchte das zuständige Bezirksamt investieren. Paradox daran ist, dass ein Teil dieser Fläche vor dem Eingriff von den Anwohnern auf eigene Kosten gepflegt worden war. Nicht sicher ist allerdings, ob es tatsächlich bei den 250.000 Euro bleibt, weil die finale Freianlagenplanung erst im Herbst im Regionalausschuss Barmbek-Uhlenhorst vorgestellt werden soll.
Petra Ackmann: „Trotz eines Milliardendefizits im Haushalt hält die Stadt Hamburg an ihren Plänen fest, fast 3 Mio. Euro in den Wiederaufbau einer Brücke zu investieren, die bis heute niemand vermisst hat und die niemand braucht. Wenn an dieser Stelle nicht gespart wird, wo dann? Die schlechte Projektsteuerung durch Hamburger Behörden führt bei Bauprojekten zudem immer wieder zu immensen Kostensteigerungen. Offenbar gelingt es auch nicht mit den Prinzipien des „kostenstabilen Bauens“, eine einfache Brücke innerhalb des Budgets zu realisieren.“
Hamburg verschläft Software-Update
Bereits im Jahr 2012 hat Microsoft bekanntgegeben, dass der Support für Windows 7 zum 14.1.2020 eingestellt wird. Acht Jahre lang hatte die Stadt also Zeit, sich für ein anderes Betriebssystem zu entscheiden. Das hat offensichtlich nicht gereicht. Wie dem Bund der Steuerzahler auf Nachfrage mitgeteilt wurde, musste Hamburg allein für 2020 eine zusätzliche Supportgebühr in Höhe von 471.000 Euro zahlen. Weil die Umstellung auch ein weiteres Jahr später noch nicht abgeschlossen war, kamen für 2021 nochmals 412.000 Euro dazu. Konkret zahlt der Steuerzahler also 883.000 Euro dafür, dass Hamburg fast zehn Jahre benötigt hat, neue Betriebssysteme zu installieren. Im Januar 2020 war Windows 7 noch auf 8.000 Rechnern der Polizei installiert. Für jedes Gerät wurden im vergangenen Jahr zunächst 58,90 Euro an Sonderwartungsgebühren an Microsoft fällig – insgesamt also bereits fast eine halbe Mio. Euro. Wie eine erneute Kleine Anfrage der CDU ergab, war die Umstellung der Rechner auf die neue Version Windows 10 selbst im März 2021 nur etwa zur Hälfte abgeschlossen. Doch es gibt Hoffnung: „Die Implementierung von Windows 10 auf den wenigen verbliebenen Rechnern wird aller Voraussicht nach noch in diesem Jahr abgeschlossen sein, sodass keine weiteren Kosten erwartet werden“, sagt die Polizei Hamburg.
Übrigens: Microsoft kassiert für die veraltete Software 2021 pro Rechner doppelt so viel wie im vergangenen Jahr. Unterm Strich wird die Polizei damit in beiden Jahren jeweils rund eine halbe Mio. Euro bezahlt haben. 2021 allerdings eben nur für die halbe Nutzungsdauer.
Petra Ackmann: „Die mangelnde Digitalkompetenz des Hamburger Senats zeigt sich am Beispiel Windows 7 besonders deutlich. Die Umstellung auf Windows 10 ist ein Fall von nachlässigem Umgang mit Steuergeld, denn es hätte Geld gespart und gleichzeitig die Leistung der Verwaltung gesteigert werden können. In diesem krassen Fall von lahmender Umsetzungsgeschwindigkeit entstehen allerdings auch noch Sicherheitsprobleme, denn im konkreten Fall ist die Polizei betroffen.“ Der teuerste Lagerplatz Deutschlands?
Der Hamburger Hafen ist das Herz der Elbmetropole. Hier wird nicht nur viel Geld verdient, wovon die Stadt über Steuereinnahmen profitiert, sondern leider auch viel Steuergeld verschwendet. So auch bei der übereilten Räumung eines Firmengeländes im Mittleren Freihafen.
Die Miet- und Pachtverträge im Hafen sind in der Regel befristet, so auch im Gebiet Steinwerder. Da das Areal weiterentwickelt werden sollte, traf die Stadt mit einem ansässigen Logistikunternehmen, dessen Pachtvertrag ursprünglich bis Mitte der 2020er-Jahre laufen sollte, vor mehr als zehn Jahren eine Entschädigungsvereinbarung. Laut übereinstimmenden Berichten – genaue Details werden unter Berufung auf das Geschäftsgeheimnis des Unternehmens nicht veröffentlicht – zahlte die Stadt für die vorzeitige Freimachung des Geländes an das Logistikunternehmen rund 118 Mio. Euro. In manchen Medien ist sogar von 135 Mio. Euro die Rede. Die Fläche, die sich aus verschiedenen Grundstücken zusammensetzt, wurde 2016 und 2017 geräumt; bis dahin konnte das Unternehmen die Flächen dank kurzfristiger Pachtverträge weiterbetreiben. Diese Verträge wurden seitens der Stadt nicht mehr verlängert.
Allerdings wird die vorzeitig geräumte Fläche bis heute nicht so genutzt, dass eine vorzeitige Beendigung des Pachtvertrags inklusive Entschädigungszahlung und Räumung gerechtfertigt gewesen wäre.
Auf Nachfrage des Bundes der Steuerzahler, ob für das Areal ein Nachnutzungskonzept umgesetzt worden ist, hieß es aus der Wirtschaftsbehörde, „ein Planfeststellungsantrag soll im Frühjahr 2022 eingereicht werden“. Aktuell würde die zuständige Hamburg Port Authority (HPA) an der weiteren Ausarbeitung arbeiten.
Derweil musste die Stadt Hamburg weitere 6,2 Mio. Euro in die Hand nehmen – etwa für die Bewachung beziehungsweise Bewirtschaftung des Grundstücks, denn die Stadt nutzt die Fläche als Bodenlager. Das ist vermutlich der teuerste Lagerplatz Deutschlands. In wenigen Jahren wäre der Pachtvertrag mit dem Logistikunternehmen übrigens sowieso ausgelaufen. Die inzwischen gezahlten 124,2 Mio. Euro wurden somit, Stand heute, in der Elbe versenkt.
Petra Ackmann: „Es ist ein Skandal, dass eine wertvolle Fläche, für deren schnelle Verfügbarkeit die Stadt Hamburg mindestens 118 Mio. Euro gezahlt hat, seit Jahren brachliegt. Der Pachtvertrag wäre mittlerweile ausgelaufen. Das Geld ist also im wahren Wortsinn im Hafenbecken versenkt worden. So planlos und übereilt kann nur jemand handeln, der dafür selbst nicht die Kosten tragen muss.“
Nur online unter www.schwarzbuch.de:
Haltestellen-Posse kostet mindestens 85.000 Euro:
Bushaltestelle in Eimsbüttel muss nach Klage zurückgebaut werden
Augen zu und durch – ohne Rücksicht auf die Anwohner: So könnte man das Gebaren des Landesbetriebs Straßen, Brücken und Gewässer (LSBG) beschreiben. Die Folgen sind – außer gefällten Bäumen und langwieriger Gerichtsprozesse – zusätzliche Kosten von mehr als 85.000 Euro, für die der Steuerzahler aufkommen muss.
Und darum geht es: Fast vier Jahre stritten sich die Bewohner eines Hauses in Hamburg-Eimsbüttel mit der Stadt um die Verlegung einer Bushaltestelle. Die Stadt wollte die Haltestelle direkt neben ein Haus in der Unnastraße setzen. Dazu wurden bereits Bäume gefällt und eine Haltebucht eingerichtet. Aber da spielten die Anwohner nicht mit. Ihre Klage hatte Erfolg, die neueingerichtete Bushaltestelle muss „umziehen“.
Bereits 2016 beschloss die Stadt, die Haltestelle an der Goebenstraße in Richtung Altona an die Unnastraße zu verlegen. Im Zuge des „Busbeschleunigungsprogramms“ sollte sie hinter eine Ampel gebaut werden – genau vor ein Mehrfamilienhaus. 50 Sekunden schneller sollten die Busse dadurch ihre Strecke bewältigen können. Doch das Verwaltungsgericht verhängte einen einstweiligen Baustopp und verlangte ein Lärmgutachten. Ein derartiges Gutachten über die zusätzliche Geräuschkulisse hatte die Behörde aber nicht erstellt. Dabei kam heraus, dass der Straßenlärm bereits ohne die Busse gesundheitsschädlich ist. Die Stadt hätte die Haltestelle nicht vor das Haus verlegen dürfen.
Der LSBG zeigte sich weiterhin überrascht: „Die Planungen sind seinerzeit einvernehmlich zwischen den beteiligten Trägern öffentlicher Belange abgestimmt worden. Eine juristische Auseinandersetzung mit Anliegern war nicht zu erwarten.“ Anders formuliert: Der LSBG hatte schlicht versäumt, die Anwohner zu fragen, was sie davon hielten, wenn künftig direkt vor ihren Fenstern ständig Busse stoppen und wieder anfahren würden. Dennoch legte man Einspruch ein und zog vor das Hamburger Oberverwaltungsgericht. Doch auch dort wurde der Baustopp 2017 bestätigt.
Den Steuerzahler kostet das Hin und Her mehr als 250.000 Euro. Allein für die „beklagte“ Haltestelle wurden 80.000 Euro fällig. Die Gerichtskosten schlugen angeblich mit nur 5.000 Euro zu Buche. Die Haltestelle wurde nun an den Eingang des Eimsbütteler Parks verlegt. Auch hier gab es Medienberichten zufolge Kritik. Diesmal von den Fahrgästen, weil sich die neue Haltestelle nicht in einer Bucht, sondern auf der Fahrbahn befindet.
Petra Ackmann: „Viel Steuergeld wäre eingespart worden, wenn die zuständige Behörde ihre Hausaufgaben gemacht und die Anwohner einbezogen hätte.“
Das Schwarzbuch
Wer Steuern zahlt will Sparsamkeit – keine Verschwendung. Dieser Gedanke war der Ausgangspunkt der wohl bekanntesten „Marke“ des Bundes der Steuerzahler (BdSt). Das Schwarzbuch der öffentlichen Verschwendung ist mittlerweile weithin bekannt und Synonym für die Recherche- und Aufklärungsarbeit des BdSt. Mit dem Schwarzbuch ist es gelungen, das Problem der Steuergeldverschwendung als Thema in Politik und Verwaltung fest zu verankern. Damit ist das Schwarzbuch und die öffentliche Aufmerksamkeit, die es erzeugt, das beste präventive Mittel gegen die Verschwendung von Steuergeld.
Entstanden ist es 1973. Damals wurden erstmals die Beispiele für den sorglosen Umgang mit Steuergeld vom BdSt in einer Broschüre gebündelt und veröffentlicht. Der mediale Widerhall war schon damals groß.
Ziel ist es nach wie vor, die Öffentlichkeit zu sensibilisieren und die Politik zum sparsamen und wirtschaftlichen Umgang mit unserem Steuergeld zu bewegen. Um die Verschwendung von Steuergeld zu verhindern, gibt es das Schwarzbuch mittlerweile auch digital auf der preisgekrönten Recherche-Plattform www.schwarzbuch.de.
Das Schwarzbuch-Team recherchiert jedes Jahr mehr als 100 Beispiele eklatanter Steuergeldverschwendung. In seinen Analysen geht das Schwarzbuch den Ursachen für die Verschwendung von Steuergeld auf den Grund und liefert zugleich konkrete Handlungsempfehlungen, wie es besser laufen kann. Damit leistet der BdSt einen konstruktiven Beitrag für die sparsame Verwendung von Steuergeld.
Das Schwarzbuch kann kostenlos unter www.schwarzbuch.de bestellt werden.
Der Bund der Steuerzahler
Der Bund der Steuerzahler (BdSt) ist seit mehr als 70 Jahren die Interessenvertretung für alle Steuerzahler:innen. Er ist unabhängig, parteipolitisch neutral und gemeinnützig. Sein Ziel ist es, die Steuern und Abgaben zu senken, Verschwendung zu stoppen, die Staatsverschuldung zurückzufahren und Bürokratie abzubauen. Seine Arbeit finanziert er ausschließlich aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden.
Mit rund einer Viertelmillion Mitgliedern zählt der BdSt zu den größten Organisationen in der Welt. Keine andere Organisation nimmt die Ausgaben des Staates in den Blick und achtet für die Bürger auf eine effiziente Verwendung des Steuergelds und eine solide Staatsfinanzierung. Gleichzeitig sieht sich der BdSt die Einnahmen des Staates an. Er setzt sich für ein faires Maß an Belastung mit Steuern und Abgaben ein und prüft, ob Änderungen im Steuerrecht für die Steuerzahler gerecht sind und greift politisch und rechtlich ein, wenn dies nicht der Fall sein sollte.
Getragen und finanziert über Mitgliedsbeiträge und Spenden ist der BdSt die einzige Bürgerbewegung, die überparteilich die Interessen der Bürger und Steuerzahler vertritt. Mehr Informationen unter www.steuerzahler.de
Von Harburg bis Langenhorn, von Bergedorf bis Rissen, von Hausbruch bis Rahlstedt: Der Bund der Steuerzahler Hamburg e.V. setzt sich für die Rechte der Steuerzahler ein. Der Verein ist unabhängig, gemeinnützig und parteipolitisch neutral. Dem Verein gehören etwa 3.500 Mitglieder an.
Um Verschwendung von Steuergeld aufzudecken, anzuprangern und zu verhindern brauchen wir Unterstützer. Das sind unsere Mitglieder. Der Standard-Mitgliedsbeitrag pro Jahr beträgt 78 Euro. Juristische Personen, Personengesellschaften, Selbstständige und Freiberufler sind mit 96 Euro dabei. Existenzgründer zahlen 48 Euro. Der ermäßigte Beitrag beläuft sich ebenfalls auf 48 Euro für Senioren (ab 65 Jahren). Junioren (bis 27 Jahre) zahlen nur 12 Euro.
Unsere Mitglieder sorgen nicht nur dafür, dass wir zahlreiche Beispiele von Steuerverschwendung in Hamburg öffentlich machen können. Sie sind es auch, die es uns erlauben, vielen Steuer-Ratsuchenden mit gut recherchierten Informationen zur Seite zu stehen. Und Sie sind es, die unserer Stimme in der Hamburger Politik Gewicht geben.
Mehr Informationen unter www.steuerzahler.de/hamburg
Bund der Steuerzahler Hamburg e.V.
Ferdinandstraße 36
20095 Hamburg
Telefon: +49 (40) 330663
Telefax: +49 (40) 322680
http://steuerzahler-hamburg.de
Geschäftsführer / Pressesprecher
Telefon: +49 (40) 3306-64
Fax: +49 (40) 3226-80
E-Mail: mummenhoff@steuerzahler-hamburg.de
![]()