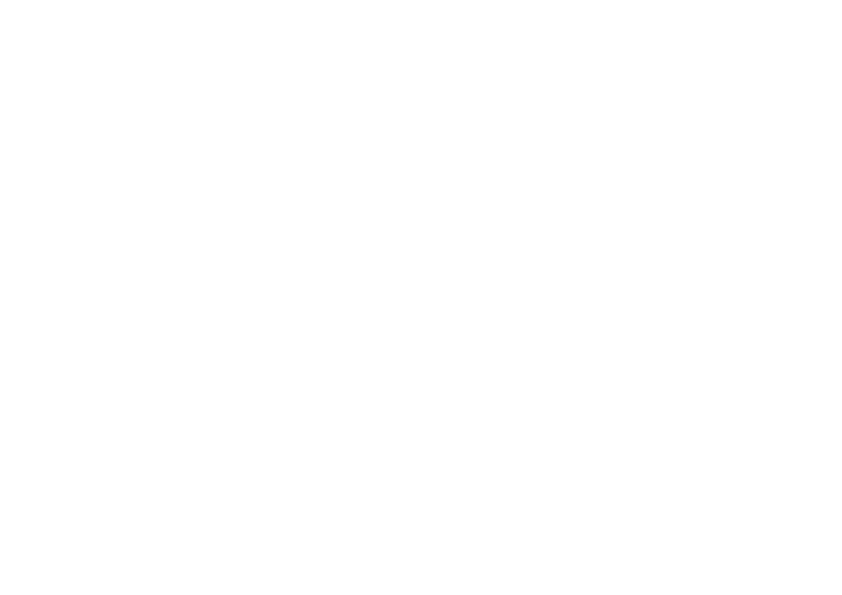Ein strahlender Ritter demontiert sich gewissermaßen selbst in „Kirschenkosten“ von Hildegard und Siegfried Schumacher.
Wie ist es, als fünfzehnjähriges Mädchen ein Kind zu bekommen? Darum geht es in „Liane und ihr Baby“ von Elisabeth Schulz-Semrau.
Vera und Stuck versuchen sich in „Lindenstraße 28“ von Siegfried Maaß im Widerstreit mit der Gesellschaft der Erwachsenen zu behaupten und ihren Platz im Leben zu finden. Lebensgeschichten junger Leute aus den achtziger Jahren in der ostdeutschen Provinz.
Und damit sind wir wieder beim aktuellen Beitrag der Rubrik Fridays for Future angelangt. Jede Woche wird an dieser Stelle jeweils ein Buch vorgestellt, das im weitesten Sinne mit den Themen Klima, Umwelt und Frieden zu tun hat – also mit den ganz großen Themen der Erde und dieser Zeit. Die wirkliche Qualität einer Gesellschaft zeigt sich nicht zuletzt darin, wie sie mit ihren Schwächeren und Schwächsten, insbesondere mit Menschen mit Behinderungen, umgeht. Das galt früher und das gilt auch heute. Dazu präsentiert der heutige Newsletter eines der ersten und wichtigsten Bücher zu diesem Thema aus DDR-Zeiten, das damals eine geradezu überwältigende Resonanz gefunden hatte.
Erstmals 1983 veröffentlichte Klaus Möckel im Verlag Neues Leben „Hoffnung für Dan“: Das ist die bewegende Geschichte eines geistig behinderten Jungen, der weder hören noch sprechen kann und dem wegen seiner Schädigung auch die Gebärdensprache versagt bleibt. Innerlich isoliert, rebelliert er gegen alles, was ihm unverständlich erscheint. Die Eltern, die seine und ihre Situation erst allmählich begreifen, versuchen mit Geduld und Liebe, diese Schallmauer zu durchbrechen. Aus der Sicht der Mutter werden die oft verzweifelten Versuche geschildert, mit Bildern und Gesten eine Verständigung zu erreichen, dem ungebärdigen, hilflosen Kind und damit sich selbst eine Perspektive zu geben. Das Verhalten einer mitunter wenig verständnisvollen Umwelt verschärft die Lage noch.
„Hoffnung für Dan“ war eines der ersten Bücher, die sich in der DDR mit der Problematik solcher Menschen und ihrer Familien auseinandersetzten. Es wurde als ein Aufschrei empfunden, fand große Beachtung und führte über den Kreis der Betroffenen hinaus zu heftigen Diskussionen. Bis 1989 in fünf Auflagen erschienen, wurde es nach der Wende nochmals von einem bekannten Münchner Verlag als Taschenbuch publiziert, ist inzwischen aber längst vergriffen. Von seiner aufrüttelnden Wirkung, seiner Wahrhaftigkeit und Dramatik hat es bis heute nichts eingebüßt. Hier der bewegende Beginn dieses eindrucksvollen literarischen Berichts, der schon ahnen lässt, wie schwierig das Leben mit Dan ist:
„1. Kapitel
Zehn Minuten mit der Straßenbahn, dann umsteigen und nochmals fünf Minuten fahren – ein kurzer Weg, trotz der Wartezeit am Anfang und zwischendurch. Kein Vergleich zu früher, als wir nach Steinberg mussten durch die halbe Stadt, ein gutes Drittel des Tages war schon wegen dieser zweimaligen Kutscherei weg. Der lange Weg von der Straßenbahnendhaltestelle zur Einrichtung ging in die Beine, und wenn der Junge sich abends sperrte, wusste man nicht, wie nach Hause kommen.
Jetzt, na ja, irgendwie schafft man es schon. Irgendwie schaffte man es ja auch damals, selbst wenn er sich in den Schmutz kniete, in die Pfützen, so dass Hosen und Unterhosen pitschnass wurden, vor Dreck klebten, selbst wenn einen die Taxifahrer stehenließen, weil ihnen dieses Kind zu schwierig schien, wenn die Leute verständnislos, bedauernd oder indigniert zu einem herüberstarrten, wenn Dan sich mit all seiner Kraft dagegen stemmte, in die Bahn einzusteigen, wenn er brüllte und sich die halbe Fahrt über wie ein kleines Tier unter dem Sitz verkroch.
Ich erinnere mich an einen Abend, da er sich losgerissen hatte, und mitten auf die Straße lief. Sieben Jahre muss er immerhin gewesen sein oder acht. Ich konnte nichts dagegen tun; es geschah so überraschend, dass ich nicht zum Eingreifen kam. Er lief ohne erkennbaren Grund auf die Fahrbahn und legte sich lang auf den Bauch.
Eine Riesenaufregung: Ein LKW rutscht mit quietschenden Bremsen auf ihn zu, der Gegenverkehr stoppt, nachfolgende Wagen hupen, eine Straßenbahn, zum Glück noch ein Stück entfernt, bimmelt wie verrückt, die Passanten bleiben stehen und schimpfen, eine alte Frau neben mir jammert wie aufgezogen „Ogottogottogottogott“. Der Fahrer des Lastwagens klettert gestikulierend und fluchend aus seiner Kabine; nein, es ist nichts passiert, Dan ist nicht zu Schaden gekommen, niemand hat sich bei dem jähen Bremsvorgang verletzt, nicht mal einen Auffahrunfall hat es gegeben. Nur mir stockt der Herzschlag, schmerzt mit einem Mal die linke Brustseite, und ich bringe kein Wort heraus. Weiß nicht, wie ich auf die Fahrbahn komme, jedenfalls muss ich ziemlich blass aussehen, denn der LKW-Fahrer, der drauf und dran ist, den Bengel zu vermöbeln (würde er’s doch tun!), wird plötzlich ganz still. Er fasst mich am Arm und sagt: „Nun, nun, nun, junge Frau, beruhigen Sie sich, ist ja noch mal gut gegangen.“ Gut gegangen, na schön, auf seine Weise hat er recht, bloß mir ist hundsmiserabel. Ein Gefühl inneren Elends, das sich nicht in Worte fassen lässt. Die Leute drängen sich um uns, gaffen. „Was ist los, warum geht’s hier nicht weiter?“ Andere lassen ihrer Entrüstung freien Lauf, sparen auch nicht mit guten Ratschlägen: „Hat man so was schon erlebt; kann die nicht besser aufpassen; eine Tracht hat er verdient, dass er nicht mehr weiß, was hinten und vorn ist.“ Er aber, der Sünder, einen Blick wie ein König, liegt auf der Straße, ohne sich um den Trubel zu scheren. Nein, er ist nicht gewillt, klein beizugeben, das Feld zu räumen. Als dann die Dämme in mir endlich brechen und ich ihn voller Wut und Verzweiflung anbrülle, schüttle, zieht er bloß den Kopf ein. Völlig verspannt und verstockt, da helfen weder Schläge noch Zureden. Wir kennen das schon, es gäbe in dieser Situation nur ein Mittel: ihn eine halbe Stunde irgendwo einzusperren und zu sich kommen zu lassen. Aber wir sind ja unterwegs, mitten in der Stadt, und er liegt gut auf dem Asphalt. Ein warmer Tag, die Sonne scheint, ich erinnere mich genau. Ich versuche ihn am Arm zu packen, hochzuziehen – man glaubt nicht, was ein siebenjähriger Junge für eine Kraft entwickeln kann. Er macht sich steif wie ein Brett und knurrt vor Empörung. Schließlich packt ihn der LKW-Fahrer und schleppt ihn zurück auf den Fußsteig. Wo er gekränkt noch zwanzig Minuten hocken bleibt. Ich komme mehr tot als lebendig nach Hause, heule den ganzen Abend.
Oder an jenem Tag im Winter – das muss ein Jahr früher gewesen sein -, als er gleichfalls unvermutet die Straßenseite wechselt. Keine Ahnung, was ihm in den Sinn gekommen ist, vielleicht hat er drüben etwas Interessantes entdeckt, er geht ein paar Meter vor mir, unmöglich, so ein Kind immer an der Hand zu führen, er macht das nicht mit. Er läuft los, zielgerichtet, ohne nach links und rechts zu schauen, und natürlich ohne sich nach mir umzudrehen, mitten in den Verkehr hinein. Ich seh seine braune Pelzmütze zwischen den Fahrzeugen dahinwandern, die wild zu hupen beginnen, und renne wie gehetzt hinterher. Ich kriege ihn in der Straßenmitte zu fassen, bin völlig außer Atem, aber er ist gut gelaunt und geht brav mit zurück. Er versteht nicht, warum ich ihn rüttle und ausschimpfe. Erst jetzt wird er bockig, hält sich an den Laternenpfählen fest, als ich weiter will. Der Heimweg wird zur Qual, nicht zuletzt wegen der vorwurfsvollen Blicke der Leute, die alle Schuld mir geben. Dan ist nicht bereit einzulenken, er nimmt es übel, wenn man ihn tadelt, selbst wenn er weiß, dass er den Bogen überspannt hat. Gerade dann. Er begreift die Gefahren nicht, denen er sich aussetzt. Da er nicht hören kann und die Verständigungsmöglichkeiten mit ihm gering sind, ist es so gut wie ausgeschlossen, ihm Zusammenhänge zu erklären. Fest steht, dass man sich mit solch einem Kind einen besonderen Lebensrhythmus zulegt, eine Art zu existieren, an die man vorher nicht im Traum gedacht hat. Ich gehe auf der Straße, ich sehe normale Kinder und denke: Warum gerade er, warum gerade du, oder genauer, ich denke es schon nicht mehr, ich zwinge mich, es nicht zu denken, ich weiß, dass es sinnlos ist. Ich bleibe stehen, schau eine beliebige Hauswand an, zähle die Autos, die vorbeisausen, lenke mich ab. Gestern, auf dem Weg zur Tagesstätte, ertappe ich mich, wie ich die Fenster der gegenüberliegenden Häuserfront auf ihre Größe, ihr Aussehen hin vergleiche. Vier solche, zwei solche, eins doppelt unterteilt, eins sechsfach. Das heißt, ich ertappe mich nicht, ich tu das bewusst, um mein inneres Gleichgewicht wiederzufinden. Plötzlich ein kleines Mädchen: „Was is’n da, Tante, an dem Haus?“ – „Was da ist? Nichts. Der Vogel dort drüben auf dem Dach, siehst du?“ – „Da ist aber gar kein Vogel, ich seh keinen.“ – „Doch, da war einer, ist grade weggeflogen.“ Die Kleine schaut mich an, fünf Jahre mag sie alt sein, rot und weiß gestreiftes kurzes Röckchen, gelbe Bluse, Stupsnase und große braune Augen. Dann trollt sie sich. Zehn Meter weiter schreit sie: „Du spinnst ja, Tante“ und rennt eilig davon.“ Und damit zu ausführlicheren Vorstellungen der anderen vier Sonderangebote dieses Newsletters.
Ganz neu ist soeben als Eigenproduktion von EDITION digital „Windstärke 13“ von Harald Wieczorek auf den Markt gekommen – und zwar sowohl als gedruckte Ausgabe und als E-Book wie auch als Hörbuch (Sprecher: Herbert Schäfer): Der Junge aus einem kleinen fränkischen Dorf wollte schon immer die große weite Welt kennenlernen und entschloss sich – natürlich gegen den Willen seiner Eltern – Seemann zu werden. Dieses Buch beschreibt seinen Weg von der Pike auf, das heißt von der Seemannsschule vom Moses bis zum Bootsmann. Ein Abenteuer, das man schwer vermitteln kann, man muss es selbst erlebt haben. „Windstärke 13“ versucht, Menschen aller Altersgruppen ein Leben auf See, wie es in den Fünfzigerjahren des vorigen Jahrhunderts war, nahe zu bringen. Denn wie es damals war, wird es keiner mehr erleben, da diese Zeit unwiederbringlich vorbei ist. Der wahre Seemannsberuf ist ausgestorben, was bleibt sind Bücher wie dieses. Wie aber begann damals so ein Berufsleben als Seemann?
„MIT 15 ZUR SEEMANNSSCHULE
Mein Gott! Wie hab ich gestaunt, als ich kleiner Provinzler ehrfürchtig durch den Hamburger Hauptbahnhof schlich. Gut, dass es nicht Winter war. Bei meinem geöffneten Mund wäre mir sicher die Zunge erfroren. Mutig kaufte ich mir einen Becher Kaffee und stellte mich an einen Stehtisch.
Es dauerte nicht lange und schon hatte ich Gesellschaft von einem älteren, seriös wirkenden Herrn. Er gab mir gleich die Hand, hielt sie lange fest und kratzte ständig mit seinem Finger in meiner Handinnenfläche.
Bevor er sich zum Handrücken durchkratzte, konnte ich ihm meine Hand entziehen. Ich hielt das damals für eine mir unbekannte, norddeutsche, besonders freundliche Handbegrüßung. Welch ein Trugschluss! Als ich später zu einem Matrosen genauso freundlich sein wollte, hatte ich mein erstes seemännisches blaues Auge. Innenhandkratzen war damals ein internes Zeichen der Homosexuellen.
Und so begann es:
DIE SEEMANNSSCHULE – BREMERVÖRDE
Die Moses-/Decksjungenfabrik, wie sie intern genannt wurde, war die einzige Seemannsschule in Deutschland. Wer die Seefahrt zum Beruf machen wollte, drei Jahre Lehrzeit, Decksjunge, Jungmann, Leichtmatrose, Matrose, Bootsmann bis zum Kapitän, musste drei Monate durch Bremervörde. Drei Monate fachliche Grundausbildung, wie beim Militär, nur ohne Waffen.
Junge „Männer“ zwischen fünfzehn und neunzehn aus allen Teilen Deutschlands, voller Hoffnung, Sehnsucht und Träume, und ich war dabei!
Die Seemannsschule war das Schiff und wir die Besatzung. Das Einchecken, ganz klar vorgegeben, von 16 bis 18 Uhr. Danach waren die Schotten dicht, das Schiff ausgelaufen. Wer später kam, konnte wieder nach Hause fahren.
Das Erste, was der junge Seemann lernen und kapieren musste, war Disziplin. Dazu waren Voraussetzung: Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Lernfähigkeit, Kameradschaft und Ehrlichkeit. Einiges konnte man lernen, anderes musste man besitzen, wie z.B. Ehrlichkeit. Kameradendiebstahl kam gleich nach Mord und wurde nie verziehen. Wer geklaut hat, hatte verschissen bis in die Steinzeit und zurück.
Gelegenheit macht Diebe. Das dachten sich auch Neumann und Peters, beide Offiziere. Deshalb musste alles Geld abgegeben werden. Selbst die Post wurde geöffnet und mitgeschicktes Geld dem Einzelnen gutgeschrieben. Es gab nur 5 Mark Taschengeld in der Woche, den berühmten Heiermann. Für die Raucher war das ein Problem, alle stiegen auf Drehen um. Not macht erfinderisch. Die Jungs hatten immer eine Sicherheitsnadel dabei. Wenn man die Kippe nicht mehr mit den Fingern halten konnte, steckte man die Nadel rein. Selbst der kleine verbleibende Rest wurde wieder ins Päckchen gekrümelt. Auf dem gesamten Schulgelände fand man nicht eine einzige Zigarettenkippe.
Jedenfalls war der Empfang in der Seemannsschule „sehr herzlich“. Es wurde kein Wort gesprochen. Wer ankam, wurde stumm auf den großen Antreteplatz, vor einem 30 Meter hohen, originalen Rah-Mast mit Wanden und Ausguck, verwiesen. Ich gehörte zu den Pünktlichen und stand mit den anderen Pünktlichen mit Koffer und Tasche in der Junihitze und wartete auf den letzten „Arsch“, der tatsächlich erst fünf Minuten vor „Auslaufen“ ankam. Er hieß Dietrich oder so ähnlich und lief ein, wie Hans Albers grinsend, „hoppla, jetzt komm ich“. Dieses Grinsen ist ihm bald vergangen, denn die „Bosse“ und wir Jungs waren ziemlich angefressen.
Die „Bosse“, nämlich der Bootsmann, der Dritte, der Zweite und der Erste Offizier und der Alte (Kapitän). Alles erfahrene Seeleute. Wir wurden in Wachen aufgeteilt. Backbord – mittschiffs – Steuerbordwache. Für jede Wache war ein Offizier verantwortlich. Darüber wachte, wenn auch nur selten zu sehen, der Kapitän. Aber der wahre Chef war „Old Papendieck“, der Bootsmann. Schon rein äußerlich eine Respektsperson. 1,90 Meter groß, 100 Kilogramm schwer, ein Oberkörper ohne Hals. Ein Mann wie eine Walze, mit Händen wie Kohlenschaufeln. Er sprach nie viel, aber was er sagte, war Gesetz und hatte Hand und Fuß. Niemand wusste, wie alt er war. Aber es war bekannt, dass er schon als Junge mit den „Dreimastern“ um Kap Hoorn gesegelt ist.
Wir alle, ausnahmslos, auch die Offiziere, hatten höllischen Respekt vor ihm, aber keine Angst. Denn er war trotz seines respektvollen Aussehens eine Seele von Mensch. Ein echter Seemann. Treu und gut. Doch wenn einer bei ihm verschissen hatte, dann endgültig.
Old Papendieck hatte ein großes Herz für die kleinen Kameraden. Einen Jungen, sechzehn, hatte er besonders gern, 1,65 Meter klein und 60 Kilogramm leicht. Beim Antreten gab es immer ein gleichbleibendes Zeremoniell.
„Fiede, wie groß bist du?“, dröhnte Old Papendieck. „Zwei Meter!“, piepste Fiede. „Wie viel wiegst du?“ „100 Kilo!“ „In Ordnung!“ Old Papendieck war zufrieden.“
Erstmals 1978 veröffentlichten Hildegard und Siegfried Schumacher im Verlag Neues Leben Berlin „Kirschenkosten“. Unter dem veränderten Titel „Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer“ erschien das Buch erstmals 1985 in der Franckh’schen Verlagsbuchhandlung Stuttgart: Christine Hollmann steht ihrem dickschädeligen Großvater gewiss in nichts nach, wenn ihre Kriegslisten naturgemäß auch verschiedenen Objekten gelten. Weil ihre Eltern ihr nicht erlauben wollen, mit ihren fünf Freunden zum Zelten zu fahren, fährt sie schließlich ohne diese Erlaubnis fort. Nach ihrer Rückkehr ist sie jedoch nicht etwa länger über ihre Großfamilie, dafür aber zutiefst über ihren Klassenkameraden Matthias enttäuscht, der sich weit mehr für Mathe als für Mädchen begeistern kann. Als die Schule wieder beginnt, nimmt er ihr gegenüber immer häufiger einen belehrenden Tonfall an, der sie verletzt. Stück für Stück demontiert er selbst das Bild vom Strahlenden Ritter, das sie sich von ihm gemacht hatte.
Während Christine sich bisher in ihrem Kaff am Rande der Welt gefühlt hat, häufen sich in diesem denkwürdigen Jahr die unangenehmen Ereignisse, von denen der Kummer mit Matthias nur der Anfang war. Um sich über ihre Gefühle klar zu werden, beginnt sie, ein Buch zu schreiben. Aber muss Matthias, dieser fantasielose Knochen, sie ausgerechnet bei Mathe-Bolle damit verpfeifen? Wie ein Lauffeuer breitet sich die Kunde aus: Christine schreibt. Und da sie verstockt von ihrem Hobby nicht lassen will, setzt sie sich bei fast allen Lehrern voll in die Nesseln.
Trost findet sie nur nachmittags bei ihrem Plüschlöwen, den ihr Wolfgang geschenkt hat. Er selbst weilt fern, doch bald beginnen die Telegrafenleitungen zwischen Berlin und Hollershoh immer heftiger zu rauschen! Hier der Anfang dieser aufregenden Geschichte, in der auch Marlon Brando und seine zumindest moralische Unterstützung für ein gewagtes Unternehmen eine nicht unwichtige Rolle spielen:
„1. Kapitel
Er hing in meinem Zimmer. Endlich! Ganz groß hing er an der Wand.
Seit ich ihn das erste Mal im Kino gesehen hatte, den kühnen Helden der „Bounty“, träumte ich von Marlon Brando. Der verwegene Blick, seine lässige Art hatten es mir angetan, vor allem aber die Entschlossenheit, mit der er sich durchsetzte. Christine Hollmann, sagte ich mir, nimm dir ein Beispiel an ihm, beim Mittagessen sagst du es!
Für das geplante Unternehmen brauchte ich die Erlaubnis meiner Eltern. So ist das, wenn man noch acht Monate auf die sechzehn zusteuert. Bis um zwei musste alles klar sein, da wollte ich mich mit Bärbel, Susanne, Ecki und Gerd und natürlich Matthias an der Blänke treffen, um die letzten Vorbereitungen zu besprechen. Alles hing davon ab, dass jeder von uns mitfahren durfte. Unsere Eltern wussten, dass wir uns seit Ewigkeiten kannten und nie etwas passiert war. Über Jahre hatten wir rundum alle Geburtstage gemeinsam gefeiert, Verstecken und Blindekuh gespielt und im Wald Buden gebaut, und bei den Schlittenfahrten mit Großvaters Braunen, damals, als wir noch kleine Stippis waren, hatte unsere Freundschaft begonnen. Nun lag die neunte Klasse genauso in Ehren hinter uns wie die Arbeit bei der LPG (LPG = Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft) Pflanzenproduktion. Wer gemeinsam lernt, der kann auch gemeinsam arbeiten, so lautete unser historischer Beschluss. Wir hatten uns für drei Wochen als Brigade angemeldet, um unsere persönlichen Finanzen aufzubessern.
Eine kluge Maßnahme, wie sich erwies. Als ordentliche Brigade erhielten wir ordentliche Arbeit. Wir strengten uns an, guckten auch nicht auf die Minute, und – ehrlich – es machte Spaß. Alle sechs sind wir motorisiert, schon der Schule wegen. Wir wurden als fliegende Brigade eingesetzt. Den Sprit spendierte die LPG. Kleine Zuwendungen festigen die Freundschaft. Unsere Arbeit gefiel dem Vorstand, und es war kein Wunder, dass die Prämie zum Schluss den Bereich Kleinigkeiten überschritt.
Vati als Chef ließ es sich nicht nehmen, uns die Auszeichnung höchst eigenhändig zu präsentieren. Angesichts des vollzählig versammelten Vorstands zeigte er uns stolz herum, und der Rat, die Prämie, die im Kollektiv erarbeitet worden war, auch kollektiv zu nutzen, stammte von ihm. Oma zu Hause sagte, dass ich mich nun schön erholen sollte. Nichts anderes wollten wir. Nach dem sozialistischen Lernen und Arbeiten sollte nun das sozialistisch Leben kommen.
Wir dachten nach. Dampferfahrt mit anschließendem Theater oder Friedrichstadtpalast waren alte Hüte. Den meisten Männern ist zum Verbraten einer Prämie eine Sause am liebsten. Möglichst ohne Frauen, die können am 8. März feiern. Wir hatten nicht die Absicht, vorgetretene Pfade auszulatschen. Ecki fiel genau das Richtige ein: Zelttour mit unsern Mopeds. Das musste ich durchsetzen. Natürlich war es ungünstig, zaghaft zu fragen. Wer viel fragt, kriegt viel Antwort. Ich musste bestimmt auftreten. Ich sah auf meine Uhr. Das Mittagessen stand erst um zwölf auf dem Tisch. Nur nicht vorher verrückt machen!
Ich rückte Marlons Bild gerade. Der Filmvorführer hatte die „Meuterei auf der ,Bounty“ mehrere Male im Kulturhaus von der Leinwand flimmern lassen. Man konnte fast annehmen, er liebte Filme von der Seefahrt. Vielleicht war er ein verhinderter Kapitän. Unsere Zelttour jedenfalls sollte nichts und niemand verhindern. Hatte ich mich durch die Angina im Frühjahr vom Besuch der Bounty abhalten lassen? Nein! Nie hatte ich Marlon Brando versäumt, und sobald er an Bord gestiegen war, hörte die übrige Welt zu existieren auf. Und doch, kaum hatte sich der Saal verdunkelt, bangte ich schon dem Wiederaufleuchten der Lampen entgegen, nicht nur weil mein Held sterben würde, sondern auch weil selbst der längste Doppelfilm zu Ende geht, und dann sah ich Marlon nicht mehr.
Aber nun hatte ich ihn frisch eingerahmt und für immer. Das Bild des Segelschiffs, das bisher den Platz über meinem Schreibtisch eingenommen hatte, war ein kümmerlicher Ersatz gewesen. Solch ein Schiff gab es an dem See, wo wir unsere Zelte aufschlagen wollten, nicht. Das gab es nirgends auf der Welt. Ich hatte es erfunden und vor der Marlonzeit gemalt, und früher war es Odysseus’ Schiff, mit dem ich über blaue Meere fuhr. Odysseus sah wie Marlon aus. Ich wusste es, seit ich Marlon kannte. Ich war bei ihm auf dem Schiff, spürte das Rollen der See unter den Planken, und gleichzeitig war ich Penelope, zu der er glücklich heimkehrte. Ein schreckliches Ende wie auf der „Bounty“ gab es nicht. An Penelope störte mich nur, dass sie fünfundzwanzig Jahre warten und folglich uralt sein musste. Also war ich die Königstochter Nausikaa, die ich sowieso viel lieber hatte. Ich stellte es mir sehr schön vor, wie ich den schiffbrüchigen Fremdling am Strand traf, und da war ich ganz sicher, ich hätte ihn festgehalten. Was man wirklich will, das schafft man!
Ja, das Segelschiff hatte ausgedient. Felix konnte es haben. Mein kleiner Bruder war schon lange scharf darauf. Überhaupt, Felix hatte es gut. Der durfte mit seinen zehn Jahren wer weiß was. Er kriegte es fertig, einen ganzen langen Nachmittag zu verschwinden, ohne dass einer etwas dabei fand. Von mir wollten Mutti und Oma stets bis ins letzte Detail wissen, wo ich hin wollte und wie lange. Bei Bärbel zu Hause war es nicht anders. Und erst bei Sanne! Das konnte einem ganz schön auf den Geist gehen. Am besten, ich versuchte es mittags mit Diplomatie.
Mit meinem Taschentuch polierte ich Marlons Vorderansicht. Ich verdankte ihn Bärbel, die es tatsächlich geschafft hatte, ihn mir zu besorgen. Wahre Freundschaft muss wohl so sein. Bärbel hatte ihr diplomatisches Talent bei einem Vetter spielen lassen, der besaß eine Frau und die wiederum eine Tante, deren Tochter mit einem ging, dessen Großmutter als Platzanweiserin in einem Berliner Kino arbeitete. Über diesen verschlungenen Weg war Marlon bis zu mir gekommen.“
Erstmals 1988 veröffentlichte Elisabeth Schulz-Semrau im Kinderbuchverlag Berlin „Liane und ihr Baby“: Liane stolperte benommen über ausgestreckte Beine im Wartezimmer, murmelte eine Entschuldigung, öffnete eine Tür, es war die falsche, sie führte in einen zweiten Untersuchungsraum. Liane erkannte es an dem besonderen Stuhl, von solch einem war sie gerade heruntergeklettert. Rasch warf sie die Tür zu, fand die richtige nach draußen, wurde aber von der Sprechstundenhilfe zurückgerufen: Sie haben die Überweisung vergessen! Als Liane sie verständnislos ansah, drückte sie dem Mädchen ein Blatt Papier in die Hand, fügte hinzu: Damit melden Sie sich bei der Schwangerenberatung Ihres Stadtbezirks! Psychologisch einfühlsam schildert die Autorin die Nöte und Ängste des fünfzehnjährigen Mädchens Liane – soll sie das Kind austragen oder nicht? Und dann ist es soweit:
„Erstes Kapitel
Es ist soweit, Liane, sagte die Stationsschwester. Nach der Visite können Sie dann gehen.
Das Mädchen im Bett, in einem Zimmer hoch über der Stadt, dieser großen und geteilten, rollte sich – oder soll man sagen krümmte sich – klein. So, als trachte es danach, in das winzige Bett neben sich, diesen Ableger eines Bettes, zu kriechen, um sich an das darin liegende, immer noch unbegreifbare Wesen zu kuscheln, sich an ihm festzuhalten, an ihm warm zu werden, sich womöglich ganz darein zu verwandeln, und sich vorzustellen als: Ich bin Sue Peterson, sechs Tage alt. Meine Mutter, Liane Peterson, muss mich wohl lieben, denn sie hat mich haben wollen. Gegen Widerstände dieser Welt, die ich noch nicht auszumachen weiß, hat sie mich haben wollen!
Und nun wird sie mich hüten müssen…
Und das große Mädchen in dem großen Bett dachte: Sechzehn Jahre. Ist das lang, oder ist es eine kurze Zeit?
Vor sechzehn Jahren habe ich so neben meiner Mutti gelegen. War sie da froh? Hatte sie mich da gern? War ich ihr so wichtig, wie Sue es für mich ist? Damals wenigstens?
Aber ich will, dass Sue mir auch in sechzehn Jahren noch ganz wichtig ist!
Zweiunddreißig bin ich dann! Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, so alt zu sein. Mutti ist sogar schon sechsunddreißig.
Vielleicht macht einen Altsein so?
Aber das kann ja auch nicht stimmen, Oma ist zwanzig Jahre älter und ganz anders.
Das Maunzen neben sich lässt das Mädchen zurückrollen. Erschrocken richtet es sich auf, beugt sich über das Kinderbett.
Aber es scheint nichts Beunruhigendes. Der winzige Mensch dort verzieht sein kleines Gesicht zu einer Fratze, so, als würde er schon gegen irgendetwas protestieren.
Liane sieht mit Neugier und Erstaunen auf den breitgepressten Mund, der die gesamte Kinnpartie böse wirken lässt. Dazu auf der Stirn ein großes V. Das Kind scheint zu träumen. Urplötzlich lächelt es und sieht aus wie Timm.
So was, denkt die junge Mutter, worüber kann es denn so lachen? Es kennt doch nichts bisher. Und sauer sein? Worüber? Ist das komisch. Vielleicht ist ihm nicht gut? Liane blickt angestrengt auf das Kind. Das schläft ruhig weiter, die Fäuste ans Kinn gepresst.
Haben Sie das auch schon bemerkt, wendet sich Liane an die Frau im Bett gegenüber, dass Ihr Kleiner Gesichter schneidet?
Die Frau ist zwölf Jahre älter als Liane und hat bereits eine vierjährige Tochter. Eine richtige Frau also, hatte Liane für sich festgestellt.
Die Frau liegt seit drei Tagen hier und hat einen Jungen geboren. Liane hatte sich immer überwinden müssen, sie anzusprechen. Sie glaubte zu fühlen, die Frau habe etwas gegen sie oder ihr Jungsein.
Gerade sechzehn? hatte sie erschrocken zu Liane rübergefragt.
Eine andere Patientin, die bis gestern im Nebenbett gelegen hatte, auch mit einer Tochter, war achtzehn, und mit der hatte sie etwas erzählen können. Aber meistens hatte die andere geredet. Sie war erfüllt von ihrer Hochzeit, die demnächst stattfinden würde. Dass sie nun doch das lange, glockig geschnittene Kleid und einen Schleier tragen könnte. Was es zu essen geben würde. Wie viele Gäste kämen. Davor wäre noch ein richtiger Polterabend, da würden Kollegen von ihr und ihrem Mann kommen, und es würde hoch hergehen. Schließlich gäbe es sogar eine kleine Hochzeitsreise. Fünf Tage Budapest. Ihre Mutter nähme solange die Mandy…
Aber du musst sie doch stillen, hatte Liane sich erschrocken erkundigt.
Mädchen, hatte die andere amüsiert geantwortet, bis dahin habe ich doch längst abgestillt. Nee, ich will mir ja nicht meine Figur verderben!
Da hatte sich die Frau aus dem Nebenbett eingemischt. Sie hatte am ersten Tag ziemlich apathisch dagelegen, und das Baby war von den Schwestern versorgt worden. Der Arzt hatte ihr den Bauch aufschneiden müssen, um das Kind lebendig herauszuholen.
Wer hat Ihnen nur den Quatsch von der Figur erzählt? Selbst wenn es so wäre… Sie können Ihrem Kind nichts Besseres bieten als Muttermilch. Sie sehen ja, dass es bei mir schon jetzt nicht reicht. Ich werde täglich herkommen müssen, um mir Milch von Müttern zu holen, die zuviel davon haben.
Bettina, so hieß die künftige Hochzeiterin, hatte nur die Augen verdreht, und als die Frau mal draußen war, zu Liane hinübergeflüstert, als würde der kleine Junge in seinem Bettchen seiner Mutter davon berichten.
Na ja, die ist Lehrerin, da bekommt sie fürs schlaue Reden bezahlt. Ich weiß, was ich weiß. Ich lauf mal nicht mit ’ner Brust wie ’n Kuhbusen rum.
Als sie sich von Liane verabschiedete, sagte sie: Besuch mich doch mal, Kleene. Wird schon alles laufen, mach dir keinen Kopp. Dein Macker ist zwar ein Bübchen, aber den kriegste mit deiner Sue zusammen auch noch groß. Halt ihn nur fest am Schlips. Männer sind so was verdammt Unzuverlässiges!
Die erwachsene Frau im Bett gegenüber hatte mit dem Kopf geschüttelt, aber nichts gesagt.
Liane hatte gedacht, damit ist die Frau wohl auch nicht einverstanden. Am Schlips festhalten möchte ich nie jemanden, der nicht bleiben will. Und wie Männer sind, weiß ich nicht. Will ich auch nicht wissen.
Obwohl Papa – und Paul… Aber Timm ist ein Junge!
Er war wirklich zur Vaterstunde gekommen. Zweimal sogar. Liane war ganz verstört gewesen, als er ins Zimmer trat.
Meine Mutter meinte, es ist gut für dich, hatte er erklärt.
Zu ihrer Erleichterung waren der Mann von der erwachsenen Frau und der Bräutigam der Hochzeiterin auch erschienen, so waren die anderen beiden beschäftigt gewesen.
Timmi hatte den Palästinenserschal, den sie so mochte, zweimal um den Hals geschlungen und die Fransenenden lässig nach vorn und auf den Rücken geworfen. Bewusst lässig, als hätte er in der Pause mal kurz, gegen die Schulordnung verstoßend, die Kaufhalle nebenan aufgesucht, um ein paar Kaugummis zu besorgen.
Den Schal, grün, weiß, schwarz mit einem roten Dreieck an den Enden, hatten sie zusammen während einer Solidaritätskundgebung auf dem Alex gekauft, und sie war die erste gewesen, die ihn so schick um seinen Hals gebunden hatte. Darum also…
Und er hatte auch wirklich Kaugummis auf ihr Bett gelegt, gesagt: Ich dachte, damit es hier nicht so langweilig ist.
Langweilig – hätte sie sagen wollen -, ach, Timm, wenn du wüsstest, es ist so aufregend mit dieser Sue…
Sie hatte genickt, die Kaugummis in der Nachttischschublade verwahrt und wortlos auf seine Tochter gewiesen.
Er hatte eine ziemlich lange Weile vor dem kleinen Bett gestanden, aber nichts gesagt. Erst als sie fragte: Na, wie findest du sie? antwortete er: Ich glaub schon, dass sie ganz in Ordnung ist.
Willst du sie nicht mal hochnehmen, versuchte Liane sein Interesse zu wecken. Der Bräutigam und der Ehemann trugen ihre Kinder bereits, zwar ungeschickt, aber wie ein Weihnachtsgeschenk im Arm.
Lieber nicht, sagte Timm rasch, sie ist so klein, Sie kann mir wegrutschen. Und… riecht sie nicht ein bisschen komisch?
Liane glaubte, dass er etwas angeekelt auf das Baby guckte. Und da sagte sie, und sie hätte nie gedacht, dass sie so etwas vermochte: Deine Tochter hat dir aus Freude, dass du kamst, eins gekackt! Aber es tat ihr gleich wieder leid, als sie sein hilfloses Gesicht sah. Na, das ist doch natürlich bei so einem kleinen Kind, fügte sie hinzu.“
Erstmals 1980 erschien im Verlag Neues Leben Berlin „Lindenstraße 28“ von Siegfried Maaß: „Weil ich endlich leben will, wie es mir gefällt!“, sagt Vera. Sie hat ihr Elternhaus verlassen, um der Enge sowie der Aufsicht ihrer uneinsichtigen Eltern zu entkommen, die fürchten, mit ihrer aufmüpfigen Tochter unangenehm aufzufallen und dem eigenen Ansehen zu schaden. In einem abrissreifen Hinterhaus der Kleinstadt findet Vera Unterschlupf und trifft in einer Diskothek auf Stuck, der dort in seiner Freizeit Platten auflegt. Er sträubt sich gegen das Vorhaben seiner Eltern, ihn auf die Schauspielschule zu schicken. Er zieht zu Vera, die sich um das Kind ihrer Freundin kümmert, denn gern wäre sie Erzieherin geworden. Aber ihrer Zeugnisse wegen hatte man sie abgelehnt.
Im ständigen Widerstreit mit der Gesellschaft der Erwachsenen, die sie nach ihrer Lebensauffassung formen will, versuchen Vera und Stuck ihren Platz zu finden und sich zu behaupten. Trotz schmerzhafter Erfahrungen entscheiden sie selbstbewusst über ihren Lebensweg. „Ich bin wie eine Klette!“, sagt Vera zu Stuck. „Mich wirst du nie wieder los!“ Auch Stucks Einberufung zur Armee wird daran nichts ändern. Lebensgeschichten junger Leute aus den achtziger Jahren in der ostdeutschen Provinz. Aber schauen wir uns erstmals das Kleinstadt-Hinterhaus in der Lindenstraße 28 an, wie es der Autor beschreibt:
„Das Haus
Das Haus ist ein griesgrämiger dreistöckiger Kasten aus der sogenannten guten alten Zeit und steht in einer von großen Linden gesäumten Straße der Brückstedter Altstadt.
Stuck bekommt jedes Mal schlechte Laune, wenn er mit seinem Fahrrad in die Lindenstraße einbiegt und schließlich vor Nummer 28 anhält. Das Haus hat hohe schmale spitzbogige Fenster, die Stuck wie Schießscharten einer mittelalterlichen Burg vorkommen. Sobald die Linden ihre Blätterfülle entfalten, dringt kaum Tageslicht in die Wohnungen. Hoch und schmal ist auch die Haustür, und will Stuck mit seinem Fahrrad hindurch, muss er erst die verriegelte Hälfte öffnen und darf nicht vergessen, die unverriegelte zuvor mit einem Haken an der Wand zu befestigen, denn sie ist mit einem Mechanismus versehen, der jeden zur Eile drängt: „Sotu schließt selbst“.
Früher soll es verboten gewesen sein, sein Fahrrad durch den Flur zu führen, früher, als es noch einen Hauswirt gab, der an jedem Monatsersten das Mietgeld kassierte. Heute trägt man es auf die Bank oder die Sparkasse, wo man es auf ein Konto einzahlt, das der KWV gehört. Was die mit dem Geld macht, weiß Stuck nicht, er sieht nur, dass sie es nicht für das Haus verwendet, sonst hätten die Fenstersimse längst neue Bleche erhalten, und die Blatternarben in der Fassade wären wenigstens verputzt worden.
Wenn Sotu-schließt-selbst tätig geworden ist, befindet sich Stuck mit seinem Fahrrad bereits in dem schmalen Flur, den er am anderen Ende durch eine enge Tür wieder verlässt, denn er muss erst den Hof überqueren, um sein Ziel zu erreichen. Dort, im Schatten des Vorderhauses, klebt an der das Grundstück Nummer 28 abschließenden Backsteinmauer ein kleines einstöckiges Haus, das einmal als Lager für einen Lebensmittelladen errichtet worden war. Dieser hatte sich im Vorderhaus befunden und dient längst als Wohnraum, wie das ehemalige Lager auch. Gelingt es der Sonne manchmal doch, einige Strahlen durch das Blätterdach der Linden zu zwängen und das Innere des Vorderhauses vorübergehend zu erhellen und zu wärmen, so ist das kleine Hinterhaus in dieser Beziehung noch mehr vernachlässigt, weil es von allen Seiten eingeschlossen ist und Sonne noch seltener zu spüren bekommt. Es bietet jedoch seinen Bewohnern den nicht zu unterschätzenden Vorteil, unter sich sein zu können. In diesem Penthouse, wie es Stuck gleich zu Anfang getauft hat, wohnen Vera, Stucks Freundin, und Elke, die Veras Freundin ist. Auch sie haben bisher Geld auf das Konto der KWV gezahlt, aber Stuck hat damit Schluss gemacht. Eines Abends hatte er die Festbeleuchtung im Penthouse eingeschaltet, beide Fenster weit aufgerissen und laut den Bewohnern des Vorderhauses verkündet, dass aus dem Penthouse kein Pfennig mehr auf das Konto der KWV fließen würde, solange die Bürokraten dort nichts für das Penthouse tun würden. Für diese vermieften und kaputten Buden sollten auch sie dort im Vorderhaus kein Geld mehr zum Fenster rausschmeißen. Dann hatte er sich umgewandt und mit ausgestreckten Armen auf das Innere des Penthouse gewiesen, wo Putz von der Decke rieselt, sobald man nur die Tür zuklappt, wo die verblichene Tapete in den Ecken mit Reißzwecken festgehalten werden muss, weil die salpeterhaltigen Wände sich gegen die Papierverkleidung sträuben, und wo die Lichtleitungen schwungvoll herabhängen. Und in diesem Sommer, der einer afrikanischen Regenzeit gleicht, können die morschen Fensterrahmen die auf sie stürzenden Fluten nicht aufhalten, so dass es fast jeden Tag eine Überschwemmung im Penthouse gibt.
Nachdem Stuck den unsichtbar gebliebenen Bewohnern des Vorderhauses dies alles hinübergeschrien hatte, beruhigte er sich bald, nur an das Mietgeld durfte ihn keiner erinnern, dann flammte seine Wut gleich wieder auf. Jeden Monat 21 Mark, und Elke wohnte nun schon über zwei Jahre hier! Die machen sich damit vielleicht einen Fetten oder staffieren damit für andere erstklassige Komfortwohnungen aus. „Ab sofort wird das Geld verprasst, Mädchen, da machen wir lieber ’ne tolle Fete von. Die von der KWV müssen euch überhaupt dankbar sein, dass ihr diese Bude bewohnt! Draufzahlen müssten sie euch noch was, Gefahrenzulage und was weiß ich noch alles.“
Vera hatte hinter ihm vor Vergnügen gekreischt, während ihn Elke aufforderte, mit seiner Vorstellung Schluss zu machen. Im Vorderhaus hatte man schnell die Fenster geschlossen, aber Stuck war natürlich klar, dass die Leute hinter den dunklen Scheiben standen und herübergafften. Sollen sie nur, die Fettbäuche! Aber er hatte dann die Fenster wieder geschlossen, weil es stärker zu regnen begann und ihm Elke keine Ruhe ließ. Also gut, Schluss der Vorstellung! Stuck schaltete auch die Festbeleuchtung aus und ließ nur die kleine Stehlampe neben dem Fenster an, die er wegen ihres roten Schirms scherzhaft „rote Laterne von Sankt Petri“ genannt hat, weil sich am Ende der Lindenstraße die Kirche gleichen Namens befindet. Aber diese „rote Laterne“ kann keine Besucher ins Penthouse locken, weil das große Vorderhaus es völlig verdeckt und kein noch so winziger Schein roten Lichts zur Straße dringen kann. Es hätte auch kaum etwas genützt, weil der Dicke aus der ersten Etage, der sich sonst um nichts weiter im Haus kümmert, immer halb acht die Haustür abschließt. Es kann Sommer oder Winter sein, halb acht schlurft der Dicke hinunter und schließt die Tür ab. Manchmal schleicht Stuck, sobald der Dicke in seiner Wohnung verschwunden ist, über den Hof und schließt mit Elkes Schlüssel wieder auf, wenn er zum Beispiel Johannes, mit dem er im Fruchthof im Bananenkeller arbeitet, ins Penthouse eingeladen hat.“
Und diese Einladung in das Haus in der Lindenstraße 28 und in die Lebensgeschichten seiner Bewohner dürfte doch neugierig genug gemacht haben. Ebenso wie die Geschichten in den anderen vier Sonderangeboten dieses Newsletters, in denen es um die Schönheiten und Schwierigkeiten des Lebens geht. Viel Vergnügen beim Lesen, einen schönen (Lese)Herbst, bleiben Sie immer noch weiter vorsichtig, vor allem aber weiter schön gesund und munter und bis demnächst.
Ach und haben Sie vielleicht mal kurz nachgerechnet: Das Haus in der Lindenstraße wäre inzwischen vielleicht längst abgerissen oder auch saniert, und Vera und Stuck, die könnten jetzt so um die Ende 50 sein und längst selber Kinder haben …
EDITION digital war vor 26 Jahren ursprünglich als Verlag für elektronische Publikationen gegründet worden. Inzwischen gibt der Verlag Krimis, historische Romane, Fantasy, Zeitzeugenberichte und Sachbücher (NVA-, DDR-Geschichte) sowie Kinderbücher gedruckt und als E-Book heraus. Ein weiterer Schwerpunkt sind Grafiken und Beschreibungen von historischen Handwerks- und Berufszeichen sowie Belletristik und Sachbücher über Mecklenburg-Vorpommern. Bücher ehemaliger DDR-Autoren werden als E-Book neu aufgelegt. Insgesamt umfasst das Verlagsangebot, das unter www.edition-digital.de nachzulesen ist, mehr als 1.100 Titel. E-Books sind barrierefrei und Bücher werden klimaneutral gedruckt.
EDITION digital Pekrul & Sohn GbR
Alte Dorfstraße 2 b
19065 Pinnow
Telefon: +49 (3860) 505788
Telefax: +49 (3860) 505789
http://www.edition-digital.de
Verlagsleiterin
Telefon: +49 (3860) 505788
Fax: +49 (3860) 505789
E-Mail: editiondigital@arcor.de
![]()