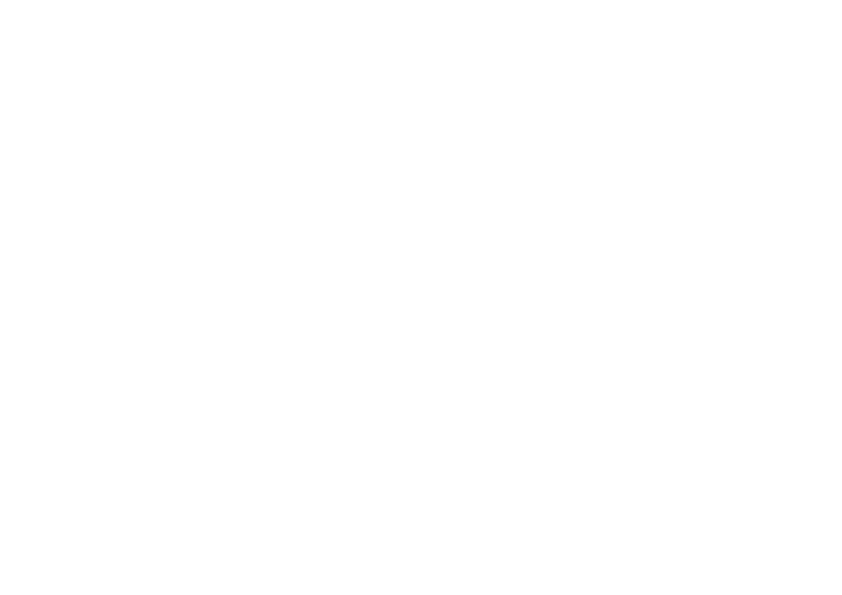Gleich drei der fünf aktuellen Angebote, die wie immer eine Woche lang zum Sonderpreis im E-Book-Shop www.edition-digital.de (Freitag, 08.01. 21 – Freitag, 15.01. 21) zu haben sind, stammen von Walter Kaufmann, der mit seinen bald 97 Jahren zu den wohl ältesten aktiven Reportern der Welt gehören dürfte. Und ein kämpferischer dazu, wie ein ganz aktuell dieser Tage mit ihm geführtes Telefonat zeigte.
Ebenfalls ein Kämpfer war der Journalist, Schriftsteller und Kommunist Erik Neutsch, der sich bis zum Schluss immer eingemischt hat in die Kämpfe seiner Zeit und der – ob es nun manchen führenden Genossen oder auch schreibenden Kolleginnen und Kollegen gepasst hat oder nicht – der immer seine Meinung gesagt, auch über Kunst und Literatur. Davon handelt der Sammelband „Fast die Wahrheit“, in dem sich nicht selten auch der Autor selbst porträtiert. Ein Grund mehr zum Wiederlesen im Jahr des 90. Geburtstages von Erik Neutsch. Aus diesem Grunde ist bei EDITION übrigens ein inzwischen bereits drittes Autorenbuch vorgesehen – über Erik Neutsch und seine Bücher.
Sehr, sehr merkwürdig beginnt die auch als „Malta-Thriller“ bezeichnete Geschichte „Erbe ohne Todesfall“, in dem ein nahe Leipzig eintreffender geheimnisvoller Brief einer Anwaltskanzlei höchst seltsame Folgen für die Hauptfigur auslöst und für Ivo Tacht – so dessen Name – und damit zugleich für die Leserinnen und Leser nicht wenige Überraschungen bereithält. Und damit sind wir wieder beim aktuellen Beitrag der Rubrik Fridays for Future angelangt. Jede Woche wird an dieser Stelle jeweils ein Buch vorgestellt, das im weitesten Sinne mit den Themen Klima, Umwelt und Frieden zu tun hat – also mit den ganz großen Themen der Erde und dieser Zeit. Und da hat die Literatur schon immer ein gewichtiges Wort mitzureden und heute erst recht. Diesmal geht es um das Schicksal von Menschen, denen in ihrer australischen Heimat im Laufe der Geschichte sehr viel Schreckliches geschehen ist und die auf dem fünften Kontinent noch bis heute ausgegrenzt und benachteiligt werden – die Rede ist von den eigentlichen Ureinwohnern dieses Kontinents, den Aborigines, denen die Invasion ihres Landes am Ende des 18. Jahrhunderts zu einer Katastrophe wurde.
Erstmals 1987 erschien im Mitteldeutschen Verlag Halle-Leipzig die einer Judith McLean gewidmete Chronik einer Nachforschung „Tod in Fremantle“ von Walter Kaufmann. Vom Autor selbst erfahren wir dazu zunächst Folgendes: Hätte ich mir nicht auf dem Weg zum Trilby Crocker Hostel so eine Art Safarihut gekauft, ein breitkrempiges Ding aus grünem Denim, ich wäre womöglich auf der Strecke geblieben. Unbarmherzig brannte die Sonne, und das Hemd klebte mir zwischen den Schulterblättern und unter den Armen wie eine zweite Haut, ehe ich ans Ziel gelangte – ein verfallenes Holzhaus am Rand der Stadt, auf dessen Treppe im Schatten des vorstehenden Wellblechdachs ein alter Mann hockte, ein Schwarzer, zerlumpt, runzlig und dürr, der mich wie eine Erscheinung bestaunte.
Am Ende war es einer, der nichts mehr zu verlieren hatte und, innerlich zerrüttet, nur noch auf Rache sann, ein zu lebenslanger Haft verurteilter Strafgefangener namens Mahoney, der die Wahrheit auspackte, die furchtbare Wahrheit – es war Mord und kein Unfall!
Der Handlungsbogen unserer Chronik erstreckt sich über zwanzig Jahre, von 1964 bis 1984, und über die halbe Welt – von Karl-Marx-Stadt bis zum Hafen von Fremantle an Australiens Westküste, wo die Hintergründe des Mordes an einem jungen Mann aufgeklärt werden, der, wie alle Aborigines, in seinem Land gebrandmarkt und auf der Flucht war. Hier der Beginn dieser sehr spannenden Nachforschung, die ebenfalls durch einen Brief ausgelöst wird:
„1.
Neun Jahre nach meiner Rückkehr aus australischer Emigration, im Sommer 64, erreichte mich in Berlin ein Brief aus Belgrad, der ein Aufschrei war, ein Hilferuf.
Zwischen einem höflich-formellen „Dear Sir“ und dem schlichten „Yours truly“ hatte eine Lehrerin aus Perth, eine mir Unbekannte namens Joan O’Leary, in eindringlichen Worten geschildert, wie sie eines Findlings wegen, des Kindes einer schwarzen Frau, in Schwierigkeiten geraten war. Das nur wenige Wochen alte Wesen war früh morgens auf den Stufen der Schule ausgesetzt worden, und sie, die Lehrerin, hatte es dort vor Beginn des Unterrichts entdeckt. Da sie ahnte, wem das Kind gehörte, hatte sie es bereitwillig zu sich genommen – auf Zeit, wie sie anfangs glaubte. Doch die Mutter blieb verschollen und tauchte weder in der Schule, wo sie zuweilen beim Saubermachen geholfen hatte, noch bei der Pastorenfamilie wieder auf, bei der sie wohnte und in Stellung war. So wuchs das Pflegekind Joan O’Leary allmählich ans Herz, und als der Schuldirektor, auf die Gesetze des Landes pochend, darauf bestand, es in die staatliche Obhut eines Heims zu geben, widersetzte sie sich. Schließlich reichte sie sogar ihre Kündigung ein. Da sie nun schon nicht mehr an die Rückkehr der Mutter glaubte, verzog sie nach Melbourne – so weit wie möglich fort von jeglichen Behörden, die ihr das Kind streitig machen konnten. Erleichtert aber war sie erst, als sie dort die Nachricht erreichte, die Mutter habe sich gemeldet und dankbar gezeigt, ihren Jungen in guter Obhut zu wissen. Wie aber, hatte sich Joan O’Leary fragen müssen, sollte sie auf die Dauer für das Kind sorgen, wenn es ihr nicht gelang, eine neue Stellung zu finden. Es schien, als hinge ihr die Kündigung des Schuldienstes über alle Bundesgrenzen hinweg an.
So war sie schließlich zu dem Entschluss gelangt, Australien zu verlassen und es im Ausland zu versuchen. Wie sie mit ihrem Schützling, der ihr ja amtlich nie zugesprochen worden war, selbst von der Mutter gab es nichts Schriftliches, ungehindert hatte ausreisen können, schrieb sie nicht und setzte erst wieder an dem Punkt ein, der mich unmittelbar betraf.
In Belgrad nämlich, wohin sie über Italien gelangt war, hatte sie bei der DDR-Botschaft um Asyl ersucht, damit ihr Ricki, so ihre Worte, in einem Land aufwachsen könne, wo er gleichberechtigt sei. Ich möge ihr nachsehen, dass sie mich dabei als Referenz benannt habe. Zwar seien wir uns nie begegnet, und doch glaube sie, mich durch meine in Australien veröffentlichten Bücher zu kennen, die ihr begreiflich gemacht hätten, warum ich in ein Land zurückgekehrt war, aus dem ich einst hatte flüchten müssen. Rassenvorurteile könne es demnach dort nicht geben – was wohl das Land zu einem wirklichen Zufluchtsort für ein Kind wie Ricki mache und darum auch für sie. Sie endete mit der Frage, ob sie mit meiner Unterstützung rechnen dürfe, und empfahl sich mit verbindlichem Dank im voraus.
Meist nur sehr indirekt erfährt ein Schriftsteller von den Auswirkungen seiner Arbeit. Darum wird es nicht verwundern, dass mir der Brief keine Ruhe ließ, bis ich mich an eine mir nahestehende Ratsvorsitzende in Berlin-Mitte gewandt hatte, eine beherzte Frau, die sofort Hilfe versprach. Mein Eilbrief aber, den ich daraufhin nach Belgrad schickte, blieb ohne Antwort, und vier Jahre sollten vergehen, ehe ich den Grund erfuhr – Zeit, in der ich nicht nur mit der Niederschrift einer Reportage beschäftigt, sondern auch oft im Ausland war, so dass ich die Frau und ihr Anliegen allmählich vergaß. Nie war mir auch nur der Gedanke gekommen, sie könnte mit dem Jungen ohne mein Wissen zu uns gelangt sein, geschweige denn, dass ich eines Tages seinetwegen die aufwendigsten Nachforschungen betreiben sollte, die mich bis ans andere Ende der Welt führten …
Deus ex Machina – da werde ich an jenem Wintertag des Jahres achtundsechzig in meinem Auto einen jungen Studenten aus Namibia mitnehmen, der von Berlin auf Trampfahrt nach dem Süden der Republik ist. Kaum hat er erfahren, wie ich zu meinen Englischkenntnissen gekommen bin, gibt er ein Erlebnis zum Besten, das mich aufhorchen lässt. Vor ein paar Wochen sei ihm beim Eintritt in ein Restaurant von Karl-Marx-Stadt ein robustes Kerlchen von etwa fünf Jahren mit dem Aufschrei „Papa, Papa!“ entgegengestürzt und habe seine Beine so fest umklammert, dass er Mühe hatte, sich zu befreien. Um das Kind nicht zu kränken, das offensichtlich den Vater in ihm suchte, habe er den Ansturm über sich ergehen lassen, den Jungen am Ende sogar hochgehoben und ein bisschen gedrückt. Schließlich habe er auch die Mutter kennengelernt, vielmehr die Pflegemutter, die sich als Australierin erwies.
„Joan O’Leary“, werfe ich ein, „und der Junge müsste Ricki heißen.“
So sehr ihn das erstaunt, noch mehr erstaunt uns beide der Zufall, dass gerade ich am Schönefelder Kreuz für ihn angehalten hatte.
„Richtig, bei Gott – so heißen sie!“
Sollte er auf dem Weg zu ihnen sein, brächte ich ihn bis vor die Tür, bot ich ihm an, worauf er mit hellem Lachen die Hände zusammenschlägt.
„Gibt das eine Überraschung!“
Was das Kind anging, so hatte er sich geirrt. Ricki, ein überaus lebhafter, gut gewachsener, gut anzusehender Junge mit dunklen Augen, dunklem seidigem Haar, dabei weit hellhäutiger als der Mann, in dem er den Vater sah, würdigte mich nach kürzester, in unverfälschtem Sächsisch hervorgebrachter Begrüßung keines weiteren Blickes. Bereitwillig überließ er mich seiner Pflegemutter, einer resolut wirkenden Frau Mitte Dreißig von etwas herbem, aber gefälligem Äußeren, mit rötlichem Haar und braunen Augen, deren erste Worte schon im Tonfall unverkennbar australisch klangen: „Better late than never!“
Kaum hatte sie uns in die beengte, wenig aufgeräumte Mansardenwohnung eingelassen, erfuhr ich, dass sie mein Antwortschreiben nach Belgrad nicht abgewartet hatte, weil ihr bei einem zweiten Besuch in der DDR-Botschaft mitgeteilt worden war, ich sei schon seit langem als Auslandskorrespondent in den USA – ein verständlicher Irrtum, da zu jener Zeit im „Neuen Deutschland“ eines meiner Amerikabücher in Fortsetzungen erschien. Im Verlauf der Unterredung habe man ihr, inoffiziell, versteht sich, den Rat gegeben, es trotzdem zu versuchen und hinter der westdeutschen Grenze einfach aus dem Zug zu steigen.“ Und damit zu den ausführlicheren Vorstellungen der anderen vier Sonderangebote dieses zweiten Newsletters des neuen, immer noch jungen Jahres. Auch die nächsten zwei stammen übrigens von Walter Kaufmann.
Erstmals 1960 veröffentlichte Walter Kaufmann im Verlag Volk und Welt Berlin „Ruf der Inseln“, zu dem der Verfasser anmerkt: Ja, ich habe die Bewohner der Fidschi-Inseln mit tiefen, vollen Stimmen die Lieder ihrer Heimat singen hören, ich habe ihr gemeinsames Leben in den Grashüttendörfern an den Küsten geteilt, ich bin in der Abendkühle, wenn die rote Sonne mit der tiefblauen See verschmolz, unter Palmen gegangen. Ein Gefühl für das Schöne drängte mich, diesen Erinnerungen Gestalt zu geben. Doch mein Gewissen drängte mich, bis ich diese Geschichten und diese Skizzen schrieb.
Und wenn in dieser Nacht ein junges Hindumädchen in einem Hafen der Fidschi-Inseln einem Weißen ihren schlanken Körper anbietet, dann tut sie es, weil die Sehkraft ihres Vaters für immer geschwächt ist, seit die Polizei mit Tränengas und Knüppeln den ersten Streik der indischen und polynesischen Zuckerarbeiter vor zwei Jahren in Lautoka zu brechen versucht hat; dann tut sie es, weil der Lohn ihrer beiden Brüder, die auf den Zuckerrohrpflanzungen fronen, nicht ausreicht, sie mit dem Lebensnotwendigsten zu versorgen.
Und wenn morgen ein Fidschi in seinem verzweifelten Drang nach Freiheit über die Reling des Frachters „Delfino“ springt, dessen Eingeborenenbesatzung einen Bruchteil der Heuer bekommt, die vorher der australischen gezahlt wurde, dann tut er es, weil er sein Los nicht länger erträgt.
In diesem Buch voller Stories, voller Shortstories erzählt Walter Kaufmann wenn auch häufig in exotischem Gewand von Menschenschicksalen, von Menschen, die um ihre Liebe und um ihre Existenz kämpfen müssen. Kaufmann erzählt abenteuerlich und ernst, bitter und sozial genau.
Da ist zum Beispiel die Geschichte von dem Seemann Keith Forrest, der in Sydney Frau und zwei Kinder hat. Alle auf der „Rosa“ kannten Caroline aus Suva und wussten, dass sie Keith Forrest gehörte: Sie war nicht wie die anderen Töchter der Fidschi-Inseln, nicht so redselig, ruhiger, zierlicher aber auch nicht so schön. Im Vergleich zu ihnen war sie mager, hatte eine viel dunklere, fast schwarze Haut, und ihr Gesicht war auf Stirn und Wangen von Blatternarben entstellt. Doch ihre Augen, die Augen ihrer Mutter, waren groß und leuchtend wie zwei stille Weiher in einer rauen Landschaft, und ihre Stimme, die Stimme ihres Vaters, war leise und sanft wie das Raunen des Windes in den Blättern der Palmen. Forrest bittet den Ersten Offizier um Ausgang und geht noch einmal zu ihr, weil er noch etwas zu erledigen hat. Und wir erfahren gleich, was genau:
„Ruf der Inseln
Sie war nicht wie die anderen Töchter der Fidschi-Inseln, nicht so zungenfertig, ruhiger, schlanker, aber auch nicht so schön. Im Vergleich zu ihnen wirkte sie mager und unbeholfen; ihre Haut war viel dunkler, fast schwarz und auf Stirn und Wangen von Pockennarben entstellt. Doch ihre Augen, die großen, strahlenden Augen ihrer Mutter, waren wie stille Weiher, und ihre Stimme, die leise, sanfte Stimme ihres Vaters, klang wie das Raunen des Windes in den Blättern der Palmen. Die Mannschaft der „Rosa“ kannte sie als Caroline von Suva und wusste, dass sie dem Seemann Keith Forrest angehörte, der in Sydney Frau und zwei Kinder hatte.
Keith Forrest ging nach mittschiffs und klopfte an die Kajütentür.
„Herein!“, rief der Erste Offizier.
„Kann ich den Nachmittag frei haben, Mister?“, fragte Keith.
Der Offizier sah auf, zögerte, dann erinnerte er sich an etwas. „Ist gut“, sagte er. „Morgen früh sind Sie wieder da.“
Einem so guten Matrosen kann man schlecht etwas abschlagen“, erklärte er dem Zweiten Offizier, als Forrest außer Hörweite war. „Außerdem …“ Er machte eine Eintragung im Wachplan und schwieg; was er noch hatte sagen wollen, war allgemein bekannt.
Keith Forrest streifte das Hemd und die mit Farbe bespritzten Arbeitshosen ab und duschte. Das Wasser war lau und erfrischte nicht; den ganzen Morgen hatte die Tropensonne auf die Wassertanks des festgemachten Frachters gebrannt. Forrest ließ sich vom Seewind trocknen und abkühlen, als er übers Deck zu seiner Kajüte ging. Aus seiner Seekiste nahm er ein frisches Hemd und eine saubere Flanellhose. Langsam zog er sich an. Ohne jemand ein Wort davon zu sagen, ging er bedächtig den Laufsteg hinunter und den Kai entlang zu den Hafentoren. Kaum war er draußen, umdrängten ihn Fidschi, die ihre Waren feilboten.
„Schönes Armband für Mädchen, schöne Muschel.“
„Schönes Halsband …“
Sie hielten ihm die Muschelschnüre verlockend dicht vors Gesicht, traten so nah an ihn heran, dass er den Geruch ihrer dunklen Haut wahrnahm. Er schaute um sich. Und dann hörte er ihre sanfte Stimme seinen Namen rufen – sie sprach ihn falsch aus wie immer: „Kei, o Kei!“ Der Seemann lächelte, flüchtig nur. Die Spannung wich aus seinem Körper, der suchende Blick aus seinen Augen.
„Caroline“, sagte er zärtlich.
„Kei, o Kei!“
Es war, als wüsste sie nur diese Worte. Er legte seine Hand auf ihren Arm. Sie rührte sich nicht, sie schien versteinert. Nur ihr Blick umschlang ihn mit verzehrendem Feuer.
„Komm, Caroline“, bat der Mann.
Hand in Hand gingen sie über den wimmelnden Markt. Ein Zollbeamter sah sie scharf an, spie aus und wandte sich ab. Die Fidschi schauten ihnen nach. Die beiden verschwanden zwischen den Ständen auf der anderen Straßenseite, wo sich ein Palmengürtel am Strand entlangzog, der das Grashüttendorf säumte.
„Sa tabu“, sagte ein Fidschi, „sa tabu, tabu…“
Keith Forrest war ein großer, schweigsamer ansehnlicher Mann, dem die Frauen nachblickten – aber nur selten ließ er sich mit einer ein. Er war fünfunddreißig Jahre alt, und zwanzig Jahre davon war er auf Schiffen um die Welt gefahren. Vor zehn Jahren hatte er in Sydney eine Verkäuferin geheiratet und ihr zuliebe eine Weile auf einem Schlepper gearbeitet; von der Reling aus hatte er die großen Ozeanfahrer an den Riffen vorbei auf das offene Meer zusteuern sehen. Ein ganzes Jahr lang war er täglich mit Schlips und Kragen, eine Tasche unter dem Arm, in eine rüttelnde Straßenbahn gestiegen; ein ganzes Jahr lang hatten der kreischende Verkehrslärm, die Neonlichter und die spannungsgeladene Atmosphäre ebenso an seinen Nerven gezerrt wie die graue Langeweile seines Häuschens mit den Küchendünsten, der rostigen Badewanne und dem großen Metallbett, in dem er und Agnes schliefen. Und als das Jahr um war, hatte er gesagt: „Ich denke, ich fahre wieder zur See.“
„Aber als wir geheiratet haben, hast du versprochen …“
„Ich weiß, ich habe es versprochen, aber ich kann nicht anders, Agnes.“
Dann war er ins Heuerbüro gegangen und hatte auf dem ersten Schiff angemustert, das Mannschaft suchte.
In der Kühle einer Grashütte lag Keith Forrest jetzt auf einer Matte und schaute den Südseewellen zu, die im Gleichmaß gegen den Strand anrollten. Der spitzenzarte Schaum schimmerte in der Sonne. Zwei nackte Fischer, deren Körper sich von dem hellen Sand fast schwarz abhoben, liefen mit stoßbereiten Speeren lachend am Wasser entlang.
„Na–i–yai–ya–na–ei …“
Keith Forrest hörte sie noch, als sie seinen Blicken schon entschwunden waren. Einmal drang triumphierendes Gelächter an sein Ohr, klingend wie eine Glocke, und er glaubte den silbrig blinkenden Fisch zu sehen, der sich am Speer wand.
Er drehte sich zu Caroline um. „Frau …“
„Komm her, ich will dir was erzählen.“
Und er erzählte ihr, die alles und nichts verstand, von den Dingen, die ihn beschäftigten: von Streiks und Gewerkschaftsfragen, von Schiffen und Seeleuten, von Schulden und von Agnes’ vertanem Leben; von endlosen Reihen dicht aneinandergedrängter Häuser, die sich nur durch ihre Nummern unterschieden; von dem Ruß, der sich auf alles legte, und dem stinkenden Gasometer am Ende der Straße, in der er wohnte; von dem Husten, den sein Jüngster hatte, weil das Haus im Winter ständig feucht war.
„Was hältst du von einem Mann, der seiner Frau wegläuft?“, fragte er plötzlich. „Keinen Sechser wert, was?“
Caroline blickte ihn mit ihren strahlenden Augen an und bemühte sich, von seinem Gesicht die Antwort abzulesen, die er erwartete. Schließlich schüttelte sie kaum merklich den Kopf.“
Nur ein Jahr später, also erstmals 1961, veröffentlichte Walter Kaufmann im Aufbauverlag Berlin seine Südseegeschichten unter dem Titel „Feuer am Suvastrand“ – im englischen Original „FIRE ON Suva BEACH“: Unter der tropischen Sonne des Pazifiks, dort, wo gestern morgen wird, ziehen sich die Fidschi-Inseln über den einhundertachtzigsten Meridian hin. Palmengesäumte Küsten, Korallenriffe unter sanften grünen Hügeln; vor den Grashütten brennen die Feuer, und aus der Ferne klingen Gitarren zu dem Lied der Eingeborenen Isa Lei. Doch in den Zauber dieser paradiesischen Welt ist die Zivilisation mit ihren Segnungen gedrungen, hat Häfen angelegt, Zuckerfabriken, Hotels und Zollhäuser errichtet und Fidschi, Inder und Mischlinge auf ihre Lohnlisten gesetzt. Dem australischen Seemann, der zerschunden und erschöpft in Suva an Land geht und sich am schattigen Strand oder in der Hafenkneipe von der Überfahrt auf dem tobenden Meer erholen will, dem Heizer oder Trimmer wird die flüchtige Begegnung mit den Mädchen, Frauen und Männern der Inseln zum beglückenden Erlebnis oder tragischen Verhängnis. Wo Zwang, Liebe und Pflicht aufeinanderprallen, flackert auch hier in der Südsee das Verlangen auf, Mensch sein zu dürfen. In jeder der Skizzen und Episoden schlägt das Herz des fahrenden Schriftstellers, den das Geschick nach dem fünften Kontinent verschlug. Und hier der Beginn der Titelgeschichte. Hören wir seinen Berichten zu, hier der Beginn der titelgebenden Geschichte:
„Feuer am Suvastrand
Diese Reise zu den Inseln war stürmisch gewesen, stürmisch wie keine andere in den zehn Jahren, die ich zur See gefahren bin. In den letzten drei Tagen hatte ein Hurrikan die „Rosa“ wie Treibholz durch den tobenden Pazifik geschleudert. Als wir in Suva vor Anker gingen, war die ganze Mannschaft zerschunden und erschöpft – wie nach Prügeleien im Hafen. Ich hatte mir die Handknöchel durchgescheuert an den Stahlwänden des engen Ganges, der von den Kohlenbunkern zum Kesselraum führt. Da es keine Trimmer auf dem Schiff gab, mussten wir Heizer uns die Kohle selbst in Schubkarren holen – auch unter günstigsten Umständen schwere Arbeit, wenn man bedenkt, dass wir zwischen den Wegen zu den Bunkern die Kessel unter Druck halten mussten. So aber, da der Frachter schlingerte und rollte, als wäre er ein Schiff ohne Ruder, bald senkrecht in die Tiefe schoss wie ein Stein in einen Abgrund, bald wie ein Ballon in die Höhe stieg und sich drehte und wand gleich einer Schlange, so aber war unsere Arbeit die reine Hölle. Ja, die Hölle! Leben oder Sterben war uns gleich. Wir schufteten wie Roboter, fielen halb tot in die Schlafkojen, wenn unsere Wache vorbei war. Wir aßen nicht, wuschen uns nicht, sprachen nicht – wir fluchten nur, gemein, schmutzig, unmenschlich. Drei Tage und drei Nächte unter solchen Bedingungen hatten uns alle zu knurrenden Bestien gemacht, wir waren verbeulte Hüllen von Seeleuten, die auf dem schlingernden Schiff herumkrochen wie vierbeinige Käfer. Als wir endlich den Hafen erreichten, waren unsere Sinne betäubt, unsere Körper völlig zerschlagen. Mein Freund Curly Lynch lag mit gequetschtem Fuß in der Krankenkajüte, Archie Miles hatte ein gebrochenes Schlüsselbein, und meine linke Hüfte fühlte sich an, als hätte ein Lastwagen sie gerammt, tatsächlich war aber nur der Schubkarren dagegengeprallt, als er bei einer Schlingerbewegung des Schiffs von einer Seite des Kesselraums zur anderen geschleudert wurde.
Die „Rosa“ hatte etwa vor einer Stunde festgemacht, da sagte uns der Zweite Ingenieur, dass wir diesen und den nächsten Tag Urlaub hätten. Wir bedankten uns nicht, wir nickten bloß. Uns war nichts wichtig – nur dass wir die Fahrt überlebt hatten. Die Schönheit der Fidschi-Inseln, die wir alle kannten und für die wir alle empfänglich waren, der Sonnenschein über der Insel, der Strand und die Palmen ließen uns kalt. Keinem lag daran, mit den anderen zusammen zu bleiben, nicht einmal an den Halbblutfrauen, die am Hafen auf uns warten würden, lag uns etwas. Wir hinkten vom Schiff, die Gangway hinunter, die Kais entlang, jeder für sich, wie Fremde.
Ich passierte das Hafentor und schob die farbigen Händler zur Seite, die Halsketten, Muscheln und Früchte feilboten; ich hatte nichts als einen doppelten Whisky mit Soda im Sinn, also steuerte ich die nächste Kneipe an – ein lang gestrecktes, niedriges Gebäude im Palmenschatten auf der anderen Seite des Marktplatzes. Die Luft war heiß und dunstig. Meine Hüfte tat weh, und ich hatte das Gefühl, ein Schraubstock presste meinen Schädel zusammen. Ich riss die Tür auf. Im Schankraum wimmelte es von Indern, Mischlingen und Weißen. Ich drängte mich zur Theke durch, bestellte Schnaps und trank, trank – einen, zwei, ich weiß nicht wie viele Whiskys. Nach einer Weile machte ich mir nicht mehr die Mühe, Sodawasser in den Whisky zu gießen, sondern trank ihn pur. Hätte ich das nicht getan, lebte Hugh Mason vielleicht noch heute.
Ich muss fast eine Stunde in der Kneipe gewesen sein; mein Kopf war benebelt von den vielen Schnäpsen, und ich wollte irgendwo am nahen Strand schlafen, bis er wieder klar war. Da kam Hugh Mason herein. So blau ich war, sein Anblick erschreckte mich. Nie hatte ich erlebt, dass er sich anders als sauber und adrett in seiner weißen, gestärkten Zollbeamtenuniform in der Öffentlichkeit gezeigt hätte. Jetzt sah er verwahrlost aus, sein Hemd war schmutzig, seine Hosen zerknüllt, keine Mütze bedeckte sein dünnes blondes Haar, das in Strähnen an seinem schmalen Gesicht und seiner schweißnassen Stirn klebte. Seine blauen Augen hatten einen stumpfen Ausdruck wie die eines Menschen, der aus einer schweren Betäubung erwacht. Er ging nicht, er torkelte vorwärts, als wäre er betrunken. Jemand streifte ihn, da fiel er beinahe hin; endlich erreichte er die Theke und klammerte sich haltsuchend an ihren Rand.
„Einen doppelten Scotch“, bestellte er leise bei dem dunkelhäutigen Schankkellner.
„Bitte sehr, Sir!“
Ich beobachtete ihn eine Weile, dann kippte ich den Rest meines Whiskys hinunter und trat auf ihn zu. „Hughie“, sagte ich, „Hughie!“ Langsam drehte er mir sein Gesicht zu; es schien, als würde sein Kopf von einem unsichtbaren Draht bewegt, wie der einer Marionette. „Jim“, erwiderte er tonlos, „du?“ Er sprach so sonderbar, dass ich nicht einmal sicher sein konnte, ob er mich erkannt hatte.
„Du bist betrunken, Hugh“, erklärte ich, aber ich bedauerte meine Worte sofort, denn ich hatte ihn noch nie betrunken gesehen.“
Erstmals 1979 veröffentlichte Erik Neutsch im damaligen DDR-Gewerkschaftsverlag Tribüne Berlin den Sammelband „Fast die Wahrheit. Ansichten zu Kunst und Literatur“, das wie alle Bücher des ebenso konsequenten wie meinungsstarken und mitunter recht eigensinnigen Schriftstellers auf dessen ausdrücklichen Wunsch hin nicht auf neue Rechtschreibung umgestellt wurde – auch als E-Book nicht: Dieser zweite Sammelband Erik Neutschs enthält Aufsätze und Reden, Interviews und Artikel, die er als „Ansichten zu Kunst und Literatur“ zusammengestellt hat. Erik Neutsch, der wie eingangs schon erwähnt in diesem Sommer 90 Jahre alt geworden wäre, hat wie kaum ein anderer Schriftsteller, der mit und in der DDR gewachsen ist, zur jeweiligen aktuellen Situation in der Literaturszene Stellung genommen. Dabei hat er in den meisten Beiträgen aus konkreten Anlässen heraus vor allem die prinzipiellen ästhetischen Positionen der Arbeiterklasse – wie Parteilichkeit und Volksverbundenheit – gegen Angriffe, Schwankungen oder gar ein In-Frage-Stellen verteidigt. Auch was seinerzeit nur für den Tag geschrieben schien, wirkt heute aktuell, liest sich lebendig und interessant – auch wenn es inzwischen aus längst vergangenen Zeiten zu kommen scheint, wie der folgende Ausschnitt eines Interviews, der etwa der Mitte seines Fast-die-Wahrheits-Buches entnommen ist und der manche spannende Auskünfte über den Autor bereithält:
„1974
Das Revolutionäre in unseren Tagen
Dietrich Sommer: Wie bist du zum Schreiben gekommen, und welche Schaffensimpulse betrachtest du heute als die wichtigsten?
Erik Neutsch: Ich habe schon als Junge ein intensives Bedürfnis zum Schreiben gehabt und glaube, daß der unabweisbare Drang zum Schreiben – oder wie immer man das nennen soll – eine ganz wichtige Voraussetzung für jede schöpferische schriftstellerische Tätigkeit ist, und zwar unabhängig davon, was anfangs dabei herauskommt. Bei mir waren es zunächst und naiverweise vier „große“ Dramen, die ich mit dreizehn Jahren und wenig später sozusagen verbrochen habe: eines über den Cid, das zweite, „Thermidor“ genannt, über Georg Büchner und Pfarrer Weidig; das dritte hieß „Die goldene Wanne“ und behandelte vom Standpunkt eines anarchischen Antikapitalismus den Verfall einer Familie, und das vierte, „La sale guerre“, trat für den gerechten Krieg des vietnamesischen Volkes gegen die französische Kolonialmacht ein. Im übrigen habe ich, wie viele andere auch, natürlich eine Menge Gedichte geschrieben, über die ich jetzt besser schweigen will.
Talent und den Willen zum Schreiben haben nun allerdings viele. Die Sache ist nur die, daß sich diese persönlichen Voraussetzungen, darunter auch literarische Kindheitserlebnisse, erst durch reale gesellschaftliche Beziehungen, durch praktische Tätigkeit und – nicht zuletzt – durch lernendes Lesen produktivitätsbildend auswirken. Man muß nicht nur von der Kunst, sondern auch vom Leben fasziniert sein.
Wenn ich zunächst auf meine entscheidenden Lektüreerlebnisse zurückblicke, so würde ich an erster Stelle Schillers „Räuber“ nennen, an denen mich vor allem das weltumstürzende Rebellentum des Karl Moor kolossal aufgeregt hat. Große Bedeutung hatte für mich auch Büchners „Dantons Tod“, an dem mich bis heute neben der Revolutionsproblematik die sinnliche Vitalität fesselt. Und was schließlich die sozialistische Literatur betrifft, beschäftigt mich seit vielen Jahren Scholochows „Der stille Don“. An diesem Roman habe ich gelernt, den Klassenkampf tiefer zu begreifen, und ich verdanke ihm persönliche Eindrücke darüber, was die Kunst des Erzählens sein und leisten kann. Aber eben: Das literarische Erlebnis allein, so wichtig es ist, formt noch keinen Schriftsteller. Erst das Erlebnis der Einheit und der Widersprüche zwischen Kunst und Leben haben bewirkt, daß ich den Romantizismus meiner jugendlichen Vorstellungswelt überwinden konnte. Dabei hat allerdings auch die Wissenschaft eine ausschlaggebende Rolle gespielt.
Ich bin 1949 in die SED eingetreten und habe von 1950 bis 1953 an der Gesellschaftswissenschaftlichen Fakultät der Karl-Marx- Universität Kulturpolitik und, gleichfalls in Leipzig, Journalistik studiert. Diese Jahre könnte ich rückblickend als die Zeit meines intellektuellen „Erwachens“ bezeichnen. Damit meine ich, daß an die Stelle ungeordneter, mitunter etwas wirrer Erlebnisse die Fähigkeit der theoretischen Verarbeitung, der kritischen Kontrolle getreten war und schließlich der Wille nach einer immer weiterführenden rationalen und ästhetischen Durchdringung der Welt.
Damit aber nicht genug. So richtig produktiv begann die Sache erst dann zu werden, als sich ästhetisches Erleben und rationale Erkenntnis mit der politischen Praxis verbanden. Dies geschah, als ich als Redakteur bei der FREIHEIT im direkten Auftrage der Partei arbeitete. In der journalistischen Arbeit lernte ich, daß sich die Welt nur in dem Maße verändern läßt, in dem man das Leben kennt, wie es tatsächlich ist, und in dem man die Kenntnisse darüber theoretisch zu verarbeiten vermag. Ich meine damit auch und vor allem das proletarische Leben. Denn mit meinen Werken möchte ich gerade die Menschen jener Klasse erreichen, aus der ich komme. Dies ist der entscheidende politische Impuls meiner Schriftstellerei. Darum halte ich nicht viel von Romanen, denen man es ansieht, daß sich ihre Autoren den Marxismus nur theoretisch angeeignet haben. Ich verstehe die Schwierigkeiten dieser Autoren, was aber nicht heißen kann, daß ich ihre Werke billigen muß.“
Erstmals 2012 veröffentlichte Ingo Kochta im Projekte-Verlag Cornelius Halle damals noch unter dem Titel „AMAS Mdina“ seinen inzwischen mit einem neuen Titel versehenen Malta-Thriller „Erbe ohne Todesfall“. Das E-Book – wie auch das gedruckte Buch – präsentiert den Text in einer leicht überarbeiteten Fassung und mit neuem Titel: Ivo Tacht lebt beschaulich in geordneten Verhältnissen auf dem Lande in der Nähe von Leipzig. Ein Brief eines Anwalts aus Malta lässt ihn zu einer Reise ins Ungewisse aufbrechen. Er übernimmt die Führung der AMAS, einer Firma, die sich äußerlich mit Kunsthandel befasst, und taucht in eine ihm bis dahin unbekannte Welt ein, die beherrscht wird von Macht und Intrigen. Bald begreift er, dass in den Archiven der AMAS keine normalen Kunstgegenstände verwahrt werden. Neben wertvollen Artefakten lagern in den Stahlkammern düsterste Geheimnisse der Vergangenheit. Die Mystik Maltas zieht ihn magisch in ihren Bann und setzt in ihm bisher unbekannte geistige Kräfte frei. Gelingt es ihm gemeinsam mit seinen Freunden und Kollegen, die feindliche Übernahme der AMAS zu verhindern? Können sie seine Freundin aus den Fängen geheimnisvoller Entführer befreien? Gibt es das mysteriöse Templerschloss? Sind seine neu entdeckten mentalen Kräfte ein Fluch oder ein Segen? Zum Kennenlernen hier
„Kapitel 4
Erfrischt und ein kühles Getränk vor sich, öffnete Ivo die hinterlegten Nachrichten. Die Kanzlei Vogelt bat um eine unverzügliche Kontaktaufnahme, vom Hotelmanager lag ein persönliches Begrüßungsschreiben vor und ein Kuvert von Mr. Jack McMahon. Der Inhalt bestand aus einer Visitenkarte mit einer handschriftlichen Notiz. „Sobald Sie gut angekommen sind, würde ich gern einen Whisky mit Ihnen genießen.“
Was er davon halten sollte, wusste er nicht. Wer ist dieser Mr. Jack McMahon? Er hatte aber keine Lust, schon wieder zu grübeln und genoss lieber sein Wasser und das angenehme Umfeld. Oberhalb der großzügigen zweiteiligen Poolanlage, mit direktem Blick auf die gegenüberliegenden Gebäude der Universität von Valletta, entspannte er sich. Eine leichte Trägheit bemächtigte sich Ivo und veranlasste ihn, sich nur treiben zu lassen. Doch es war Zeit, erste Telefonate zu führen. In der Kanzlei bekam er für morgen einen Termin. Mit dem mysteriösen Mr. McMahon hatte sich Ivo für den frühen Abend auf einen Drink verabredet.
In einer halben Stunde wurde er abgeholt. Er wollte die verbleibende Zeit für erste Eindrücke von Land und Leuten nutzen. Unterhalb der Altstadt Vallettas ließ er sich absetzen und stieg den steilen Weg zur Stadt hinauf. Für eine vermeintlich flache Insel schon kurios. Gebannt betrachtete Ivo die steilen Häuserzeilen, die Valletta wie eine Schlucht erscheinen lassen. Die Straßen fielen zum Teil so steil ab, dass die Autos mit zum Bordstein eingeschlagenen Rädern geparkt wurden. Die Fußwege sind Treppen. Es war faszinierend, wie in den engen Straßen unerwartet bizarre Lichteffekte spielten. In den Seitenstraßen, die alle im rechten Winkel zueinander liegen, waren kleine Läden für jeden Bedarf. An jeder Ecke Madonnen und Heilige. Tradition und Moderne eng beieinander. Man glaubt, jeden Moment tritt ein Ritter, mittelalterlicher Händler oder gar Pirat aus einer der kunstvoll gearbeiteten Haustüren. Ivo genoss den Esprit Vallettas.
Der Schlag der Kirchglocken brachte ihn in die Gegenwart zurück. Es war Zeit, sich nach dem Ort seiner Verabredung umzusehen. Viele Schirme überdachten auf dem Boulevard eine riesige Freifläche, auf der Tische und Stühle eines Cafés zum Verweilen einluden. Ivo schlenderte durch die Reihen und suchte einen Tisch, wo eine „Bild“ und eine „Times“ lagen. Das war das ausgemachte Erkennungszeichen. Einige Tische vor ihm erhob sich ein Herr, etwa sechzig, modisch, elegant gekleidet und mit sportlichem Aussehen.
„Hallo Mr. Tacht, wie ich annehme? Ich bin Jack McMahon. Ich begrüße Sie recht herzlich auf Malta.“
„Ja, ich bin Ivo Tacht. Woher wissen Sie, wer ich bin? Aber trotzdem danke ich für die freundliche Begrüßung.“
„Bitte nehmen Sie Platz. Möchten Sie etwas trinken?“
„Bitte eine Cola.“
„Jessica, please one Coke and for me, you know … okay.“
Ivo war erstaunt, wieso McMahon ihn sofort zweifelsfrei erkannt hatte. Das Bestellte kam und sie begannen eine zwanglose Plauderei. Man konnte denken, alte Freunde saßen beieinander. Mr. McMahon sprach ein exzellentes Deutsch. Ivo war etwas verlegen, da seine Sprachkenntnisse dagegen bescheiden waren. Er war aber froh, so wenige Probleme mit der Verständigung zu haben. Ivo wurde unruhig. Noch immer kannte er nicht den Grund für diese Reise.
„Mr. McMahon. Halten Sie mich bitte nicht für unhöflich, doch erklären Sie mir den Grund für meine Anwesenheit.“
„Eine durchaus berechtigte Frage. Ich werde versuchen, Ihnen die Angelegenheit verständlich zu machen. Ich würde vorschlagen, bevor ich beginne, nehmen Sie einen Brandy oder Whisky. Für alle Fälle!“
„Ich verstehe zwar nicht ganz, doch einen guten Whisky schlage ich nicht aus.“
Auf ein Zeichen brachte die Bedienung das Gewünschte.
„Darf ich Sie trotzdem bitten, sich mit Ihrem Pass oder deutschen Personalausweis auszuweisen. Man kann nie wissen.“
Ivo legte etwas verwundert seinen Ausweis auf den Tisch und McMahon prüfte, ob auch alles seine Richtigkeit hatte.
„Da Sie der sind, der Sie von Beginn an schienen, will ich versuchen, Ihren Wissensdurst zu stillen.“
Die Bedienung brachte McMahon noch einen Brandy.
„Thank you, Jessica. You are a pearl.“
Lächelnd, mit einer leichten Verbeugung, bedankte sie sich. „Thank you, Major.“
„Major?“
„Nur ein Relikt aus vergangenen Zeiten. Es hat sich über all die Jahre erhalten. Aber nun möchte ich mich Ihnen kurz vorstellen, damit Sie wissen, mit wem Sie es zu tun haben. Ich bin Inhaber einer Steuer- und Finanzkanzlei auf Malta. Hier ist die Drehscheibe für den Ost-West- sowie Nord- und Südhandel. Wir beraten die Regierung Maltas zu bestimmten rechtlichen Fragen. Ich lege größten Wert darauf, dass Sie mich und unser Unternehmen als absolut vertrauenswürdig akzeptieren.“
„Nun gut, aber worum geht es eigentlich?“
Er nahm einen Schluck Brandy und stopfte sich eine Pfeife. „Ich habe Sie hierher gebeten, um Ihnen die Position eines Geschäftsführers anzubieten. Es …“
„Eine Tätigkeit als was?“
„Als Geschäftsführer einer hier ansässigen Firma. Es geht um die ‚Antiquity and Modern Art Service Ltd.‘, kurz AMAS, mit Sitz in Mdina. D…“
„Verstehe ich richtig, dass es sich um eine Kunstfirma handelt? Ich bin Kammerjäger, auch noch Landwirt, aber kein Kunstfuzzi …“
„Nun, junger Freund. Ich darf Sie doch so nennen?“
„Sie können Ivo zu mir sagen, das bin ich gewöhnt.“
„Okay, dann Ivo. Lassen Sie mich bitte erklären. Die genauen Umstände erfahren Sie morgen in der Kanzlei Vogelt. Ich bin der wirtschaftliche Berater der Firma und beauftragt, Sie über die Sie erwartende Situation zu informieren. Ich habe mit Absicht diese Lokalität gewählt, um das Ambiente etwas lockerer zu gestalten. Es ist ein Unternehmen, das sich mit der Sichtung, der Begutachtung, dem Transport sowie dem Schutz von Kunstgut aller Art befasst.“
„Was heißt ‚aller Art’?“ Ivo brauchte jetzt einen Schluck Whisky und zündete sich eine Zigarette an.
„Aller Art heißt: Dokumente, seltene wertvolle Bücher, Grabfunde und wenn nötig Pyramiden und Paläste. Aber auch Gemälde und Artefakte aller Epochen bis heute.“
Ivo verstand die Welt nicht mehr. Er war hierher gereist, um die Leitung einer Kunstfirma zu übernehmen?! Was sollte das? Warum ein solcher Aufwand und wieso ausgerechnet er? Er sah sich außerstande, einen klaren Gedanken zu fassen. Ivo nippte an seinem Glas und versuchte, das Gehörte in geordnete Bahnen zu bringen.“
Und auch den Leserinnen und Lesern dürfte es anfangs nicht ganz leicht fallen, hinter die Geheimnisse dieser Firma und der Insel zu kommen, auf der sie ansässig ist. Und erst allmählich begreift man auch den eigentlichen Sinn des veränderten Titel dieses spannenden Malta-Thrillers – „Erbe ohne Todesfall“? Eben.
Viel Vergnügen bei diesem literarischen Besuch auf Malta, dem vielleicht bei dem einen oder anderen, bei der einen oder anderen vielleicht sogar – wenn es denn wieder möglich ist – ein ganz realer Malta-Besuch folgt.
Und bleiben Sie weiter gesund und munter und vorsichtig und bis demnächst.
EDITION digital war vor 26 Jahren ursprünglich als Verlag für elektronische Publikationen gegründet worden. Inzwischen gibt der Verlag Krimis, historische Romane, Fantasy, Zeitzeugenberichte und Sachbücher (NVA-, DDR-Geschichte) sowie Kinderbücher gedruckt und als E-Book heraus. Ein weiterer Schwerpunkt sind Grafiken und Beschreibungen von historischen Handwerks- und Berufszeichen sowie Belletristik und Sachbücher über Mecklenburg-Vorpommern. Bücher ehemaliger DDR-Autoren werden als E-Book neu aufgelegt. Insgesamt umfasst das Verlagsangebot, das unter www.edition-digital.de nachzulesen ist, mehr als 1.000 Titel. E-Books sind barrierefrei und Bücher werden klimaneutral gedruckt.
EDITION digital Pekrul & Sohn GbR
Alte Dorfstraße 2 b
19065 Pinnow
Telefon: +49 (3860) 505788
Telefax: +49 (3860) 505789
http://www.edition-digital.de
Verlagsleiterin
Telefon: +49 (3860) 505788
Fax: +49 (3860) 505789
E-Mail: editiondigital@arcor.de
![]()