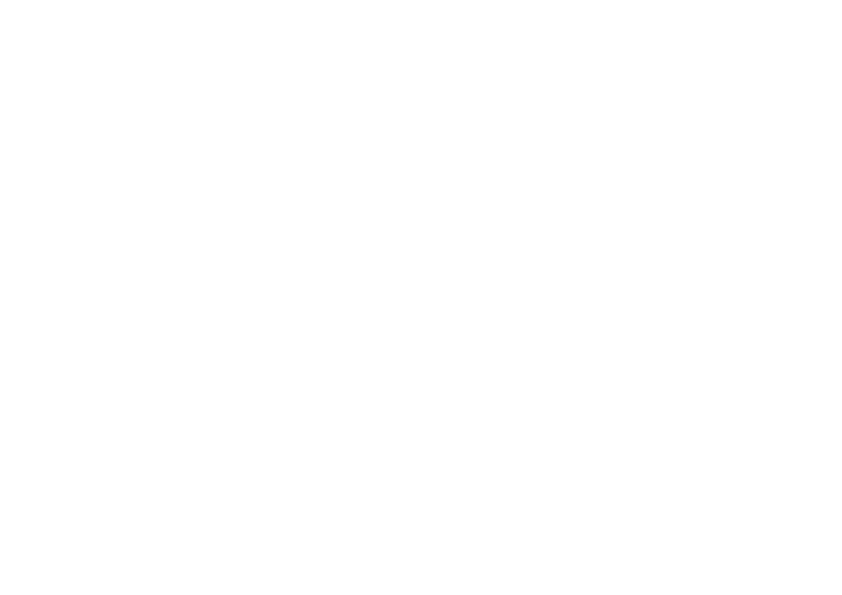Und auch über sein eigenes spannendes Leben berichtet Hans Bentzien, der zwischendurch immerhin auch mal Kulturminister der DDR und zu Wendezeiten Generalintendant des DDR-Fernsehens war, in seinem autobiografischen Band „Meine Sekretäre und ich“, wobei mit dem wortspielerischen Titel hohe Funktionäre der damals führenden Partei gemeint sind.
Mit dieser Partei hatte es auch der Autor des zweiten der heutigen Sonderausgaben zu tun, wie er in seinen Memoiren berichtet. Die Rede ist von dem Weimarer Schriftsteller Wolfgang Held und seinem spannenden Lebensbericht „Ich erinnere mich“.
Auf ein besonderes Stück Militärgeschichte der DDR und die richtige topographische Orientierung macht Dietrich Biewald in seinem Band „Episoden aus dem Leben der Pioniere“ aufmerksam. Und der Mann weiß gut Bescheid, war er doch selber viele Jahre lang ein Pionier.
Und damit sind wir wieder beim aktuellen Beitrag der Rubrik Fridays for Future angelangt. Jede Woche wird an dieser Stelle jeweils ein Buch vorgestellt, das im weitesten Sinne mit den Themen Klima, Umwelt und Frieden zu tun hat – also mit den ganz großen Themen der Erde und dieser Zeit. Und da hat die Literatur schon immer ein gewichtiges Wort mitzureden und heute erst recht. Das heutige Thema ist wiederum die in die Zukunft verpflanzte literarische Diskussion, in der die Menschheit offenbar eine Katastrophe überstanden hat. Aber wie war es dazu gekommen? Und hätte man sie verhindern können? Und wie lebt es sich überhaupt in dieser Zeit der Zukunft? Zumindest die ersten beiden Fragen sind in die Gegenwart gewendet höchst aktuell: Steuert die Menschheit tatsächlich auf eine Katastrophe zu? Und wie lässt sich das noch verhindern? Wie spät ist es eigentlich? Fünf vor zwölf? Oder möglicherweise sogar schon später? Und was dann?
Ab 1989 veröffentlichte Alexander Kröger im Verlag KRÖGER-Vertrieb Cottbus und im Projekte-Verlag Cornelius Halle die Science-Fiction-Romane „Das zweite Leben“, „Der erste Versuch“, „Nimmerwiederkehr“ und „Die Telesaltmission“, die unter dem Titel „Apokalypse – Das zweite Leben“ in einem E-Book zusammengefasst wurden. Sieben Menschen sind zu unterschiedlichen Zeiten in Anabiose versetzt worden und gleichzeitig unter rätselhaften Umständen in einem verrotteten Bergwerk erwacht. Eigene Lebenserfahrungen aus mehreren Jahrhunderten lassen sie eine begrenzte Überlebenschance nutzen; die Ausgänge aber sind verschüttet. Auf der scheinbar aussichtslosen, gefährlichen und entbehrungsreichen Suche nach Rettung entdecken sie unheimliche und unheilvolle Spuren menschlichen Wirkens. Klone unter ihnen – mit welchem Auftrag? Nach Verrat in den eigenen Reihen wird fraglich: Finden sie zurück in eine menschliche Gesellschaft – und wenn: Was erwartet sie in ihr? Im Hintergrund der spannenden Handlung des Science-Fiction-Romans aus dem Jahre 1998 skizziert Alexander Kröger ein Zukunftsbild der Menschheit. Wir erleben Helen zunächst kurz nach dem Aufwachen und mit einem besonderen Gefühl:
„Mit dem Hungergefühl kam Ärger in Helen auf. Zunächst versetzte sie das Magenknurren in eine Art frohe Zuversicht. „Der Körper ist intakt“, glaubte sie daraus schließen zu können. Aber der Drang nach Essbarem wollte befriedigt werden. „Warum, zum Teufel, kommt keiner und holt mich hier raus! Ich habe es satt!“ Helen hatte den Satz laut gerufen und gleichzeitig den Notknopf um das nächste Intervall weitergedreht.
Langsam wurde es hell um sie herum. In ihrer unmittelbaren Nähe knirschte etwas, und im zunehmenden Dämmerlicht nahm Helen wahr, dass sich plötzlich der gewölbte Deckel ihres Behältnisses nach der linken Seite wie schwerfällig hinwegklappte. „Also, eingesperrt bin ich nicht mehr“, dachte sie erleichtert.
Es blieb düster. Helen drehte, so gut es der ihr übergestülpte Helm zuließ, den Kopf. In etwa je einem Meter Abstand links und rechts von ihrem Lager gewahrte sie die Geräte und Armaturen, die autark den Schlafprozess eingeleitet hatten, aufrecht hielten und überwachten sowie für das Erwecken verantwortlich sein sollten. Helen wusste, dass sie sich in einer schmalen, von der Außenwelt hermetisch abgeriegelten Kammer befand.
Sie zog den Kopf aus der Haube, richtete sich auf. Ein kleiner Schwindel erfasste sie. Im Unterleib verspürte sie einen leichten Druck. Ah – der Nährschlauch! Sie löste ihn aus dem Anus. Dann setzte sie die Füße auf den Boden, stand und musste sich an dem Trogtresen festhalten. Die Beine versagten ihr den Dienst. Aber die Schwäche hielt nicht lange an. Unsicher machte sie kleine Schritte, und nach wenigen Minuten fühlte sie sich beinahe normal. Auch der Hunger meldete sich wieder.
Helen schaltete die Deckenleuchte ein. Das grelle Licht blendete. Sie sah sich im Raum um: Nichts Auffälliges, scheinbar nichts Verändertes gegenüber dem, was sie kannte. „Wie lange habe ich …?“
Erst in diesem Augenblick wurde sich die Frau des Ungeheuerlichen, das mit ihr geschehen sein sollte, bewusst. Spannung bemächtigte sich ihrer und – abermals Furcht. „Wie wird sie aussehen, diese Welt, wie werde ich wohl in ihr zurechtkommen?
Ach, Scharlatanerie! Zwei, drei Tage, vielleicht eine Woche war ich weg. Gleich werden sie auftauchen, lächeln, sich entschuldigen und beim Versuchskaninchen bedanken. Und immerhin, etwas hat ja wohl funktioniert …“
Aber es tauchte niemand auf, der das alles tat, auch nicht, als Helen noch minutenlang in der kleinen Kammer um die aufgeklappte Schalenliege herumgelaufen war, immer wieder verharrt und gelauscht hatte.
Sie wurde sich bewusst, dass sie nackt war. Zum Bekleiden fand sich nichts. „Was soll‘s!“ Aber sie begann zu frösteln, obwohl das Thermometer 25 Grad anzeigte und ihr Körper mittlerweile völlig trocken war.
Schon zweimal hatte sie während ihres Herumwanderns an der schweren Tür haltgemacht, die Hand an die Riegel gelegt. Aber immer wieder hatte sie sich gesagt: „Sie werden kommen. Irgendwo ist ein Signal, dass ich wach bin! Und wer weiß, was passiert, wenn ich die Hermetik störe.
Das Telefon!“
Helen nahm den Hörer ans Ohr. Außer dem Eigenrauschen – nichts.
Sie verfolgte mit dem Blick die Schnur. Die mündete in der Dose, war also an ein Netz angeschlossen. Dann begann sie die Unterbrechertaste zu betätigen, immer heftiger – ohne jeden Erfolg. Sie wählte sinnlos Nummern, immer wieder – der Apparat blieb tot.
Bei diesem Tun war Helen ins Schwitzen geraten, nicht vor körperlicher Anstrengung. Panische Angst jagte sie in eine Hitzewelle.
Da hieb sie den Hörer auf die Gabel, war mit wenigen Schritten an der Tür, fetzte an den schweren Griffen, und mit Mühe, ein lautes saugendes Geräusch verursachend, ließ sich das Blatt schwerfällig nach innen drehen.
Überrascht, die Hände noch an den Riegeln, verharrte Helen. Der Lichtschein, der aus ihrer Kammer drang, erhellte die der Tür gegenüberliegende Wand eines Korridors, nein, eines Ganges oder, nach Freund Jans Fachterminologie noch richtiger: den Stoß eines bergmännischen Hohlraums, einer Strecke. „Bin ich gar in einem Bergwerk?““ Und damit zu den ausführlicheren Vorstellungen der anderen vier Sonderangebote dieses Newsletters.
Erstmals 2014 gab Ulrich Völkel (Lektorat: Katja Völkel) Eckhaus Verlag Rogge Weimar „Ich erinnere mich. Aufzeichnungen, Reisen und Tagebücher“ von Wolfgang Held heraus: Der Autor des international erfolgreichen Films und des danach entstandenen Romans „Einer trage des anderen Last“ erzählt aus seinem Leben, über Freunde und Kollegen, von seinen Reisen, und er zitiert Passagen aus seinen Tagebüchern. „Ich erinnere mich“ ist Wolfgang Helds beeindruckende Schilderung seines reichen literarischen Schaffens ebenso wie das überzeugende Bekenntnis seines politischen Lebens. Wolfgang Held zählte zu den wichtigsten Szenaristen der DEFA und des DDR-Fernsehens. Seine Romane, Kinderbücher und Abenteuergeschichten erfreuen sich nach wie vor eines ungebrochenen Leserinteresses. „Ich erinnere mich“ ist ein Buch zur Zeitgeschichte und ein anregendes Lesebuch zugleich. Hier der Anfang des Buches und die Erinnerung an eine sehr frühe Erfahrung und an ein lebenslanges Lieblingswort:
„AUS MEINEM LEBEN
ERSTE LEKTION FÜR „WÖLFCHEN“
Das gehört zu meinen Kindheitserinnerungen. Damals lernte ich ein Wort lieben, mit dem ich durch Jahrzehnte zuweilen Erwachsene bis ins ärgerlichste Lautwerden hochsticheln konnte. Und es gab, nebenbei gesagt, manche merkwürdige Reaktion. Ich denke da an einen cholerischen Partei-Instrukteur, dem meine wiederholte Frage nach seiner vierten Antwort das Blut ins Gesicht und ein zur Eile zwingender Harndrang zur nächstgelegenen Entlastungsmöglichkeit trieb.
Als Dreikäsehoch wurde ich einmal wöchentlich an der Hand oder auf den Schultern meines arbeitslosen Vaters zu einem gelben Haus am Rollplatz in Weimar mitgenommen. Dort gab es das Stempelgeld. Spärliche Lebensrettung für Arbeitslose. Anfang 1933 muss das gewesen sein. Seitdem weiß ich, dass mit dem Namen „Schlange“ nicht nur dünne Kriechtiere, sondern auch viele hintereinander stehende, wartende Leute gemeint sind. Wie damals, als es um wenige Mark und Groschen ging, blieben diese Art von Schlangen auch später, wenn es um eine Schüssel Erbsensuppe ging am nationalsozialistischen Eintopfsonntag, um vier Bananen oder Salatgurken aus dem DDR-Konsum, um einen Räucheraal oder gar 500 Gramm Spargel aus dem Exquisit, auch „Ulbrichts Wucherbude“ genannt, aber kulturell auch in Dresden beim Schlangestehen für Karten für die Semperoper. Nicht zu vergessen die Riesenschlangen im Juli 1990 an den Sparkassen wegen des Umtausches der DDR-Mark in D-Mark West oder das Betteln um hundert Westmark Begrüßungsgeld, und nun bis in die jüngere Zeit Schlangen in den Korridoren der Sozial- oder Arbeitsämter. Aber es geht ja hier um mein bereits als Knirps auf Lebzeiten eingeprägtes Lieblingswort. Hier sei es preisgegeben. Es lautet schlicht und kurz: Warum. Immer mit angehängtem Fragezeichen? Wenn ich meine Mutter oder die Oma damit nervte, hieß es: Lass mich in Ruhe mit! Frag deinen Vater oder Onkel Rudi!
Und von meinem Vater, dem ständig mit seiner Partei hadernden und bis tief ins Herz treuen Sozialdemokraten, weiß ich, dass ich ihm keine Ruhe gegeben habe mit einem ganz bestimmten Warum. Wie kommt es, dass es reiche und arme Leute gibt? Weshalb muss ein fleißiger, kluger und ehrlicher Mensch oft mit wenigen Groschen zufrieden sein, während ein anderer gänzlich ohne tagtägliche Schinderei noch Zeit und Geld hat für Wein und Braten mitten in der Woche, ein Auto, Wohnung mit Zimmer für jedes Kind, ein eigenes Bad, Garten und Schwimmbecken? Ich habe gefragt und gefragt und gefragt. Wenn mein Vater dann wütend wurde, weil ich zu jeder seiner Antworten ein neues Warum hatte, dann schickte er mich zu Rudi, seinen jüngsten Bruder. Der war Kommunist. Ich trug noch keinen Schulranzen, da gefielen mir seine Antworten schon besser als die meines Vaters. Alles bleibt, wie es ist, belehrte Rudi mich. Jedenfalls solange es keine im ganzen Land für alle Menschen gültige Gerechtigkeit gibt. Eine Ordnung, in der alles, was von Menschen für Menschen geschaffen wird, nach Leistung verteilt wird. Aber diese Gerechtigkeit fällt nicht vom Himmel. Und sie wird fern bleiben, solange nicht alle einfachen Leute bis zur letzten Antwort nach dem Warum fragen. Sagte Rudi. Dafür haben ihn dann die Nazis ins Konzentrationslager Buchenwald gebracht.
Irgendwann einmal hat mir ein pädagogisch gebildeter Mann erklärt, dass die nervende Fragerei mit dem Warum allen Kindern eigen ist. Weshalb mit zunehmendem Alter des Menschen das Fragewort Warum immer seltener beharrlich bis zur letzten Antwort gebraucht wird, konnte oder wollte der kluge Mensch auch nicht erklären. Mir fiel nur auf, dass er an diesem Punkt auffällig verlegen wurde und kein weiteres Warum erlaubte.
In meinem Wortschatz bleibt dieses Warum freilich bis heute oft genutzt und für das Erkenntnisvermögen von lebenswichtiger Bedeutung.
Erstmals 2016 veröffentlichte EDITION digital als Eigenproduktion „Episoden aus dem Leben der Pioniere“ von Dietrich Biewald mit Grafiken und Fotos des Autors: Die Episoden, erst lange Zeit nach ihrem Auftreten aus der Erinnerung ausgegraben und darum nicht als umfassende Tatsachenberichte zu verstehen, sollen daran erinnern, dass bei aller Härte des Dienstes in der NVA und dem Stolz auf das Erreichte der Humor nicht zu kurz kam. Sie sind insbesondere denen gewidmet, die darin angesprochen wurden. Nicht jeder konnte alles beherrschen. Missverständnisse, Unkenntnisse, kleine Schwächen u. a. m. schufen öfter mal Situationen, die zwar nicht zur Normalität des Dienstes gehörten, aber eben menschlich waren. Höhere Dienstgrade waren davon nicht ausgenommen. Mit manchen Dingen mochte man sich auch nicht so recht anfreunden oder gerne vertraut machen. Manches war auch der Entwicklung in der Armee geschuldet. Man sollte ja nicht vergessen, dass in so einen riesigen Organismus regelmäßig in großem Umfang Soldaten kamen, die keine Ahnung von ihren militärischen Aufgaben hatten, aber nach kürzester Zeit ihren Mann in einer Tag und Nacht einsatzbereiten Armee zum Schutz des Landes stehen mussten. Auch damals sehr ernst genommene Dinge können nun in der fernen Erinnerung zum Schmunzeln verleiten. Satirische Zeichnungen des Autors vervollständigen diese Sammlung, die folgendermaßen beginnt:
„Ponton kant – um!
Dienst bei den Pionieren bedeutete schon immer in erster Linie viel, oft genug auch schwer zu arbeiten.
Deshalb wiegt auch der Stolz auf erreichte Leistungen so schwer.
Natürlich war bei weitem nicht alles eitel Sonnenschein, jedoch zum Lachen gab es immer mal etwas und selbst Dinge, die damals nicht dazu gehörten, können uns heute in der fernen Erinnerung an das einstige Geschehen doch noch zum Schmunzeln verleiten.
Die nachfolgenden Episoden, erst lange Zeit nach ihrem Auftreten aus der Erinnerung ausgegraben und darum nicht als umfassende Tatsachenberichte zu verstehen, sollen daran erinnern.
Sie sind insbesondere denen gewidmet, die darin angesprochen wurden.
Es ist meinerseits ein erster Versuch, der sich mit der Hoffnung verbindet, dass weitere „ältere und jüngere“ Pioniere sich mit ihren Erinnerungen zu Wort melden.
Ponton kant – um!
Dietrich Biewald
Topografische Orientierung
Norden
Der Pionier wohlan,
geht stets voran,
weiß wo er steht,
und wo ’s hingeht.
In der Natur hilft ihm dabei die topografische Orientierung, nach Himmelsrichtung, eigenem Standpunkt und Rundumorientierung.
Für die Haupthimmelsrichtung möchte ich nachfolgend eine kleine Hilfestellung geben.
Als Bewohner der nördlichen Halbkugel dieser Erde ist das für uns der NORDEN!
Denn stimmt die Richtung,
erreichst du dein Ziel!
Pioniere – hört mal her,
sprach vor der Front der Kommandeur.
Wisst ihr denn wo Norden ist?
Wenn’s nicht so ist, ist’s großer Mist!
Wie wollt ihr denn die Brücken schlagen?
Wie soll man wohl den Feind verjagen,
baut ihr vielleicht das Brückenband,
den Fluss entlang, im Ufersand,
sprengt dann womöglich eig’ne Brücken,
kein Stellungsbau wird nun mehr glücken,
legt Sperren euch selbst unbekannt,
in’s Nirgendwo vom Hinterland.
Ich sagte schon, ’s ist großer Mist,
wenn keiner weiß, wo Norden ist!
Wenn mal der Spieß, vorn seine Truppe,
versorgen soll mit Brot und Suppe,
und kennt die Richtung Norden nicht,
erfüllt er wahrlich keine Pflicht.
Kommt da kein Nachschub, wird es schließlich,
für die es trifft, gar sehr verdrießlich!
Der Pionier, ohne Verpflegung,
kommt nie und nimmer in Bewegung,
denn ohne Mampf,
fehlt ihm der Dampf.
So sieht man also ganz schnell ein,
mit Norden kommt Bewegung rein,
in Spieß, in Brot und in die Suppe,
beim Pionier und seiner Truppe.
Ich sagte schon, ’s ist großer Mist,
wenn keiner weiß, wo Norden ist!
Also, sprach der Kommandeur:
schaut nun gefälligst zu mir her,
ich will euch jetzt zur Richtung raten,
für alle eure großen Taten,
denn wer nicht kennt die Richtung Norden,
bewegt sich nur wie wilde Horden,
kann nie den richt’gen Kurs erkennen
und wird sich j. w. d. verrennen.
Ich sagte schon, ’s ist großer Mist,
wenn keiner weiß, wo Norden ist!
So wies er nun die Richtung an,
die man auf Karten finden kann.
Er sprach, den Finger hoch erhoben:
der Norden, der – ist immer oben,
wenn einer auf die Karte blickt,
es sei, die Karte ist geknickt
und Nord kein Pionier versteht,
hat man die Karte umgedreht,
erringt kein Sieg, erreicht kein Ziel,
was keiner von uns haben will.
Ich sagte schon, ’s ist großer Mist,
wenn keiner weiß, wo Norden ist!
Beim Kompass kannst du Norden seh’n,
willst du in diese Richtung geh’n,
Der Kompass hilft dir ohnegleichen,
des Nordens Richtung zu erreichen.
Du kannst die Richtung sehr gut messen,
nur manchmal kannst du sie vergessen,
hältst du ihn denn an Stahl und Eisen,
wird er Dir nicht den Norden weisen.
Ich sagte schon, ’s ist großer Mist,
wenn keiner weiß, wo Norden ist!
D’rum standen sie an einer Lichtung,
um zu erfahr’n des Nordens Richtung.
Der Chef sprach langsam: nun habt acht,
den Norden gibt’s auch in der Nacht,
denn nächtens wird am Himmel fern,
Nord angezeigt, vom Po-lar-stern.
Jedoch es war kein Stern zu seh’n,
um dann danach, nach Nord zu geh’n.
denn nur der Sonne heller Schein,
vom Himmel strahlte, ganz allein.
Ich sagte schon, ’s ist großer Mist,
wenn keiner weiß, wo Norden ist!
So sprach er nun die Sonne an,
wo man auch Norden sehen kann,
hat man ’ne Uhr, die richtig geht,
bald Norden bei den Zeigern steht.
Gerade wollt’ er’s demonstrieren,
da tat sich nun die Sonne zieren,
verkroch sich in der Wolkenwand,
wo sie dann bald auch ganz verschwand.
Ich sagte schon, ’s ist großer Mist,
wenn keiner weiß, wo Norden ist!
Nun ließ der Petrus Donner grollen,
das Land mit Wasser überrollen,
ließ Blitze zucken, Wolken jagen,
nur einer schien nicht zu verzagen:
Der Chef sprach ohne Unterlass,
im Regen stehend, pudelnass.
Spät sein Entschluss, sich auszuruh’n,
das Weit’re sollt’ sein „Adju“ tun.
Ich sagte schon, ’s ist großer Mist,
wenn keiner weiß, wo Norden ist!
Nun forderte der Adjutant:
wer hat ’ne Karte bei der Hand
und wessen Kompass zeigt die Richtung?
Der melde sich, tret’ auf die Lichtung!
Nicht einer rührt sich, der das will.
Die Ruhe wirkt verdächtig still.
Ganz plötzlich konnte man entdecken,
dass alle wollten sich verstecken.
Schweigend stand die ganze Wand,
kein Kompass, Karte, nichts zur Hand.
Die hatten sie, wohl nach dem Essen,
als unbedeutend ganz vergessen.
Ich sagte schon, ’s ist großer Mist,
wenn keiner weiß, wo Norden ist!
Das Wetter dreht, der Regen geht
und Wolken hat der Wind verweht.
Die Pioniere klamm, drum ohne Wonne,
erwarten erst die Kraft der Sonne.
Noch rinnt aus ihrer Kluft das Nass,
nach Nord zu seh’n bringt wenig Spaß.
Erst wenn sie wieder warm und trocken,
kann sie auch diese Richtung locken.
Ich sagte schon, ’s ist großer Mist,
wenn keiner weiß, wo Norden ist!
Der Chef erscheint nun ausgeruht,
und macht, was er sonst immer tut,
ergreift das Wort und schwingt ’s gewichtig,
denn was er sagt ist schließlich richtig.
Er meint, dass allen klar geworden,
wo nun befindet sich der Norden.
Und darum spricht der Kommandeur:
hört Pioniere nochmals her.
Ich denk’, ihr habt herausgefunden,
wir sind dem Norden sehr verbunden
und haltet ihr ihn auch in Ehren,
wird er euch Richtung nicht verwehren.
Und denkt daran, ’s ist großer Mist,
wenn keiner weiß, wo Norden ist!
Die Richtung habt ihr nun vernommen.
Dann kann auch der Blick auf die folgenden Seiten gerichtet werden, um einiges aus dem Leben der Pioniere wieder zu finden aus der Zeit, in der sich die Pioniertruppen der NVA entwickelten, bis sie mit der DDR ihre Existenz beendeten.“
Erstmals 1995 veröffentlichte Hans Bentzien im Verlag Neues Leben Berlin „Meine Sekretäre und ich“: Hans Bentzien ist auf verschiedene Weise mit den führenden Sekretären der SED auf seinem Lebensweg zusammengetroffen, von einer rührenden Begegnung mit Wilhelm Pieck bis in die jüngste Gegenwart. Sein Schicksal wird von allen Sekretären direkt oder indirekt berührt, sogar bestimmt; und er war selbst Sekretär in voller Funktion. Der Autor kennt sich also aus und ist befugt, seine Geschichte mit der des Landes zu verknüpfen. Bekanntes wird sachkundig erörtert, Unbekanntes hervorgebracht. Ein Menschenschicksal, Zeitgeschichte, Geschichte und Geschichten. Vorangestellt sind Geheimdokumente über die Vorgänge um den Film „Geschlossene Gesellschaft“, in die der Autor verstrickt war. Und daraus jetzt ein aufschlussreicher Auszug:
„Originaldokumente zu dem Film „Geschlossene Gesellschaft“
Am Beispiel um die Vorgänge des Fernsehfilms „Geschlossene Gesellschaft“, über die ich in diesem Buch berichte, ist es für den Leser aufschlussreich, wie der allgegenwärtige Geheimdienst nach dem Brief des Vorsitzenden des Fernsehens der DDR, Heinz Adameck, der nach einer Vorführung des Rohschnittes Anfang September 1979 an Joachim Herrmann, Sekretär des ZK der SED, geschrieben wurde, eine Untersuchung einleitete.
IM Lorenz und IM Ruth waren Angestellte des Fernsehens aus dem Bereich, die am Ende der Dokumentation erwähnte, nicht namentlich genannte „inoffizielle Quelle“ ist ein Mitunterzeichner des gegen die Ausbürgerung Biermanns gerichteten Papiers. Er besaß (und besitzt) das Vertrauen vieler Künstler, die seine kreative Mitarbeit sehr schätzten, genauso wie das Ministerium für Staatssicherheit.
Ich habe dem Verlag die Vollmacht für die Veröffentlichung erteilt. In den vom Original übernommenen Texten wurden keine Korrekturen vorgenommen.
Hans Bentzien
15.9.78
Werter Genosse Herrmann!
Nach der Voraufführung der Rohfassung des Fernsehfilms „Geschlossene Gesellschaft“ habe ich veranlasst, dass die Endfertigung nicht freigegeben wird, weil darin die gesellschaftlichen Verhältnisse in der DDR grob entstellt werden.
In einer Geschichte voller Aggressionen und Brutalitäten wird der Eindruck suggeriert, dass unsere Gesellschaft zwar wachsenden Wohlstand produziert, menschliches, familiäres Glück aber angeblich nicht gedeihen kann. Die Konflikte einer Ehe werden zurückgeführt auf die angeblich ständig steigende Hektik unseres Landes, auf die Isoliertheit des einzelnen Menschen, der mit seinen Problemen immer weniger fertig wird – und dies unabhängig von der Gesellschaftsordnung.
Autor des Filmes ist Klaus Poche, Regie führt Frank Beyer, die Hauptrollen spielen Armin Müller-Stahl und Jutta Hoffmann, Dramaturgen sind Eva und Heinz Nahke.
Die Bestätigung des Drehbuches erfolgte durch Genossen Hans Bentzien (Stellvertreter für Dramatische Kunst). Seine Begründung zur Aufnahme dieses Films in den Spielplan dramatischer Fernsehwerke und die mehrmalige Information während der Dreharbeiten, dass es sich um eine zwar zugespitzte, aber normale Ehegeschichte handele, entsprach nicht den Tatsachen.
Ich habe entschieden, dass dieser Film im DDR-Fernsehen nicht gesendet wird. Die begonnene Auseinandersetzung mit Genossen Bentzien und im Schöpferkollektiv des Films wird von uns zu Ende geführt.
Da es möglich ist, dass diese Angelegenheit von Klaus Poche oder Frank Beyer in die öffentliche Auseinandersetzung hineingebracht wird, halte ich es für notwendig, Dich zu informieren.
Mit sozialistischem Gruß
- Adameck
Hauptabteilung XX Berlin, 6. 10. 1978
Information
Durch den IM „Ruth“ wurde zur Situation im Bereich Dramatische Kunst im Fernsehen der DDR folgendes erarbeitet:
Im ersten Halbjahr 1978 erfolgte die Produktion des Filmes „Geschlossene Gesellschaft“. Autor: Klaus Poche, Regisseur: Frank Beyer, Hauptdarsteller: Jutta Hoffmann und Armin Müller-Stahl.
Bei den genannten Personen handelte es sich um Unterzeichner einer gegen die Ausbürgerung Biermanns gerichtete sogenannte Protesterklärung.
Am 28. 7. 1978 wurde im DDR-Fernsehen die Rohfassung des Filmes „Geschlossene Gesellschaft“ vorgeführt. Daran nahmen neben dem Autor Klaus Poche und Regisseur Frank Beyer der Vorsitzende des Fernsehens der DDR, Heinz Adameck, der stellv. Leiter Abt. Agitation beim ZK der SED, Eberhard Fensch und der Parteisekretär des Fernsehens der DDR, Hans Schäfer, teil.
Laut Einschätzung der Leitung des Fernsehens der DDR ist der vorliegende Film gegen die gesellschaftlichen Verhältnisse der DDR gerichtet und kann aufgrund seiner politisch-ideologischen Mängel im DDR-Fernsehen nicht gezeigt werden. Dem IM wurde bekannt, dass vor der Einschätzung der Leitung des Fernsehens der DDR Hans Bentzien sich gegenüber den Schöpfern zu dem Film bekannte und ihn als gut bezeichnete. Dieses ist auch aus der Einschätzung, die Bentzien am 2. 8. 1978 erarbeitet hat, ersichtlich. Bentzien ist darin bemüht, die negativen Seiten des Filmes abzuschwächen und bezeichnet ihn als ein humanistisches Werk mit einigen Übertreibungen.
Schon während der Entstehung des Filmes, wo im Szenarium einige Mängel und falsche Verhaltensweisen ersichtlich wurden, hat Bentzien darauf Einfluss genommen, um gewisse Veränderungen durch die Schöpfer des Filmes zu erreichen. Bentzien hat auch die Bereichsleitung über den Vorgang nicht informiert, sondern im Stillschweigen gehalten. Bentzien hat den IM ebenfalls nicht informiert.
Der Kameramann Strobel, Hartwig machte nach der Durcharbeitung des Szenariums den Regisseur Frank Beyer auf einige Szenen aufmerksam, die politisch-ideologisch falsch sind. Beyer erklärte, dass der Film zur Produktion freigeben ist und von der Leitung gebilligt wurde.
Aufgrund der politischen Fehleinschätzung des Bentzien zu dem Film fand mit ihm durch den Leiter der Abt. Agitation beim ZK der SED, Heinz Geggel, den Vorsitzenden der Fernsehens der DDR, Heinz Adameck, und den Parteisekretär des Fernsehens der DDR, Hanns Schäfer, eine Aussprache statt. Bentzien wurde seine falsche politisch- ideologische Führungslinie aufgezeigt und nachgewiesen. Dieses betrifft jedoch nicht nur den Film „Geschlossene Gesellschaft“. Bentzien bezeichnet auch bei dieser Aussprache den Film als ein humanistisches Werk, der eine Ehegeschichte zeigt, wo der Entfremdungsprozess, der sich auch im Sozialismus zeigt, widerspiegelt wird.
Am 5.10. 1978 wurde durch die Zentrale Parteileitung im Fernsehen der DDR nochmals mit Bentzien gesprochen. Bei dieser Beratung bezeichnete er den Film „Geschlossene Gesellschaft“ als nicht sendefähig.
Durch das falsche politische Verhalten des Bentzien, in dem er Beyer nach der ersten Vorführung seine Zustimmung zu dem Film gegeben hat und ihn jetzt als nicht sendefähig bezeichnet, ist Beyer deutlich gemacht worden, dass die staatliche Leitung und die Partei den Film als nicht sendefähig bezeichnet. Bentzien erscheint also nach wie vor als der Mann, der eigentlich als Verbündeter von Poche und Beyer betrachtet werden kann, aber als Leiter an Weisungen gebunden ist. Er versucht nicht, die Schöpfer heranzuführen, er vertieft die Spaltung zwischen der Partei und ihnen.
In einem internen Gespräch sagte Bentzien zur Quelle, dass der Film „Geschlossene Gesellschaft“ unsere Gesellschaft ist.
Der IM schätzt ein, dass Bentzien vor allem solche Autoren fördert, die ihm diese „kaputte Welt“ zeigen.
Bentzien hat bekannte Autoren wie Helmut Sakowski, Benito Wogatzki, Karl-Georg Egel, die bislang die Fernsehkunst bestimmt haben und zu dem positiven Kern der Schriftsteller gehören, die Verträge gekündigt, um sie zu „zwingen“, intensiver zu arbeiten und in kürzeren Zeitabständen produktionsreifere Stücke abzuliefern. Mit solchen Festlegungen kann man nach Meinung des IM keine tiefgründigeren Kunstwerke schaffen.
Die Quelle schätzt ein, dass Bentzien einige politische Unklarheiten besitzt. Er hat Zweifel an der Einheit unserer Wirtschafts- und Sozialpolitik. Er unterstützt Autoren, die ebenfalls solche Ansichten haben.
Hauptabteilung XX Berlin, 9. 10. 1978
Information
über Hans Bentzien, stellvertretender Vorsitzender des Komitees für Fernsehen der DDR und Leiter des Bereiches Dramatische Kunst.
Inoffiziell wurden im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung um den Fernsehfilm „Geschlossene Gesellschaft“ folgende Aktivitäten und Verhaltensweisen des Bentzien bekannt:
Auf Veranlassung von Bentzien erfolgte im ersten Halbjahr 1978 die Produktion dieses Filmes, dessen Schöpfer und Hauptdarsteller die operativ bekannten Beyer, Frank – Regisseur, Poche, Klaus – Autor, Hoffmann, Jutta – Schauspielerin, Müller-Stahl, Armin – Schauspieler sind.
Der jetzt vorliegende Film ist laut Einschätzung der Leitung des DDR-Fernsehens gegen die gesellschaftlichen Verhältnisse der DDR gerichtet und deshalb nicht sendefähig.
Während der Produktion hat Bentzien die inhaltlichen Probleme dieses Projektes vor den Mitgliedern des Komitees für Fernsehen und dem Leitungskollektiv des Bereiches Dramatische Kunst vorsätzlich verschwiegen.
Bedenken, die der Kameramann Hartwig Strobel zu politisch-ideologisch falschen Aussagen des Drehbuches gegenüber Frank Beyer äußerte, wurden unter Berufung auf die Entscheidung von Bentzien zurückgewiesen.
Am 28.7. 1978 wurde von Beyer im DDR-Fernsehen eine Vorführung der Rohfassung des Filmes „Geschlossene Gesellschaft“ organisiert. Daran nahmen u.a. Genosse Heinz Adameck – Vorsitzender des Komitees für Fernsehen der DDR, Genosse Eberhard Fensch – stellvertretender Leiter der Abt. Agitation beim ZK der SED, Hans Bentzien und die Schöpfer des Filmes teil.
Unmittelbar nach dieser Vorführung bekannte sich Bentzien im internen Gespräch gegenüber Beyer und Poche zur vorliegenden Fassung des Filmes und erklärte, dass er sich entsprechend seiner Funktion für die Aufführung des Filmes ausgesprochen hat.
Trotz der erfolgten Kritik durch die Genossen Adameck und Fensch sowie der erteilten Weisung an Bentzien, notwendige wesentliche Veränderungen am Film zu veranlassen, bezeichnete Bentzien in einer Beratung am 29. 7. 1978 mit den Filmschöpfern diesen Film als „ein humanistisches Anliegen, in dem lediglich einige Übertreibungen enthalten seien“.
In dieser Beratung forderte Frank Beyer ultimativ die Aufführung des Filmes und zeigte zunächst keine Bereitschaft zur Änderung.
Nachdem Bentzien nur geringfügige Änderungen vorgeschlagen hatte, die sich lediglich auf die Szene bezogen, in der eine Frau von Kindern mit roter Farbe besudelt wurde, bat Frank Beyer um Bedenkzeit.
Bentzien beauftragte Eva Nahke, Dramaturgin, entsprechende Veränderungen am Drehbuch vorzunehmen, obwohl ihm bekannt war, dass Eva und Heinz Nahke, Dramaturg, in der politisch-ideologischen Bewertung des Filmes mit Beyer und Poche völlig übereinstimmten.
Nach der Aussprache mit Bentzien im ZK der SED fand am 5.10. 1978 eine Beratung der Zentralen Parteileitung im DDR-Fernsehen statt, in der Bentzien offensichtlich unter dem Eindruck der ihm nachgewiesenen politisch schädlichen Leitungsmethoden erstmalig den Film „Geschlossene Gesellschaft“ als nicht sendefähig bezeichnete.
Ebenfalls auf Veranlassung von Bentzien und mit Zustimmung von Jürgen Faschina, Chefdramaturg, wurde ein zweiter Filmstoff von Poche unter dem Titel „Sonderbare Tage“ in den Plan 1978 aufgenommen. Die inhaltlichen Probleme und Aktivitäten dieses Vorhabens wurden von Bentzien gleichfalls verschwiegen. Die Mitglieder des Komitees für Fernsehen wurden erst darauf aufmerksam, als von Faschina für Poche eine Reise nach Westberlin zur Materialsammlung für diesen Film beantragt wurde.
Dieses Vorhaben mit seiner gesellschaftsschädigenden Aussage konnte deshalb noch rechtzeitig verhindert werden. Poche jedoch hatte Kenntnis davon, dass dieser Film, durch die Leitung des DDR-Fernsehens bestätigt, Bestandteil des Planes 1978 war.
Inoffiziell wurde eingeschätzt, dass Bentzien durch sein Verhalten eine politische Situation geschaffen hat, die die oppositionellen Kräfte wie Poche, Beyer u.a. in ihrer Haltung bestärkt, anstatt sie für eine gesellschaftlich nützliche Tätigkeit zu gewinnen.
Beyer, Poche u.a., die nur darauf warten, dass ihre Filme angegriffen werden, haben durch Bentzien Fakten in die Hand bekommen, die den progressiven Kräften eine Auseinandersetzung mit ihnen fast unmöglich machen.
Laut inoffizieller Einschätzung wurde durch das Verhalten Bentziens vor und während der Auseinandersetzung mit ihm sichtbar, dass er durch seine Selbstherrlichkeit und Spontanität in seinen Entscheidungen das Prinzip des demokratischen Zentralismus ständig verletzt. Er führt Entscheidungen aus, ohne sie im Leitungskollektiv zu beraten und den Mitgliedern des Komitees vorzuschlagen.
Das Wesen der von Bentzien „nicht erkannten oder absichtlich verfolgten“ politisch schädigenden Linie besteht laut internen Hinweisen darin, dass Bentzien Zweifel an der Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik unserer Partei hat, solche Autoren fördert, die diese Zweifel auch haben und deren dem Sozialismus fremde Kunst als „objektive Widerspiegelung unserer gesellschaftlichen Realität“ verteidigt, progressive Autoren wie Helmut Sakowski, Benito Wogatzki und Karl-Georg Egel unter dem Vorwand Verträge kündigt, „sie zu zwingen, intensiver zu arbeiten“ und ständig versucht, zu testen, wieweit er gehen kann in der „Kritik an der Gesellschaft im Sozialismus“.
Nach vorliegenden internen Hinweisen ist nach den Auseinandersetzungen mit Bentzien für den Bereich Dramatische Kunst im DDR-Fernsehen eine komplizierte Situation entstanden. Progressive Kräfte befürchten, dass Bentzien „entweder ein sehr labiler Leiter wird oder einer, der nach allen Seiten um sich schlägt“, um sich zu beweisen.
Aus intern bekannt gewordenen Äußerungen des Kameramannes Strobel geht hervor, dass die Personen um Poche und Beyer, die den Fernsehfilm „Geschlossene Gesellschaft“ verteidigen, eine „nicht zu unterschätzende Konzentration darstellen und jetzt des Öfteren zusammentreffen“. Zu Einzelheiten hat sich Strobel nicht geäußert.“
Ein Jahr später, erstmals 1996, veröffentlichte Hans Bentzien im Westkreuz-Verlag Berlin/Bonn „Meine Amsel singt in Tamsel. Märkische Miniaturen“: Das Buch ist bekannten und weniger bekannten Persönlichkeiten gewidmet, deren Leben die Geschichte Brandenburgs und seine Bewohner mitgeprägt haben. Der Leser lernt Carl August von Hardenberg, Johann Friedrich Adolf von der Marwitz, Sophie Charlotte, Königin von Preußen und andere geschichtsträchtige Persönlichkeiten näher kennen. Aber auch zu Unrecht vergessene Menschen, wie den Fleischermeister Cassel aus Potsdam, den Erfinder des so gern gegessenen Kasslers, ruft Hans Bentzien wieder ins Gedächtnis. Zum Einlesen hier die titelgebende Miniatur:
„Meine Amsel singt in Tamsel
Eigentlich wollte ich mich wieder aus dem Stau stehlen, der sich an der Grenzübergangsstelle Kietz/Küstrin gebildet hatte. Die Karawane wälzte sich im Schritttempo über die Straße, die Oderbrücken, durch zwei Zollkontrollen an der alten Festung vorbei — zum Markt und zu den Tankstellen auf der Jagd nach dem Schnäppchen. Diese Tortur dauerte fast zwei Stunden, doch mein Ziel war nicht der Basar, sondern ein Schloss, fünf Kilometer von Küstrin entfernt. Tamsel, heute Dragowicze.
Nachdem der Kronprinz Friedrich den Schock, den er bei der Hinrichtung seines Freundes Katte im Jahre 1730 erlitt, überwunden hatte, begann er das saure Brot der Kameralistik zu kauen, er musste die Verwaltung der Domänen erlernen, denn von ihnen lebte der Hof hauptsächlich. Die Lehrer kamen aus Küstrin, die Praktika absolvierte er auf dem Amte Wollup im Oderbruch, aber besonders gern ritt er die wenigen Minuten nach Tamsel. Dabei mag er auf die trockene Luft in der Küstriner Kriegs- und Domänenkammer gepfiffen haben. Vergessen der Unterricht über die Aufsetzung von Pachtverträgen, die Erhebung von Steuern und Zöllen, die Führung von landwirtschaftlichen Betrieben bis zum Ausmisten der Ställe, vergessen die Verbote, Bücher zu lesen, selbst die über Festungsbau und Mathematik nicht. In der Satteltasche liegen die vielen Verse, die er nur so aus sich herausschreibt, wohl an die hundert Stück an einem Nachmittag.
„Meine Amsel singt in Tamsel … “ Wer soll das sein? Was den 19-jährigen Auskultator so beflügelt, ist die Aussicht, seine Ergüsse der schönen Frau Louise Eleonore von Wreech zu überreichen, der Herrin auf Tamsel. Nicht alle preisen schwärmerisch die Schönheit der Frau, manche geben sich auch bewusst geistreich, nähern sich auf Umwegen dem Ziel: „Madame, die Heuschreckenschwärme, die diese Gegend verwüsten, waren bisher immer so rücksichtsvoll, Ihre Landgüter zu verschonen. Eine Unzahl von Insekten, garstiger und gefährlicher als die eben genannten, werden sich zu Ihnen begeben, Madame. Man heißt sie Verse: sie besitzen vier Füße, scharfe Zähne und einen langgestreckten Körper, ein gewisser Rhythmus ist ihr Grundprinzip und flößt ihnen Leben ein. Gestatten, Sie Madame, dass ich mit Widmung dieser Zeilen Ihnen diese Wahrheit mitteile. Seitdem ich Sie gesehen, treibt es mich hin und her. Sie sind ein Gegenstand, der dessen sehr würdig ist …“
Dieses Objekt der Begierde war die sehr würdige, gemeint ist wohl liebenswürdige, damals im Jahre 1731 24-jährige Frau von Wreech, als Mutter von fünf Kindern zwar nun fünf Jahre älter, daher bereits viel reifer als der Heißsporn Friedrich. Sie nahm seine Oden geschmeichelt an, erwiderte sie auch wohl auf gleiche Weise und ermutigte ihn wiederzukommen, was er sehr wohl tat. Ihr Mann kannte dieses nicht völlig geklärte Verhältnis, sie selbst unterrichtete ihn davon. Im Klatsch, der zu allen Zeiten blüht, hielt sich das Gerücht, ein 1733 geborener Junge, der ohne Namen im Kirchenbuch eingetragen ist, sei von Friedrich. Als der Landesherr davon erfuhr, soll er gesagt haben, wenigstens das könne der weichliche Sohn fertigbringen. Nun sei ihm um den Familiennachwuchs nicht bange. Aber nicht nur in dieser Beziehung täuschte sich der Soldatenkönig in seinem Sohn.
Das Schloss hat eine lange Geschichte, die bis ins 14. Jahrhundert reicht. Sein heutiger Zustand ist erbärmlich. Man findet nur noch wenige Zeugnisse aus seiner Glanzzeit, aber man erkennt eine weitläufige Gutsanlage mit großräumigen Stallungen, einem weitläufigen Gutspark und einer Dorfkirche. Sieht man nach Süden, erblickt man die Rauch’sche Victoria, die traurig mit einem Arm und von Gewehrkugeln durchbohrt dasteht.
Schloss Tamsel ist durch Gemeindebibliothek und Wohnungen genutzt. Das bauliche Ensemble ist als typisch für Preußen immer noch interessant. Direkt an der Hauptstraße gelegen.“
Vielleicht wäre es eine gute Idee, sich selbst einmal – zumindest dann, wenn es wieder möglich ist – ein Bild von diesem Schloss zu machen und zuvor noch einmal in der Biografie von Friedrich dem Großen nachzulesen. Oder eben auch gleich zweimal bei Hans Bentzien und in den anderen Sonderangeboten dieses Newsletters. Verdienst haben es jedenfalls alle.
Viel Spaß beim Lesen, Entdecken und vielleicht auch beim Reisen. weiter einen schönen Herbst, bleiben Sie weiter gesund und vorsichtig und bis demnächst.
Ach, eins vielleicht noch: Obwohl das Verhältnis zwischen Friedrich und der tatsächlich sehr schönen, klugen und gebildeten Louise Eleonore von Wreech damals selbstverständlich keusch geblieben sein dürfte, gilt diese Beziehung heute noch als einzige große Liebe Friedrichs. Später kam er nie wieder nach Tamsel, reagierte gar abweisend, als Frau von Wreech ihn um Unterstützung bei der Beseitigung der Schäden bat, die russische Soldaten im Zuge der Schlacht von Zorndorf angerichtet hatten. Dafür kam sein Bruder Prinz Heinrich oft von Rheinsberg hierher. Aber das ist schon wieder eine andere Geschichte, eine ganz andere Geschichte …
Andere Quellen sagen übrigens, dass Friedrich sehr wohl geholfen habe, die russischen Schäden beseitigen zu lassen.
Und das inzwischen nur zu einem Viertel sanierte Schloss in Dąbroszyn steht übrigens zum Verkauf.
EDITION digital war vor 26 Jahren ursprünglich als Verlag für elektronische Publikationen gegründet worden. Inzwischen gibt der Verlag Krimis, historische Romane, Fantasy, Zeitzeugenberichte und Sachbücher (NVA-, DDR-Geschichte) sowie Kinderbücher gedruckt und als E-Book heraus. Ein weiterer Schwerpunkt sind Grafiken und Beschreibungen von historischen Handwerks- und Berufszeichen sowie Belletristik und Sachbücher über Mecklenburg-Vorpommern. Bücher ehemaliger DDR-Autoren werden als E-Book neu aufgelegt. Insgesamt umfasst das Verlagsangebot, das unter www.edition-digital.de nachzulesen ist, mehr als 1.000 Titel. Alle Bücher werden klimaneutral gedruckt.
EDITION digital Pekrul & Sohn GbR
Alte Dorfstraße 2 b
19065 Pinnow
Telefon: +49 (3860) 505788
Telefax: +49 (3860) 505789
http://www.edition-digital.de
Verlagsleiterin
Telefon: +49 (3860) 505788
Fax: +49 (3860) 505789
E-Mail: editiondigital@arcor.de
![]()