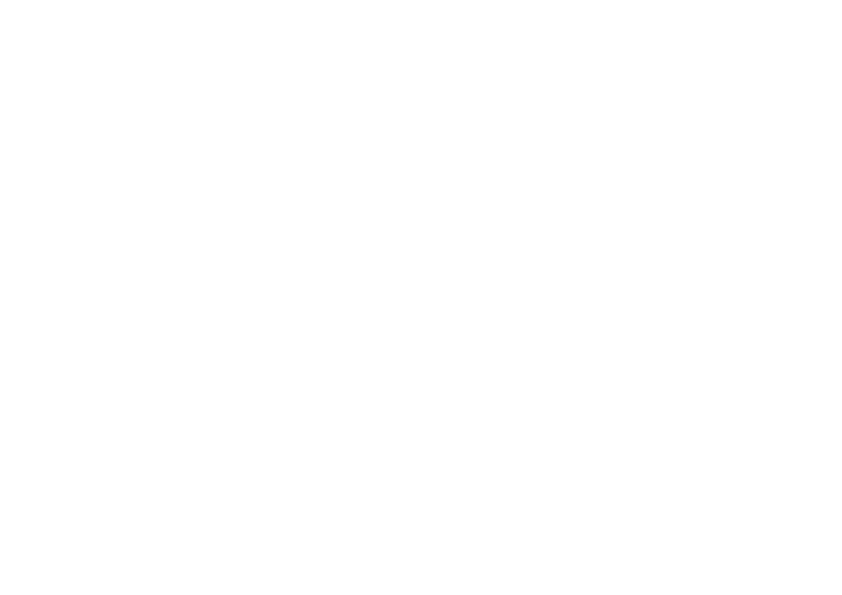Um eine große Jugendliebe geht es in „Zwei im Kreis“ von Heinz Kruschel:
„Raumsprünge, das kleinere Weltall und andere fantastische Erzählungen“ lautet der Titel des Buches von Karsten Kruschel.
Einen ebenso wichtigen wie schwierigen Thema widmet sich Dörte Joost mit „Das trauernde Kind. Aktuelles Basiswissen und konkrete Hilfestellung im Rahmen der Kinderbetreuung“.
Und damit sind wir wieder beim aktuellen Beitrag der Rubrik Fridays for Future angelangt. Jede Woche wird an dieser Stelle jeweils ein Buch vorgestellt, das im weitesten Sinne mit den Themen Klima, Umwelt und Frieden zu tun hat – also mit den ganz großen Themen der Erde und dieser Zeit. Und da hat die Literatur schon immer ein gewichtiges Wort mitzureden und heute erst recht. In dem heute vorgestellten Buch, das nach einem gleichnamigen, zur Zeit seines Entstehens stark diskutierten Films geschrieben wurde, geht es um eine weder einfach zu definierende, noch einfach zu realisierende Haltung – Toleranz.
Und gerade in den aktuellen politischen Auseinandersetzungen, in der nicht selten Populisten aller Couleur lautstark und nicht selten auch gewaltsam die Meinungsherrschaft übernehmen wollen, sind ein paar grundsätzliche Fragen immer wieder neu zu stellen und zu beantworten – was genau bedeutet eigentlich Toleranz? Und wie sieht sie praktisch aus? Wie weit darf Toleranz gehen? Und wo hat auch die Toleranz ihre Grenzen? Und wer bestimmt diese Grenzen? Möglicherweise kann die erstmalige oder auch erneute Lektüre des heute vorgestellten Buches zum Nachdenken und zum Nachmachen anregen. Und was würde wohl Chefarzt Doktor Stülpmann heute sagen? Und auf welcher Seite würde der Mediziner heute stehen? Das scheint ein spannendes Gedankenexperiment …
Erstmals 2002 veröffentlichte Wolfgang Held im quartus-Verlag Bucha „Einer trage des anderen Last. Roman nach dem Film“: Dieses Buch erzählt von der ungewöhnlichen Begegnung zweier junger Menschen in der gerade ein Jahr alten DDR, zu unbedeutend für die historischen Annalen und doch eng verflochten mit dem Geschehen jener bewegten Jahre. Die bittere Einsicht von Schuld, der Mangel am Notwendigsten in dem zerschundenen Land, das alles löschte damals den Willen zum Leben nicht aus. Ein Volkspolizist und ein evangelischer Vikar müssen, todkrank und mit völlig verschiedener Weltanschauung, über mehrere Monate ein Zimmer in einem Tbc-Heim teilen. Humorvoll und mit großer Dramatik schildert Wolfgang Held, wie beide schließlich zu gegenseitiger Achtung und Toleranz finden. Als der später auf der Berlinale ausgezeichnete Film „Einer trage des anderen Last“ Anfang 1988 in die Kinos kam, fand er in der DDR ein Millionenpublikum. Er wurde in Ost und West als ein Plädoyer für Toleranz verstanden. Nach seinem Drehbuch hat Wolfgang Held 1995 den gleichnamigen Roman geschrieben. Hier ein Auszug aus dem 10. Kapitel, in dem der Chefarzt den beiden Kampfhähnen die Leviten liest:
„Das hochspannungs- und strahlungssichere Gerät im Röntgenraum des Sanatoriums stammt aus dem Jahr 1937. Doktor Stülpmann beherrscht es virtuos. Ruhig, sicher und konzentriert wie ein geübter Jäger sucht er mit dem Durchleuchtungsschirm die Lunge des Patienten nach den lebensbedrohenden Fraßplätzen der Tuberkulosebazillen ab. Eine Bleiglasscheibe, Schutzbrille, bleigefütterte Handschuhe und eine schwere Schürze sollen ihn vor den gefährlichen Strahlen bewahren. Der Raum ist abgedunkelt. Aus dem Hochspannungserzeuger im geerdeten Metallschrank klingt dumpfes Summen. In einer Zimmerecke steht die hochbeinige Liege für die Patienten, denen ein Pneu angelegt oder aufgefüllt werden soll. Jetzt ist die dazu dienende Apparatur unter einem Laken verborgen. Daneben ist Hubertus Koschenz beim Ankleiden. Er hat die Prozedur hinter sich. Das von Röntgenstrahlen gezeichnete, fluoreszierende Schattenbild auf dem Sichtschirm erlaubt jetzt den Blick in Josef Heiligers Brustkorb, macht die Rippen erkennbar, das rhythmisch zuckende Herz, die zerlöcherte Lunge. Bei ihm dauert das Durchleuchten länger. Seine Haut wird feucht, obwohl es kühl im Raum ist. Kalter Schweiß rinnt aus seinen Achselhöhlen. Erleichtert atmet et auf, als der Chefarzt endlich das Gerät abschaltet und sich von der zurückgeschobenen, fahrbaren Schutzkanzel erhebt.
„Fertig! Sie können sich auch wieder anziehen!“
Doktor Stülpmann schiebt seine dunkle Schutzbrille auf die Stirn. Er zieht die Handschuhe aus und lässt am Fenster das Verdunklungsrollo hochrasseln. Die Bleischürze legt er noch nicht ab. Über den Vorfall in aller Frühe hat er bisher noch kein Wort verloren. Nun erst wendet er sich den beiden jungen Männern zu. Seine Stimme klingt ruhig, zu ruhig freilich, um dahinter nicht schon aufziehendes Donnerwetter ahnen zu lassen.
„Sie haben offenbar noch nicht ganz begriffen, wo Sie sich hier befinden .meine Herren „Und, warum Sie sich hier befinden! Das ist nämlich kein Spaß, was Sie da in der Brust haben – das ist der Tod im Galopp!“
Die beiden morgendlichen Ruhestörer stehen nebeneinander. Josef Heiliger kriecht in sein Hemd. Hubertus Koschenz fingert noch an seinen Knöpfen. Doktor Stülpmann tritt an die beiden heran. Seine Worte werden scharf und zwingend. „Es ist das Omega Ihrer kurzen Jahre, wenn Sie nicht ab sofort verdammt viel Geduld, Vernunft und dazu noch eine gehörige Portion Glück haben. Ich verlange von Ihnen ein Optimum an Reife! An Takt! Und an Toleranz!“
Josef Heiliger rafft sich zu einem Einwand auf.
„Aber nicht in einem Zimmer!“
Auch Hubertus Koschenz ist dieser Meinung. Er will nicht, dass es so aussieht, als wünschte nur sein Mitbewohner die Trennung.
„Ich glaube auch, dass es für uns beide besser wäre …“
Josef Heiliger wirft dem Vikar einen dankbaren Blick zu, bevor er sich wieder an den Doktor wendet.
„Zwischen uns sind Welten, Herr Chefarzt! Antagonistische Widersprüche!“
Das Fremdwort und dessen Bedeutung hatte er im marxistischen Zirkel gelernt. Es geht ihm leicht von der Zunge, denn er benutzt es bei jeder passenden und manchmal auch unpassenden Gelegenheit. Immer jedenfalls, wenn sich von ihm zwei verschiedene Dinge absolut nicht unter einen Hut bringen lassen wollen.
Hubertus Koschenz spricht besonnen und mit gemessenem Nachdruck aus, was ihr dringender, gemeinsamer Wunsch ist. „Legen Sie uns auseinander, Herr Doktor … Bitte!“
„Bitte!“, pflichtet ihm Josef Heiliger ebenso eindringlich bei.
Einen Augenblick schaut Doktor Stülpmann die beiden jungen Patienten nachdenklich an. Er muss sich zwischen therapeutischer Logik und den aus seiner Sicht höherwertigeren, geheiligten Prinzipien humanitärer Ethik entscheiden. Ihm ist klar, dass er allein vom ärztlichen Standpunkt aus ein Risiko eingeht, wenn er jetzt der Pädagogik den Vorzug gegenüber der Medizin gibt, dennoch tut er es.
„Draußen im Leben können Sie auch keinen Bogen umeinander machen. Sie müssen miteinander auskommen, meine Herren. Und wenn Sie das nicht können, dann taugt Ihr Sozialismus, Herr Heiliger, genauso wenig wie Ihr Christentum, Herr Koschenz! Wir leben nämlich auf einer Erde … Und wenn zwei junge, intelligente Männer mit unterschiedlichen Weltanschauungen nicht einmal um den Preis der Gesundheit, um den Preis ihres eigenen Lebens sogar, für ein paar Monate in einem Haus und einem Zimmer friedlich miteinander auskommen können, dann sieht es, verdammt noch mal, beschissen aus um die Menschheit! … Ja, was ist denn?“ Unwillig reagiert der Chefarzt auf das Klopfen an der Innentür. Oberschwester Walburga tritt ein. Sie bringt eine Mappe. Den beiden morgendlichen Sängern gönnt sie keinen Blick. „Die Schichtergebnisse von Fräulein Sonja, Herr Chefarzt!“ Doktor Stülpmann öffnet die Mappe. Er überfliegt den Bericht, dem einige Röntgenbilder beigefügt sind. Was er liest, macht ihn offensichtlich so betroffen, dass er darüber für einen Moment die Anwesenheit der beiden jungen Männer vergisst. Erst, als Josef Heiliger ihn mit einem leisen Räuspern an die noch ausstehende Entscheidung erinnert, hebt er den Kopf. „Sie bleiben in einem Zimmer … Ab!“
Verlegen und stumm gehen die beiden zur Tür. Josef Heiliger greift nach der Klinke, lässt jedoch, mit einer höflichen Geste, dem Vikar an der Innentür den Vortritt. Hubertus Koschenz erwidert das Entgegenkommen an der Außentür, wo er nun zuvorkommend erst seinem Begleiter den Schritt über die Schwelle gewährt.“ Und damit zu den ausführlicheren Vorstellungen der anderen vier Sonderangebote dieses Newsletters.
Erstmals 2006 veröffentlichte Lutz Dettmann im Lübecker Weiland-Verlag „Tiefenkontrolle. Jugendjahre im Arbeiter- und Bauernstaat“: Klaus Levitzow, der Held des Romans „Wer die Beatles nicht kennt“ von Lutz Dettmann, ist jetzt zwanzigjährig und wird zur NVA berufen. Er begibt sich in eine fremde Welt mit eigenen Gesetzen, Ritualen und einer eigenen Sprache. Klaus ist kein Held, der gegen das System aus Befehlsgehorsam und Tageszahl kämpft. Er ist einer der Millionen von jungen Männern, die versucht haben, einigermaßen aufrecht diese Zeit zu überstehen. Er schildert eine Armeezeit, die nicht nur aus Druck und Schikane besteht, sondern in der auch die Liebe, die Kameradschaft und die Freundschaft eine wichtige Rolle spielen. Dieses Buch beschreibt einen Zeitabschnitt und eine Welt innerhalb der DDR, die nicht vergessen werden darf. Wer Leander Haußmanns NVA-Film und –Buch kennt und dessen Schenkel klopfende („Haben wir doch damals toll gesoffen und sind über den Zaun gegangen!“) Aufbereitung für unrealistisch erkannt hat, ist in diesem Buch gut aufgehoben. Es schildert die NVA authentisch, ohne dabei den menschlichen Aspekt zwischen den Soldaten auszublenden. Authentisch sind auch die Orte beschrieben, an denen das Buch spielt: Dabel (im Buch Buchholz) eine von vielen NVA-Kasernen im Norden der damaligen DDR und Schwerin, die Bezirksstadt im Nordwesten der kleinen DDR. Erleben wir mit, wie für Klaus Levitzow und seine künftigen Genossen Soldaten das Armeeleben beginnt, was ziemlich wirklichkeitsgetreu geschildert wird:
„Der Hof der Villa gleicht einem Heerlager. Jungen stehen in kleinen Gruppen herum und versuchen krampfhaft locker auszusehen. Einige Gesichter sind mir bekannt, und plötzlich fühle ich mich irgendwie leichter. Hier auf dem Hof steht eine Schicksalsgemeinschaft. Es wird gelacht. Wir begrüßen uns, auch ich benehme mich betont lustig. Wir tun so, als ob wir einen Betriebsausflug machen wollen. Nur die Mädchen fehlen, sonst könnte das Bild stimmen. Aber alles wirkt künstlich, das Lachen verkrampft, das Grinsen aufgesetzt.
Die große Flügeltür oberhalb der Freitreppe öffnet sich und ein Offizier tritt heraus. Er wird nicht beachtet. Wir erzählen weiter, lachen, und plötzlich donnert der Offizier los.
„Kippen aus! Sagen Sie einmal, was denken Sie, wo Sie sind?“
„Na nicht im Sandkasten!“, ertönt es aus einer hinteren Gruppe, und der Offizier explodiert fast. Die Hände in die Seiten gestützt, tobt er los, und nun erfolgt kein Zwischenruf mehr.
„Na also, es geht doch“, stellt er zufrieden fest. Dann erschallen Kommandos.
In drei Reihen aufgestellt, wird Name für Name vorgelesen. Es bilden sich einzelne Gruppen, die auf ihre Lkws warten, um in die Kasernen zu kommen. Betretenes Schweigen herrscht. Mich beschleicht wieder die Angst. Mein Name fällt, ich stehe mit dem Langen in einer Gruppe. Doch wir wagen keine Unterhaltung. Alle spüren: Nun wird es Ernst.
Drei meiner zukünftigen Kameraden kenne ich: Hagemann, der in meine Berufsschule ging. Ein Schleimer, der sich bei den Lehrern anbiederte, und auch jetzt keine Schwierigkeiten damit haben wird, Christian, er wohnte bis vor zwei Jahren in der Schulstraße, und den Langen. Christians Gesicht glänzt und wirkt so groß ohne seinen Seehundbart.
Auch der Lange starrt ihn an.
„Oh, Robbe, was haben sie nur mit uns gemacht? Unsere schönen Schnauzer! Wer hat sie genommen?“
Der Offizier steht noch immer oben auf der Treppe. Breitbeinig, die Hände in die Seiten gestützt, wippt er auf seinen Stiefelspitzen. Er beginnt eine Art Abschiedsrede.
„Genossen, die nächsten Monate werden für Sie schwer und ungewohnt werden. Sie sind nun von ihren Familien getrennt, werden ungewohnte körperliche Anstrengungen haben. Es wird viel von Ihnen verlangt werden. Aber denken Sie in diesen Wochen daran: Sie dienen der Deutschen Demokratischen Republik. Sie leisten ihren Beitrag, dass ihre Familien in Frieden leben und arbeiten können. Ich wünsche Ihnen für die nächsten Monate alles Gute, Genossen!“
Toll, seine Rede. Einige grinsen mitleidig. Den Schmarren haben wir doch schon hundertmal gehört. Sollen wir uns jetzt mit dieser epochalen Feststellung leichter fühlen?
Beifall hat er wohl auch nicht von uns erwartet. Er grüßt noch einmal. Dann wendet er sich an einen Soldaten, der neben ihm steht, und übergibt das Kommando.
„Taschen auf! Links um! Zu den Lkws!“ wird befohlen, und wir drehen uns wie eine Hammelherde nach links, nach rechts oder gar nicht. Das Kommando wird noch einmal wiederholt, jetzt klappt es besser. Nun bin ich also schon Genosse, kein Herr oder Kollege mehr. Ich werde mich an meine neue Anrede gewöhnen müssen.
Unten am Franzosenweg stehen vier große Ural bereit. Die Fahrer lümmeln sich an ihre Wagen und rauchen. Sie grinsen und haben schon lange vergessen, dass auch sie einmal diesen Tag vor sich hatten. Unsere Taschen fliegen auf die zugewiesenen Lkws, dann steigen wir auf. Vorne, an der Bordwand, ist noch ein Platz frei. So kann ich mich noch von der Stadt verabschieden, die ich nun Monate nicht sehen werde.“
Erstmals 1979 erschien Verlag Neues Leben Berlin „Zwei im Kreis“ von Heinz Kruschel: Habuck schafft sich eine Bleibe in einer alten Mühle, um mit seinem Mädchen Torcky zusammensein zu können. Er glaubt, ihr damit eine große Freude zu machen. Aber Torcky stellt sich Glück anders vor. Habucks Mutter versucht mit allen Mitteln, die beiden auseinanderzubringen. Verschiedener können die Elternhäuser auch nicht sein. Habucks Mutter ist Betriebsleiterin und tut alles für den einzigen Sohn. Torcky wuchs mit vielen Geschwistern in sehr beengten Wohnverhältnissen in einer Alkoholikerfamilie auf, die immer mal mit dem Gesetz in Konflikt kam. Ein einfühlsamer, überzeugender Roman über eine große Jugendliebe. Hier der Anfang der Geschichte von Habuck und Torcky. Habuck hat eine große Hoffnung und für einiges keine Erklärung:
„1. Kapitel
Vor vier Stunden war die Welt laut und bunt und sehr groß, nun ist sie still, grau und eng. Das kann sich so schnell ändern.
Habuck findet dafür keine Erklärung, dabei ist er bekannt und berüchtigt dafür, dass er immer alles erklären kann. Aber solchen Ereignissen, die er nicht vorhersehen kann, steht er seit jeher hilflos gegenüber. Er kann ein Bild an den Himmel malen, aber dazu braucht er mindestens einen Himmel und Publikum. Der Himmel hatte sich bewölkt, und das Publikum hatte ihn verlassen.
Er saß auf der Luftmatratze, die immer schlaffer wurde, während das Licht der Petroleumlampe blakte und flackernde Schatten auf die holzgetäfelten Wände und gegen die eingezogene Decke warf. Jedes Brett hatte er selber verdeckt angenagelt, das harzige Holz roch noch. Und die Narzissen dufteten, die in einem tönernen Einlegetopf mitten im Zimmer standen.
Nun döste er vor sich hin. Vor vier Stunden hatte er seine Prüfung abgelegt, hatte Löcher bohren und Fragen beantworten müssen nach der Mächtigkeit des Salzes, hatte erklären müssen, warum er in diesem besonderen Falle den Kranz um das große Sprengloch enger legte, hatte das Bohrschema verteidigt und gemerkt, dass einige aus der Kommission ihn reinlegen wollten. Das ist doch der Junge, der aufgemuckt hat und der alles besser weiß, dem wollen wir mal auf die Finger sehen, noch grün hinter den Ohren und dann schon eine dicke Lippe riskieren. Er hatte damit gerechnet und ließ sich nicht hereinlegen. Otto Sauerbrei und Venzke waren dabei, das hatte ihm Mut gemacht. Und er hatte sich gefreut auf die Stunden nach der Prüfung, auf den Abend, auf die Nacht, die er hier mit Torcky hatte verbringen wollen. Diese Nacht und überhaupt alle Nächte.
Nun wusste er nicht, warum sie weggelaufen war. Er wusste nicht, wohin sie gelaufen war und ob er sie überhaupt suchen sollte. Und ob sie überhaupt gesucht werden wollte.
Habuck konnte sich das nicht erklären. Dabei hatte er den Abend vorbereitet und geplant, an alles hatte er gedacht, sogar seine Truppe hatte er überzeugt: Heute kommt ihr nicht, wir holen den Einstand nach, außerdem bin ich ganz bar, ich habe nur noch einen Zehnmarkschein für Benzin, ich will mit ihr allein sein, das versteht ihr doch.
An den Himmel hatte er den Abend und die Nacht gemalt. Kein Heimleiter würde mehr den Ausweis verlangen und seine Bestrafung fordern. Keine Mutter würde mehr horchen.
Er hatte heimlich, wochenlang, diese Bodenkammer ausgebaut zu einer kleinen Wohnung, und heute, am Tage seiner praktischen Prüfung, hatte er Torcky und sich diese eigene Wohnung, einen großen Raum und eine Miniküche, schenken wollen. Unsere Wohnung, Torcky, nun begreifst du endlich, warum ich seit Weihnachten so wenig Zeit für dich hatte. Eine Wohnung, zwar über dem Stallgebäude, aber getäfelt und gedielt. Bald werden Möbel darin stehen. Von Frau Zacharias bekomme ich den eichenen Tisch, der unten im Sägewerk steht und dessen Platte ich noch glatt hobeln muss, und sogar einen Bauernschrank, dessen Türen ich reparieren und bemalen werde. Wir kaufen uns kein Bett, sondern eine Liege, eine schöne breite Liege.
Junge Leute, die heiraten, bekommen Kredit, und wenn sie Kinder kriegen, schmilzt der Kredit weg, da der Staat froh über das Anwachsen der Bevölkerung ist. Und wir wollen doch heiraten.
Natürlich fehlt noch viel. In der Küche steht nur ein elektrischer Kocher auf einer Eimerbank, das Wasser muss aus der Waschküche die steile Treppe hochgetragen werden, aber dafür macht sich das Regal im Zimmer gut mit meinen Büchern. Es sind vierhundertdreiundzwanzig Stück, unter ihnen ein Schock utopische Werke und zwanzig dicke Sagenbücher, von Wieland dem Schmied bis Prometheus.
Mit dem Prometheus hatte es angefangen, mit einer Rede, die der Schüler Hans Buck, bester Absolvent seines Jahrgangs, vor den zehnten Klassen, vor den Lehrern und den Eltern gehalten hatte. Prometheus heißt: der Vorausdenkende.
Habuck hatte vorausgedacht, als er dieses Zimmer ausbaute. Er hatte es ausgebaut, weil seine Eltern das Mädchen Torcky ablehnten. Ihm war nicht klar, wieso dieses Vorausdenken das Gegenteil von der erwarteten Überraschung bewirken konnte.
Nun dachte er nicht mehr voraus. Im Ofen knackten Buchenscheite. Draußen schrie der bunte Hahn trotz Regen und Dunkelheit nach seiner liebsten Henne. Irgendwo baffte ein Fensterladen. Habuck wischte sich den Schweiß von der Stirn. Er hatte sich sogar die Sätze überlegt, die er einer überraschten, erfreuten, glücklichen Torcky sagen wollte: Hier werden wir wohnen. Ich will dich heiraten. Ich möchte, dass wir bald ein Kind haben. Bis zum Schacht sind es zwölf Kilometer. Sind wir in derselben Schicht, fahren wir zusammen. Mit meinem schnellen Hirsch sind wir in einer Viertelstunde da, den Weg über die Schwarze Brücke, wo immer noch unermüdliche Angler versuchen, in dem verseuchten Wasser müde kranke Fische zu fangen. Mit der Fähre dauert es länger. Aber wenn wir Zeit haben, im Juli, wenn die Sonne prallt, dann benutzen wir die Fähre über die Elbe. Sollten wir nicht in derselben Schicht sein, nimmst du einfach mein Fahrrad mit Anbaumotor, der alte Hackenwärmer tuckert noch. Frau Zacharias hat gesagt, sie macht Feuer im Ofen. Den hat Sauerbrei persönlich gesetzt, der hält für ein ganzes Leben. Es wird warm sein, wenn wir nach Hause kommen. Du wirst dich umziehen, ich werde dich küssen, und du wirst sagen: Ich möchte mich lieber ausziehen, mir ist so zumute. Und wenn es im Sommer so schön abendhaft ist, sitzen wir draußen, laden uns Freunde ein, essen die Pilze, die wir im Walde gefunden haben, wir feiern ganz tolle Feten. Ich hab dir gleich angesehen, wie du dich freust. Ich kenne dich so genau, dass ich mir deine Reaktionen im Voraus ausdenken kann. Ich freue mich, weil du dich so freust. Zieh das nasse Zeug aus, häng es in unsere Küche. Wenn du einen Brief schreibst, vergiss nicht die neue Anschrift: Hinter der alten Mühle eins. Eine Nummer zwei gibt es hier draußen gar nicht. Wir trinken jetzt nicht, vorher möchtest du nicht. Es soll nie wieder die Angst zwischen Tür und Angel stehen, die Angst vor diesem bulligen Hausmeister mit dem geilen Blick, die Angst vor meiner Mutter, die Angst vor dem Traktoristen auf dem Feld, der durch die Zähne pfeift.
Das hatte sich Habuck alles ausgedacht und vorgesagt und an den Himmel geschrieben. Und nun war alles Spinnerei. Er fühlte sich einsam und verlassen. Auf eine solche Situation war er nicht vorbereitet. Er sah keinen Ausweg. Er ließ sich auf die Matratze fallen. Er war nicht imstande, das Richtige zu tun. Er wusste auch nicht, was das Richtige in dieser Situation war. Er war nicht imstande, überhaupt etwas zu tun. Ein anderer würde erst recht nicht helfen können. Einem Jungen ist das Mädchen davongelaufen. Das passiert alle Tage. Aber dass es ihm passieren musste. Und Torcky ist nicht irgendein Mädchen. Torcky ist das erste Mädchen in seinem Leben, und er kann sich nicht vorstellen, dass nach Torcky ein anderes Mädchen kommen könnte.
Bedecke deinen Himmel mit Wolkendunst.“
2012 veröffentlichte EDITION digital das E-Book „Raumsprünge, das kleinere Weltall und andere fantastische Erzählungen“ von Karsten Kruschel, dem Sohn von Heinz Kruschel. Zum ersten Mal werden hier die frühen Erzählungen Karsten Kruschels zusammengefasst. Neben den ersten Kurzgeschichten von 1979 sind das auch verstreut erschienene Texte aus verschiedenen Anthologien und alle Geschichten des Bandes „Das kleinere Weltall“ (1989), von denen einige später zu den preisgekrönten Romanen „Vilm“ und „Galdäa“ ausgearbeitet wurden. Hier findet der Leser aufsässige Haustiere, seltsame Theorien, kosmische Phänomene und immer wieder Menschen, die auch angesichts der überragendsten Technik nichts anderes können, als menschlich zu handeln. Und so Menschen zu bleiben.
Die Erzählung „Raumsprünge“ erschien 1985 beim Verlag Neues Leben, Berlin (Das neue Abenteuer, Heft 470). Die Erzählung „Schach mit Otto“ erschien 1985 beim Verlag Neues Leben, Berlin in: Aus dem Tagebuch einer Ameise. Wissenschaftlich-phantastische Tiergeschichten. Die Erzählung „Ein Fall von nächtlicher Lebensweise“ erschien 1990 beim Verlag Neues Leben, Berlin in: Der lange Weg zum Blauen Stern. Phantastische Geschichten. Die Erzählung „Herrliche Zeiten“ erschien 1999 beim Wilhelm Heyne Verlag GmbH & Co. KG, München in: Alexanders langes Leben, Stalins früher Tod – und andere abwegige Geschichten. Die Erzählung „Theorie der Kugelblitze“ erschien im Juni 1979 in der Zeitschrift „neues leben“. Die Erzählung „Aussage des Assistenten“ erschien im Juni 1979 ebenfalls in der Zeitschrift „neues leben“. Das Buch „Das kleinere Weltall. Science-Fiction-Erzählungen“ mit den Erzählungen „Der Brunnen“, „Großartige Party, wirklich großartig“, „Die Schuld“, „Glücklicher Lotse“, „Der Galdäische Krieg“ und „Die Garnison“ erschien 1989 beim Verlag Das Neue Berlin. Und hier der Anfang der titelgebenden „Raumsprünge“:
„Dieses große, kraftvolle Raumschiff ist ein wundervoller, atemberaubender Haufen Schrott, für den es keinen Unterschied macht, auf welche Art er zerschmettert, atomisiert oder zerschmolzen wird. An Bord ist eine gut ausgesuchte, hervorragend trainierte Mannschaft, die verrückt ist, übergeschnappt und irr. Nur ich, der ich hier in der Ecke der Zentrale zwischen Kartenraum und Klo hocke und mich nicht bewege, bin noch normal, denke klar und unerhört logisch. Manchmal muss ich kichern, wenn ich mir überlege, dass ich allein, ich ganz allein, weiß, dass ich normal bin; dass die andern das Um des Himmels willen nicht wissen dürfen, ja, nicht einmal ahnen dürfen sie es. Sie halten mich für irr. Mich!
Wenn ich nicht so still sitzen müsste, würde ich wieder ein Kichern aus mir herauslassen. Aber ich darf nichts aus mir hinaus tun, sonst riechen sie etwas – sonst kommt Mechin in seinem weißen Anzug, der Verrückte, der sich für den Schiffsarzt hält, und blickt mich an, dass ich zusammenschrumpfe unter diesem Blick. Manchmal kann ich mich nicht beherrschen, wenn er mich ansieht. Oder ein anderer. Manchmal halte ich es nicht einmal aus, wenn ich eine Kamera auf mich gerichtet fühle. Dann schießt es kalt in mein Innerstes, dann weiß ich nicht mehr zu denken noch zu atmen. Deswegen habe ich mir diese Ecke hier ausgesucht: rechts neben mir die schmale Tür zum Kartenraum, die selten benutzt wird, linker Hand die Drehtür, hinter der das Klo ist.
Gute Sicht hab ich über alles in der Zentrale, kann alles sehn, und die Kameras erfassen mich nicht. Diese Ecke ist zu unbedeutend, um ein starres Kameraauge in sie hineinleuchten zu lassen. Also, ich kann hier sitzen. Wenn einer in die Zentrale kommt, blickt er mich kurz an, ach, was heißt anblicken – streift mich mit einem kurzen Blick. Es trifft mich. Tief und wie ein Schlag ins Gesicht. Nicht hart oder so, nein, wie ein nasser Sack – oder wie eine Schaufel Lehm, die mir, schwungvoll an meinen Kopf geworfen, zäh vom Gesicht rinnt, während ich mich winde und mich selbst fast umbringe, nur um nicht zu stöhnen.
Stöhnen wäre furchtbar. Mechin würde aufmerksam werden. Die Mikrofone sind sehr empfindlich. Zu empfindlich, ich möchte den Konstrukteur erwürgen. Oder einen andern, mitunter kommt mich die Lust darauf an. Angeblickt zu werden aber…, ist das klar?
Die wirkliche Welt, die Welt, in der es all diese Irren nicht gibt, ist auch ganz in der Nähe. Wenn das Brausen in meinem Hirn beginnt und sich die Fingernägel zu heftig pulsenden Kugeln blähen und meine Augen sich wie warmer Marmor anfühlen und nur noch schwer in meinem Schädel rollen, dann weiß ich, dass ich wieder auf die Reise gehe, während irgend etwas von mir hier zurückbleibt. Und wenn ich auf der Außenhaut des Schiffes angelangt bin – schööön! -, sehe ich meine Freunde dort um einen runden Tisch sitzen. Der Fahrtwind kraust ihre Lippen, und die Sterne wühlen ihnen in den Augen. Lachend und morsend spielen sie mit goldenen Spielkarten. Ich darf mich dazusetzen und mitspielen. Hören auf den rhythmischen Gong, wenn die goldenen Platten mit den Piques und Assen auf den Tisch treffen und dort die funkelnden Kristallwölkchen aus den Ritzen emporstäuben…
Es endet immer mit dem Brausen und einem Stechen im Arm und mit zornigen oder mitleidigen Rufen und irgendwann mit Mechins ruhiger Stimme, die mich in tiefen Schlaf redet und mich immer wieder zurückbringt auf meinen Platz in der Ecke zwischen Kartenraum und Klotür.
Still sein. Keinen Blick auf sich ziehen. Die Worte vorbeiziehen lassen. Auf das Brausen warten. Auf das Pulsen in den Fingern. Sich nicht bewegen. In sich sein. Hineinhören.
Kann nichts hören. Möchte dennoch glauben, dass gleich etwas passieren könnte. Als ob etwas passieren müsste, was endlich die andern von mir ablenkt.
Doch seit das Schiff Schrott ist, obwohl sie so tun, als sei es noch ein stolzes Schiff, achtet niemand mehr auf mich. Schön.
Der Bildschirm des Computers flackert· immer wieder in jenem blauen Licht; das bedeutet Fragt-mich-doch-was-Leichteres und Ich-weiß-es-doch-auch-nicht. Oder es flackert rot, dann hetzen sie umher und schlagen auf glühende Tasten und reißen Hebel herum und starren verdutzt auf farbige Linien auf den Auswertern, die ihnen die Sinnlosigkeit ihres Tuns beweisen. Oder sie bosseln in elektronischen Eingeweiden herum, messen, bauen, reparieren. Was geht das mich an?
Hoffentlich dauert das noch sehr lange. Wieso eigentlich?
Wieso hoffentlich? Hoffen? Was ist das? Was bedeutet es…? Ein Schmerz brüllt und tötet die Fragen und lässt mich wieder ruhig auf die arbeitenden Leute in der Zentrale blicken.
Sie arbeiten, schwitzend, gebeugt über ihre Arbeit. Einige hocken mit nackten Oberkörpern – das ist verboten! – in den Eingeweiden der Maschinen, wo es heiß ist, und ich kann den Schweiß an ihnen herabrinnen sehen. Mechin geht herum und hält dem einen oder andern Pillen hin. Sie nehmen sie oder nehmen sie nicht. Sie fluchen. Auf mich? Ja, ich könnte ihnen helfen, ja, ich weiß dort Bescheid. Nein, nie wieder. Nie wieder.
Der Schmerz heult auf, ich will mitheulen, aber ich presse mich still in meine Ecke.“
Erstmals 2014 veröffentlichte EDITION digital als Eigenproduktion „Das trauernde Kind. Aktuelles Basiswissen und konkrete Hilfestellung im Rahmen der Kinderbetreuung“ von Dörte Joost. Die fachliche Begleitung leistete Frau Prof. Dr. rer. nat. Claudia Hruska von der Hochschule Neubrandenburg: Kindliche Trauer hat viele Gesichter. Damit sich die Trauer entfalten und letzten Endes selbst überwinden kann, braucht sie in starkem Maße begleitende Erwachsene und deren Verständnis und Toleranz. Da es häufig der Fall ist, dass gerade Eltern in Trauerzeiten durch die eigene Betroffenheit wenig Stütze für ihre Kinder sein können, stellen Erzieher/innen bzw. Tagesväter/mütter im Rahmen der Kinderbetreuung eine Chance für eine weitere Hilfestellung dar. Sie können verbunden mit Fachwissen um mögliche Trauerreaktionen, zu durchlaufende Traueraufgaben und Erkenntnissen der Hirnforschung zu Trauerprozessen, das den ersten Abschnitt des Buches bildet, ins tiefere Verstehen gelangen und in ihre Rolle als wichtige Begleitperson für Kinder hineinwachsen. Der zweite Teil des Buches widmet sich den begleitenden Hilfsangeboten durch pädagogische Fachkräfte, die zur Trauerbewältigung bei Kindern beitragen können. Abgerundet durch beispielhafte oder eröffnende Antworten auf Kinderfragen und eigenen Empfehlungen zu Kinderbüchern schließt das Buch mit einem motivierenden Plädoyer. Im folgenden Auszug schreibt die Autorin darüber, dass und wie Kinder anders trauern:
„Kindliche Trauer hat viele Gesichter. Damit sich die Trauer entfalten und letzten Endes selbst überwinden kann, braucht sie in starkem Maße Toleranz von den begleitenden Erwachsenen. Geduld und Nachsicht sind auch dann gefragt, wenn das kindliche Verhalten sprunghaft und widersprüchlich erscheint, was für Trauer im Kindesalter allzu typisch ist.
Allgemein betrachtet verlaufen Trauerprozesse bei Kindern – unabhängig von ihrem kognitiven Entwicklungsstand und vorhandenen Todeskonzepten – nicht so kontinuierlich ab wie bei Erwachsenen. Sie trauern gewissermaßen auf Raten. Dies hat u.a. die Folge, dass innerhalb einer Familie Kinder und Erwachsene ihren Verlust nicht gleichzeitig verarbeiten, was oft zu Konflikten führt. Sucht man ein Bild zur Veranschaulichung, so kann das Trauern bei Erwachsenen mit dem Waten durch einen Fluss verglichen werden, dessen Ufer nicht zu erkennen ist. Bei Kindern ist es eher so, dass sie in Pfützen der Trauer hinein stolpern und dann wieder weiter springen. Die Unterbrechung der Trauerzustände kann als eine Art Schutzmechanismus vor Überbeanspruchung für ihre gerade erst im Aufbau befindliche Person gewertet werden. (Ennulat, 2003)
Mit dem Blick auf trauernde Kinder können nach Gertud Ennulat fünf Verhaltensweisen unterschieden werden, die sich durchaus abwechseln können:
Das weinende Kind: Das vorherrschende Gefühl der Traurigkeit zeigt das Kind durch sein Weinen, was in Erwachsenen und Kindern meistens die Bereitschaft zum Trösten auslöst.
Das abwehrende und widerspenstige Kind: Ein innerlich irritiertes und einsames Kind erteilt seiner Umgebung eine deutliche Abfuhr. Nach einer Zeit kommt dieses Kind meist von selbst auf die Erwachsenen zu.
Das still trauernde Kind: Will ein Kind keinen (Körper-)Kontakt und verhält sich unauffällig bis perfektionistisch, benötigen die Begleiter großes Fingerspitzengefühl für die Signale des Kindes.
Das aggressive Kind: Ohnmacht und Verzweiflung kann sich bei einem trauernden Kind auch in aggressivem Verhalten äußern. Hier ist besonders darauf zu achten, dass niemand – auch das Kind selbst nicht – ernsthaft in körperliche und seelische Gefahr gerät.
Das überforderte Kind: Wenn ein Kind während der Trauer unentwegt Quatsch macht, blödelt oder cool reagiert, zeigt das Kind eine tiefe Überforderung. An dieser Stelle ist es besonders wichtig, sich des ohnmächtigen Kindes anzunehmen, anstatt es zu tadeln.
In Ergänzung zu diesen grundsätzlichen Verhaltensweisen und den bereits angeführten Trauerreaktionen soll nachfolgend auf einige ausgewählte kindliche Reaktionen eingegangen werden (Franz, 2002; Hinderer & Kroth, 2005):
Verleugnung nach einer erschütternden Todesnachricht gehört neben der Verdrängung und der Abwehr zu den selbstschützenden Überlebensprinzipien. Kinder sträuben sich in einigen Fällen, häufig durch ständige Auseinandersetzungen über Banalitäten, und wollen die alte, sichere und vertraute Welt konservieren. Äußerungen können beispielsweise sein: „Ich will aber die Süßigkeiten haben! Oma hat mir die auch immer gekauft.“ oder „Kann Papa nicht mal aufhören, tot zu sein?“
Einige Kinder sind durch den Verlust eines geliebten Menschen derart erschüttert, dass sie wie unter Schock reagieren. Sie wirken bei einem solchen Gefühlsschock benommen, teilnahmslos, starr oder unberührt. Wichtig ist, dass dieses Verhalten nicht mit Gleichgültigkeit verwechselt wird.
Ein Kind kann insbesondere in der ersten Zeit der Trauer, in der es den Verlust erst einmal annehmen muss, voll Enttäuschung sein. Es fühlt sich verlassen, vielleicht auch betrogen und im Stich gelassen. Es gibt viele Gefühle in Bezug auf diese nun nicht mehr vorhandene Beziehung. Der Tod hinterlässt demnach eine große schmerzhafte Lücke, die sich erst in einem langen Prozess schließen wird.
Wenn ein Kind durch ein sehr angepasstes, rücksichtsvolles Verhalten gegenüber seinen engsten Bezugspersonen ein „Schonprogramm“ fährt und plötzlich „auffällig unauffällig“ ist, darf nicht verkannt werden, dass es trotzdem innerlich höchst aufgebracht sein kann. Diese gegensätzlichen Gefühlswelten bergen die Gefahr der verschobenen Trauerarbeit sowie der inneren Zerrissenheit.
Beängstigend viele Kinder, insbesondere Kinder im magischen Vorschulalter, tragen Schuldgefühle gegenüber der verstorbenen Person in sich. Gründe dafür sind z.B. in Rivalitäten, vergangenen Streitigkeiten und unausgesprochenen negativen Gedanken zu suchen.
Nachdem ein Kind den Tod einer geliebten Person realisiert hat und in eine der zuvor beschriebenen „Pfützen der Trauer“ stolpert, brechen meist sehr verschiedene, zum Teil auch widersprüchlich erscheinende Gefühle hervor. Diese Gefühlsausbrüche bilden ein emotionales Chaos aus Wut, Angst, Ohnmacht, Zorn, Hass, Schmerz und Sehnsucht und sind für die Familie und Trauerbegleiter/innen schwer auszuhalten. Nichtsdestotrotz stellen sie einen gesunden Trauerprozess dar, die zu begleiten und nicht zu unterdrücken sind.
Im Gegensatz zu einem Erwachsenen, der sich durch seine Reife besser selbst reflektieren kann, fühlt sich ein Kind seinen eigenen Gefühlen schutzlos ausgeliefert. Aggressionen gegenüber dem Toten, der eigenen Person bzw. Dritten oder Zerstörungswut sind vielmals die sichtbaren Spitzen von Trauerprozessen und Zeichen von Ohnmacht.
In der Zeit der Verinnerlichung wandelt sich das kindliche Verhalten meist, indem es zu einer Idealisierung des Verstorbenen kommt. Das Kind gibt dem Toten eine überhöhte Bedeutung, die er bei Lebzeiten nicht eingenommen hatte. Es „stellt den Toten auf einen Sockel“.
Nach einer anstrengenden Zeit der aktiven Trauerbewältigung können vorübergehende Rückschritte (Regressionen) sowohl bei Erwachsenen wie auch bei Kindern auftreten. Vielfach ziehen sich Kinder in eine innere, stille Welt zurück, werden zu regelrechten „Stubenhockern“ und zeigen weder Freude an sonst geliebten Tätigkeiten noch an Tagesmutter-, Kindergarten- oder Schulbesuch. Auch Auffälligkeiten wie das nächtliche Einnässen, das bereits abgelegte Daumenlutschen oder Schnullern können reaktiviert werden oder schulische Probleme auftreten. Nicht selten kommt es vor, dass diese Kinder auf diese Weise in die Rolle des „Sorgenkindes“ schlüpfen, was einen Ruf nach Aufmerksamkeit und mehr Fürsorge darstellt.
Auch können Kinder von angstbesessenen Fantasien geplagt werden, die ihnen das Leben schwer machen. Dies tritt häufig vor allem dann ein, wenn Kinder aus Loyalität zu den wenig offenen Erwachsenen ihre Fragen unterlassen und sich nicht in neue Vorstellungsräume vortasten.
Durch den Tod eines geliebten Menschen treten bei Kindern häufig Verlassenheits- und Trennungsängste auf. Ihr Vertrauen in die Welt ist erschüttert, ihr Gefühl von Sicherheit fließt dahin. Hinzu treten häufig noch existenzielle Nöte, welche die Ängste zusätzlich vergrößern.
In Anbetracht dieser angerissenen komplexen Trauerreaktionen bei Kindern, die vielfach miteinander verknüpft sind oder sprunghaft wechseln können, heißt es abermals, sich die Notwendigkeit von kindlicher Trauer bewusst zu machen und daher eher die ressourcenorientierte „Brille aufzusetzen“. Besonders treffende Formulierungen zur kindlichen Trauer lassen sich bei Petra Hinderer und Martina Kroth finden.
Mit der Frage, warum manche Kinder und Erwachsene scheinbar sehr gut mit einem Todesfall umgehen und ihn in das eigene Leben integrieren können, während andere viele Jahre emotional und in ihrer Leistungsfähigkeit beeinträchtigt sind, beschäftigt sich derzeitig die Resilienzforschung. Am interessantesten erscheint diesbezüglich, welche Faktoren für eine gesunde Trauer ausschlaggebend sind.
Ohne die maßgeblichen Faktoren an dieser Stelle nennen zu können, dürfen wir Erwachsene darauf vertrauen, dass „aus Stolpersteinen Treppenstufen werden“, wenn Kinder durch eine entsprechende Begleitung Wachstumsprozesse mobilisieren, die es ihnen ermöglichen, Trauererfahrungen zu meistern (Ennulat, 2003). Wie die Begleitung konkret aussehen sollte, wird in Abschnitt 4 beschrieben.“
Dieses Buch bietet eine Hilfestellung für ein ebenso schwieriges wie wichtiges Thema, den Umgang mit der Trauer und weist Wege zu einer gesunden Trauer. Und zugleich regt es nachdrücklich dazu an, sich mit Erfahrungen und Erkenntnissen aus der Resilienzforschung vertraut zu machen. Denn Resilienz kann auch in weniger traurigen Lebenssituationen helfen.
Zur Lektüre empfohlen seien aber auch die anderen vier Sonderangebote dieses Newsletters, vor allem der aktuelle Beitrag „Einer trage des anderen Last“ unserer wöchentlichen Rubrik Fridays for Future, in dem es diesmal um das Nachdenken über Toleranz geht sowie der besondere Blick auf die DDR, gesehen mit den Augen eines NVA-Wehrpflichtigen: „Tiefenkontrolle“. Und was den Titel des Vorgängerbuches von Lutz Dettmann angeht, so lautet der dort zur Hälfte zitierte Spruch vollständig „Wer die Beatles nicht kennt – ist impotent!“. So jedenfalls steht es im „Tunnel“, wo sich die Jugendclique von Klaus Levitzow trifft, der jetzt bei „der Fahne“ die Tage zählt …
Viel Vergnügen beim Aussuchen und Lesen, weiter eine gute Spätsommerzeit, bleiben Sie weiter gesund und vorsichtig und bis demnächst.
EDITION digital war vor 25 Jahren ursprünglich als Verlag für elektronische Publikationen gegründet worden. Inzwischen gibt der Verlag Krimis, historische Romane, Fantasy, Zeitzeugenberichte und Sachbücher (NVA-, DDR-Geschichte) sowie Kinderbücher gedruckt und als E-Book heraus. Ein weiterer Schwerpunkt sind Grafiken und Beschreibungen von historischen Handwerks- und Berufszeichen sowie Belletristik und Sachbücher über Mecklenburg-Vorpommern. Bücher ehemaliger DDR-Autoren werden als E-Book neu aufgelegt. Insgesamt umfasst das Verlagsangebot, das unter www.edition-digital.de nachzulesen ist, mehr als 1.000 Titel. Alle Bücher werden klimaneutral gedruckt.
EDITION digital Pekrul & Sohn GbR
Alte Dorfstraße 2 b
19065 Pinnow
Telefon: +49 (3860) 505788
Telefax: +49 (3860) 505789
http://www.edition-digital.de
Verlagsleiterin
Telefon: +49 (3860) 505788
Fax: +49 (3860) 505789
E-Mail: editiondigital@arcor.de
![]()