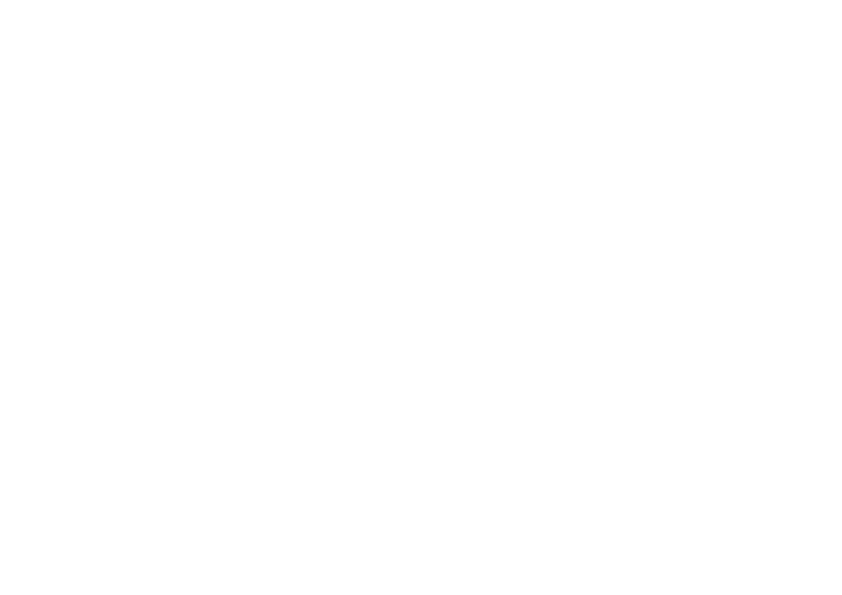Einen ganz eigenen Weg, ihre Finanzen aufzubessern, haben vier Frauen in dem Kriminalroman „Die Damengang“ von Klaus Möckel gefunden. Allerdings ist ihnen auch schon jemand auf der Spur.
Mit dem Leben, der Liebe und anderen Merkwürdigkeiten des wahrscheinlich letzten Universalgelehrten Europas, Gottfried Wilhelm Leibniz, macht Manfred Richter in seinem kenntnisreichen Buch „Legende Lövenix“ bekannt. Und der Leser erfährt auch, was es mit dem Beinamen „Lövenix“ auf sich hat. Über sich selbst hatte Leibniz übrigens einmal in französischer Sprache notiert: „Mir kommen morgens manchmal so viele Gedanken während einer Stunde, die ich noch im Bett liege, dass ich den ganzen Vormittag und bisweilen den ganzen Tag und länger brauche, um sie klar zu Papier zu bringen.“ Geht es Ihnen vielleicht auch manchmal so?
Das vorletzte der aktuellen Angebote dieses Newsletters ist ein Kinderbuch, das eigentlich auch ein Krimi ist, und stammt von Hans-Ulrich Lüdemann. Ein Toter auf einer Urlaubsinsel gibt manches Rätsel auf und sorgt für viel Misstrauen und Spannungen unter den Menschen. Wem kann man noch trauen?
Und damit sind wir wieder beim aktuellen Beitrag der Rubrik Fridays for Future angelangt. Jede Woche wird an dieser Stelle jeweils ein Buch vorgestellt, das im weitesten Sinne mit den Themen Klima, Umwelt und Frieden zu tun hat – also mit den ganz großen Themen der Erde und dieser Zeit. Und da hat die Literatur schon immer ein gewichtiges Wort mitzureden und heute erst recht. In dem heute präsentierten Buch befasst sich Helga Schubert mit einem ziemlich heiklen Thema – dem des Verrats. Allerdings geht es diesmal um das weibliche Gesicht dieses mitunter ziemlich hässlichen Phänomens. Doch die Autorin will nicht vorschnell urteilen oder gar richten, wohl aber die Umstände erhellen, unter denen auch Frauen zu Vertrauensbrecherinnen und Verräterinnen wurden.
Erstmals 1990 erschien im Luchterhand Literaturverlag Frankfurt am Main „Judasfrauen. Zehn Fallgeschichten weiblicher Denunziation im Dritten Reich“ von Helga Schubert: Dies ist Helga Schuberts vielleicht wichtigstes Buch. Noch in der DDR fertiggestellt, wurde es zuerst 1990 im Westen im Luchterhand-Verlag veröffentlicht und erlebte Neuauflagen im Aufbau-Verlag, in der Büchergilde Gutenberg und im dtv. Es erschien in Japan, Italien und Frankreich. Die US-amerikanische Purdue-Uni verlieh der Autorin dafür den Doctor of humane letters. Nach dem umfangreichen Studium von Gerichtsakten westdeutscher Nachkriegsgerichte erzählt die Autorin mit literarischen Mitteln die tödliche Beziehung der Verräterinnen zu ihren Opfern (dem Ehemann, dem Sohn der Freundin, dem zunächst unbekannten Mitreisenden, dem früher verehrten Bürgermeister und nun steckbrieflich gesuchten Mitverschworenen gegen Hitler, Dr. Goerdeler).Einmal schreibt sie den Monolog einer Täterin. Der Text „Die Vertrauensperson“ ist auch im Theater aufgeführt worden. Helga Schubert zeigt, wie die Diktatur diese Frauen verführt, zu Täterinnen zu werden. „Die Diktatur ist die Täterin“, betitelte die „tageszeitung“ (taz) ihr Interview mit der Autorin, die das alles nur schreiben konnte, weil sie als ausgebildete klinische Psychologin insgesamt 23 Jahre in der Psychotherapie arbeitete. Hier berichtet die Autorin vom Anfang ihrer Recherchen und über ihre Gedanken zum Thema „natürliche Hemmschwelle“ und darüber, was sie mit Leuten machen möchte, die auf einem Sockel stehen:
„Judasfrauen
Von Frauen verraten.
Von Männern verhaftet, von Männern verhört, von Männern verurteilt, von Männern geköpft.
Aber von Frauen verraten.
Ein leiser Verrat.
Ein heimlicher und sauberer Verrat. Kein Blut an den zarten Händen, das Blut klebte am Fallbeil.
Frauen, die andere Menschen durch ihren Verrat töteten. Was waren das für Frauen?
Fühlst du dich denn überhaupt befugt, über so etwas zu schreiben? Das sollen doch die machen, die das miterlebt haben, die im KZ waren oder in der Emigration.
Du bist ja nicht einmal die Tochter von Betroffenen. Du bist kein Kind jüdischer Eltern, und deine Mutter war keine Politische im Zuchthaus.
Schreib über das, was dich selbst betrifft: die Flucht aus Hinterpommern.
Schreib über die Mütter, die damals mit euch geflohen sind. In den Trecks, in den Lkws am Ostseestrand, ohne Scheinwerfer, und auf der Straße oben das drohende Gebrumm der russischen Panzer. Diesen Frauen müsstest du ein Denkmal setzen.
Ja, du hast recht, antwortete ich meiner Mutter. Aber ich bin auch eine Deutsche, und ich bin auch eine Frau. Was bewog diese Frauen zum Verrat? Sie wussten doch, dass er tödlich ist.
Ist das nicht gefährlich – du musst dich mit dem Leben dieser Frauen beschäftigen, um sie beschreiben zu können. Am Ende bekommst du noch so etwas wie Verständnis für diese Subjekte. Ein anständiger Mensch hat doch eine natürliche Hemmschwelle und denunziert nicht.
Ja. Aber wo liegt der Unterschied zwischen der Frau, die über diese Hemmschwelle springt, und der, die davor stehen bleibt? Könnte ich an ihrer Stelle sein?
Warum sprichst du eigentlich dauernd von Frauen? Als ob es nicht auch unter den Männern Denunzianten gäbe. Willst du deinen Geschlechtsgenossinnen eins auswischen?
Mich stört die Frauenveredelung: So sensibel, so zart, so kooperativ, so mütterlich, so mitleidig, so kreativ, so authentisch sind wir nicht. Wir sind auch böse und auch gefährlich, auf unsere Weise. Sobald ein Mensch auf einem Sockel steht, möchte ich den Sockel zerschlagen.
Mich müssen Sie nicht fragen, sagte die Historikerin. Ich bin keine gute lebende Quelle für Sie, weil ich historisch denke und alles, was ich erlebt habe, historisch einordne.
Zum Beispiel werde ich skeptisch, wenn Leute von ihren mutigen Handlungen berichten: Sie erzählen nicht die ganze Wahrheit, bauschen auf, verschweigen, und das ist ja auch verständlich. Ich würde an Ihrer Stelle nicht alles glauben.
Außerdem fragen Sie nicht die richtigen Leute. Sie bekommen Antworten von Leuten, die auf der falschen Seite stehen. Die haben gar nichts gemacht gegen Hitler, diese Leute nicht.
Sehen Sie, ich habe vor dem Kriegsende als Sekretärin bei einem Mann gearbeitet, der war in die Pläne um den 20. Juli 1944 eingeweiht. Ich habe das erst nach dem Krieg erfahren und frage mich noch heute: Warum hatte er kein Vertrauen zu mir? Er hätte mich doch einweihen können.
Gehen Sie zum Vorsitzenden der Hausgemeinschaftsleitung: Er nennt Ihnen die alten Antifaschisten, die hier in der Nähe wohnen. Dann brauchen Sie nicht beim Fahrstuhlfahren die alten Frauen so unsystematisch zu befragen. Warum schreiben Sie eigentlich nicht über die Trümmerfrauen? Hier im Haus wohnt eine.“ Und damit zur ausführlicheren Vorstellung der anderen Angebote dieses Newsletters.
Erstmals 1984 veröffentlichte Klaus Möckel in der bekannten und beliebten DIE-Reihe (Delikte, Indizien, Ermittlungen) des Verlags Das Neue Berlin seinen Kriminalroman „Die Damengang“: In der titelgebenden Damengang finden sich vier Frauen zusammen, um durch Diebstahl und Hehlerei die eigenen Finanzen aufzubessern. Das Leben, meinen sie, kann angenehm sein, wenn man genügend Geld hat und von den Dingen, die einem gefallen, nicht nur träumen muss. Doch schon bald genügt ihnen die bescheidene Beute nicht mehr, und sie rüsten zum großen Coup. Kielstein, eigentlich mit Mordsachen befasst, bekommt den Fall aufgehalst. Zunächst fühlt er sich unter-, später aber überfordert. Als der Fall in einem Totschlag mündet, hat er den Ernst der Sache längst begriffen, aber nicht mit den Überraschungen gerechnet, die ihn am Ende erwarten. Klaus Möckel schrieb seinen Krimi frei nach einem Fall, der sich in den achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts tatsächlich in Berlin zutrug. Aber lernen wir zunächst einmal die Hauptpersonen, also die Mitglieder der Damengang, kennen – sowie zwei Männer:
„DIE WICHTIGSTEN PERSONEN SIND:
Josefine Lattebeck genannt Jeffi: attraktive Dekorateurin, die ihren Beruf für raffinierte, üble Unternehmungen nutzt
Inge Kalz: ihre Freundin, männerfeindlich wie sie und fast ebenso abgebrüht
Antje: sucht als Jüngste der Gruppe das Abenteuer und findet das Verbrechen
Manja Lebholz: Hehlerin, sich immer tiefer in Schuld verstrickend
Ronald: ihr trunksüchtiger, im steten Streit mit ihr liegender Mann
Leutnant Kielstein: diesmal kleinen Ladendieben auf der Spur, die sich als höchst gefährlich entpuppen
- Kapitel
Der dunkelgrüne Wartburg biegt von der Hauptstraße ab, die im bläulichen Schimmer der Neonlampen friedlichen Träumen nachzuhängen scheint, und taucht in eine Schattenzone ein. Kleine, meist alte Häuser, dann Gärten und schließlich Baugelände, durch Bretterzäune abgesperrt. Jetzt die Scheinwerfer aus und Gas weg“, verlangt eine gepresste Stimme, „wir halten am besten dort vorn bei den Büschen.“
Sofort gehn die Lichter aus, und der Wagen pirscht sich im zweiten Gang auf einem Sandweg voller Schlaglöcher an die bezeichnete Stelle heran. Die Dunkelheit umschließt das Fahrzeug wie eine Faust, öffnet sich nur für Bruchteile von Sekunden, wenn am Himmel die Wolkendecke zerreißt und ein blässlicher Halbmond sichtbar wird.
„Stopp, hier ist’s richtig.“ Die Stimme von eben lässt sich erneut vernehmen.
Der Wagen hält, und die hinteren Türen gehen auf. Zwei Gestalten in Mänteln und mit über den Kopf gestülpten Kapuzen, die eine dicklich, untersetzt, die andere etwas größer und schlank, springen ins Freie. Eine dritte Person, durch die Scheibe kaum auszumachen, bleibt hinterm Lenkrad sitzen. Die Gestalten in den Kapuzenmänteln tragen Stoffhandschuhe, die größere von ihnen hat eine Art Leinensack unterm Arm. Die kleinere hat eine Umhängetasche bei sich und einen kurzen Eisenstab, einen Automontierhebel, am Ende stark abgeflacht.
„Vielleicht dort durch.“ Diesmal macht sich im Flüsterton die zweite Person bemerkbar, die mit dem Montierhebel. Sie ist schon am Zaun, der mehrere, nur provisorisch mit Stacheldraht geflickte Lücken aufweist. Ein leises Knacken, ein Brett wird mitsamt dem Draht zur Seite gedrückt. Danach ein zweites. Ohne Schwierigkeiten schlüpfen die beiden durch den Spalt.
Das Baugelände ist von Erdhaufen übersät. Steine liegen herum, ein Kran ragt auf, stumm, mit gespenstischem Arm. Die Gestalten laufen über harten, durch eine lange regenlose Periode ausgetrockneten Boden. Nach etwa hundert Metern stoßen sie auf eine halbhohe Mauer.
„Vorsicht jetzt, im Haus oben die Leute…“, ertönt wieder die erste Stimme.
„Alles finster, die pennen.“
Die Mauer ist kein Hindernis, der Hof ebenso wenig, die Dunkelheit macht die Sache zum Kinderspiel. Etwas schwieriger wird es, als die beiden an der Hinterfront eines Gebäudes angelangt sind, an einer Kellertür, zu der drei Stufen hinunterführen. Sie ist verschlossen und aus derbem Holz. Aber damit haben die Einbrecher gerechnet.
„Das Schloss taugt nichts, ich hab‘ mir’s angeschaut.“ Die kleinere Person nickt. Sie setzt den Montierhebel an, drückt erst vorsichtig, dann stärker. Mit einem mäßigen Knall springt die Tür auf.
Die beiden Gestalten schieben sich in die Türnische, verharren einige Sekunden, doch im Haus bleibt alles still.
„Los, weiter“, sagt leise und bestimmt die größere.
Sie holt eine Taschenlampe aus dem Leinenbeutel, der Strahl leuchtet tastend einen Kellergang aus. Eine Treppe führt nach oben, die Tür zum Hausflur ist nur angelehnt. Schwacher Geruch von Schokolade und Bohnenkaffee steigt in die Nase.
„Riechst du was?“
„Na und ob.“
„Die Wohlgerüche Brasiliens“, flüstert die größere Person und wendet sich zielgerichtet einer blechverkleideten Tür zu.
Diesmal hätte der Montierhebel bestimmt einen härteren Kampf bestehen müssen, doch er wird nicht gebraucht. Die Person mit dem Leinenbeutel holt einfach einen Schlüssel aus der Manteltasche und steckt ihn ins Schloss. Zwar sperrt sich die Verriegelung, will nicht gleich nachgeben, doch dann schnappt sie zurück. Einmal, zweimal, das letzte Hindernis ist überwunden.
Sie sind drin, die kleinere Gestalt zieht die Tür hinter sich zu. Der Strahl der Taschenlampe geistert durch einen nahezu quadratischen Raum mit einem Tisch, Stühlen, zwei Schränken, „Ob da was zu holen ist?“ Der Lichtkegel verharrt bei einem der Schränke.
„Hier können wir Licht machen, müssen nur die Tür zum Laden geschlossen halten.“ Die größere Gestalt betätigt einen Schalter.
Der plötzliche grelle Schein blendet, die beiden kneifen die Augen zusammen. Doch sie haben keine Zeit zu verlieren. Der Montierhebel wird erneut angesetzt Mit einem Knarren geht die Schranktür auf.
„Scheiße, bloß Papierzeug.“
„Vielleicht in dem andern.“
Diesmal splittert Holz, in der nächtlichen Stille ein lautes Geräusch.
„Sei doch vorsichtig, du weckst die Leute auf.“
„Ohne ein bisschen Krach geht’s nicht.“
Im zweiten Schrank befindet sich eine Kassette. Verschlossen und ziemlich schwer. Die Gestalt mit dem Montierhebel schüttelt sie, es klappert. „Da ist was drin“, sagt sie.
„Gut, wir nehmen sie mit. Aber erst das andere.“
Das Licht wird wieder ausgeschaltet, die größere der beiden Personen öffnet eine Tür. Jetzt aufpassen, man kann uns durchs Schaufenster sehn."
„Sollten wir nicht lieber in den Lagerraum…“
„Hat keinen Sinn, der ist doppelt verrammelt.“
Der Laden, in dem sie nun stehen, ist niedrig und lang gestreckt. Der schwere süßliche Geruch drängt sich hier stärker auf, verführerischer, denn die Regale sind gut bestückt: Schokoladen- und Zuckererzeugnisse, Gebäck, aber auch Tee, Kaffee. Die beiden Gestalten haben ihre Kapuzen tiefer in die Stirn gezogen, sie huschen gebückt dahin und knipsen die Taschenlampe nicht an. Zwar ist es auf der Straße vor dem Fenster ruhig, doch ab und an fährt ein Auto vorbei, sind die Schritte eines Fußgängers zu hören.
Die untersetzte Person hat den Montierhebel im kleineren Raum zurückgelassen, sie räumt hastig Pralinenpackungen, Schokoladentafeln und Kaffeepäckchen in die große Umhängetasche. Die andere Gestalt füllt den Leinenbeutel. Sie nehmen vor allem die teuren Artikel, soweit sich das in der Düsternis ausmachen lässt. In der Nähe des Fensters steht auch Schnaps: Wodka, Weinbrand und einige Sorten Likör. Die mit der Tasche kann es sich nicht verkneifen, nach vorn zu huschen und ein paar Flaschen zu greifen.
„Nicht so schweres Zeug, das können wir dann nicht schleppen.“
„Wir haben doch jeder zwei Hände.“
„Und die Kassette?“
„Die kriegen wir schon mit.“
Auf der Straße nähern sich Schritte und Gelächter, ein Pärchen, offenbar in gehobener Stimmung, bleibt vor dem Geschäft stehen. Die Kapuzengestalten verschwinden blitzschnell hinter einem Ladentisch. Aber vielleicht hat der junge Mann draußen doch einen Schatten bemerkt. Er presst das Gesicht gegen die Scheibe: „Ist da jemand?“
Die Worte sind im Laden nicht zu verstehen, wohl aber zu erraten.
„Diebe“, kichert seine Freundin.
„Sei nicht so albern, wär‘ doch möglich.“
„Hilfe, Einbrecher“, ruft spöttisch das Mädchen.“
Erstmals 2004 veröffentlichte Manfred Richter beim trafo Verlag Berlin seinen großen Roman „Legende Lövenix. Ein ungesicherter Bericht über die Liebe und anderes Merkwürdige im Leben des Gottfried Wilhelm Leibniz“: Der 70-jährige Gottfried Wilhelm Leibniz steht am Ende seines Lebens. Wenige Tage vor seinem Tod diktiert er dem Sekretär Eckhart Erinnerungen, Lebenserfahrungen. Auf diese Weise konnte in der Ich-Form geschrieben werden – der Leser bleibt der zentralen Figur sehr nahe. Leibniz berichtet so unerhörte Dinge, dass sich dem Sekretär mehr als einmal die Feder sträubt. Von der Liebe zu einer Königin ist die Rede, von Freundschaft zu einem Diener und von Schuld …
Seine Erinnerungen reisen quer durch Europa – in das Frankreich Ludwig XIV., nach London, Holland, Wien, Rom. Er begegnet berühmten Persönlichkeiten seiner Zeit – Kaiser Leopold I., Eugen von Savoyen, Huygens, Spinoza, dem Papst, Sophie Charlotte und ihrem Gatten, dem Preußenkönig Friedrich I. Der Roman erzählt von Hoffnungen und Illusionen, Irrtümern und Zweifeln, großen Ideen und Erkenntnissen, erzählt von einem Menschen, der liebte und wiedergeliebt wurde, und dessen Forderung nach Frieden und Glück für die Menschen höchst aktuell bleibt. Es ist verbürgt, dass Leibniz im niedersächsischen Hannover hinter vorgehaltener Hand ‚Lövenix‘ genannt wurde. Im Roman wird das sehr schnell aufgeklärt. „… Sie messen mich“, berichtet er, „drüben im Schloss an der Zahl meiner Kirchgänge. Die waren selten, ich gestehe es. He glövt nix, hieß das in ihrer Mundart, sie haben daraus den Lövenix gemacht … Ein Scherz ohne Verstand. Ich erinnere mich doch kaum einer Predigt, die nicht gelangweilt hätte – zehn Sätze für Gott, zehn für die Leut‘ und zwanzig für die Katz‘ … Worte allein haben noch nie geändert …“. Aber hören wir einmal kurz in das Gespräch zwischen Leibniz und seinem getreuen Sekretär Eckhart hinein. Zur Orientierung: Wir befinden uns am Anfang des 18. Jahrhunderts:
„1. Kapitel
Diese frostige Novembernacht Siebzehnhundertsechzehn. Das Land liegt in tiefem Schlaf. Über den Markt von Hannover und durch die Gassen fegt ein eisiger Wind, wirbelt Dreck und Stroh bis unter die verschlossenen Fensterläden.
Der Nachtwächter schlurft müde und frierend an der Häuserwand entlang. Wenn der Wind einen Moment nachlässt, hört er die Ratten pfeifen und alle volle Stunden vom Sankt Georg das Schlagen der Glocke.
Nur in der Schmiedestraße, in der Kurfürstlichen Bibliothek, in dem vornehmen Eckhaus der Witwe Lüde, leuchtet hinter den Butzenscheiben des Erkers warmes Licht. Ein merkwürdiger alter Mann wohnt hier, der in einer Nacht so viel Kerzen brennen lässt, wie sie ein Nachtwächter das ganze gregorianische Jahr über nicht braucht.
Er hockt im Ohrensessel am Kamin, vom Feuer beleuchtet, ein Greis, von Schmerzen gepeinigt, nahezu blind. Sein Gesicht hat längst jene weichen, üppigen Züge verloren, mit denen er von Gemälden und Stichen herunterschaut – kahlköpfig ist er jetzt, schief die Nase, eingefallen die Wangen, der zahnlose Mund. Über den Brauen nisten zwei tiefe Falten. Auf seinen Schultern buckelt eine wollene Decke, die ihm etwas Faunisches gibt. Die Füße liegen hoch, und die Knie sind in eine merkwürdige Konstruktion gepresst, eine Art Holzzwingen, die er fest anziehen kann, um die Schmerzen der Krankheit durch einen anderen Schmerz zu betäuben. Am Sessel lehnt griffbereit ein Krückstock, den er kaum noch nutzen kann, es sei denn, er schneidet die Luft damit, fuchtelt mit ihm, um seinen Worten Nachdruck zu verleihen – Reichshofrat Leibniz, Gottfried Wilhelm Leibnitz, genannt der Lövenix.
Nebenan, auf dem kleinen Tisch, tickt die Sackuhr. Ein Geschenk von Huygens, dem Direktor der französischen Akademie. Ihre vertrackte eiserne Unruhe zerhackt unbarmherzig die Zeit. Was sind ein paar Tage und Nächte – gemessen an zähem Lebenswillen, gemessen an siebzig langen Jahren! Der Alte spürt mit einer matten, gleich bleibenden Erbitterung gegen den eigenen Körper, dass seine Zeit um ist, obwohl doch Kopf und Verstand den Dienst verrichten wie je.
Der Schein des Öllämpchens auf dem Schreibpult, das sanfte Licht der Kerzen und das flackernde Kaminfeuer dringen nicht bis in alle Winkel des Arbeitszimmers. Halbwegs deutlich sieht man nur Regale voller Bücher, neben dem Kamin die Truhe, in der er seine Aufzeichnungen verwahrt.
Magda, die einst so anmutige Wirtschafterin und Vertraute, streicht ihre grauen Haarsträhnen aus der Stirn, beugt sich über den Alten und hält ihm einen Zinnbecher an den Mund. Er schlürft den Wein, schmatzt zufrieden. Mit einem Spitzentüchlein wischt sie ihm Mund und Kinn ab. Dann aber scheucht er sie mit einer winzigen Kopfbewegung aus seinem Gesichtskreis, aus dem Raum. Er hat zu tun.
Am Stehpult wartet müde und grillig Musjö Eckhart, Sekretär Eckhart, der Nörgler und Liebediener und Spion des Kurfürsten Georg Ludwig, jenes Georgs, der, nicht ohne Zutun des gebrechlichen Alten im Sessel, König von England wurde.
Auf den ersten Blick wirkt Eckhart wie ein subalterner Beamter. Aber der Mensch ist nicht dumm, nicht schmierig. eher hart und gerissen, kritisch auch und voller Vorurteile. Er mag den Alten nicht und hängt doch an ihm in widerborstiger Bewunderung, und der Alte weiß das und nutzt es.
Aus dem Sessel klingt es überraschend energisch: „Wo stehen wir?“
Eckhart prüft im Licht des Öllämpchens die Schreibfedern, er gibt sich gleichmütig: „Bei der Hexe.“
Der Greis zieht fröstelnd die Decke vor die Brust, reibt das schmerzende Knie, lächelt in der Erinnerung. „Ich hob kotzen müssen, denk dir!“
Eckhart tadelt vorsichtig: „Ihr wollt sagen…“
Der Alte aber fordert unwillig: „Schreib!“ Er lehnt sich zurück, die Augen sind auf einen imaginären Punkt gerichtet. Er diktiert langsam, heiser, Vergangenheit zurückrufend: „Boineburg. der ältere, der Christian, hatte darauf bestanden, dass ich dem Spektakel beiwohne. Nun, ich war jung, ich war neugierig. Gewiss doch, ich war auch Jurist.“
Der Alte stockt. Sein Gesiebt leuchtet im Widerschein des Kaminfeuers. Die trüben Augen sehen brennende Fackeln, sehen den Scheiterhaufen, das Mädchen, festgezurrt am Pfahl, schmutzig, hohläugig, ohnmächtig vor Schmerz und Angst. Er spürt noch einmal das aufgeregte Stöhnen der gaffenden Menge: Soldaten, Honoratioren, feingekleidete Stadtweiber, Handwerker, Diebe, Krüppel – ein schwer atmender, sinnlich aufgegierter Haufen. Er sieht den Priester mit hoch erhobenem Kruzifix. Trommeln dröhnen. Er siebt, wie der Henker der Ohnmächtigen von hinten einen Strick um den Hals legt und, den hölzernen Knebel langsam drehend, fest anzieht. Das Mädchen reißt Mund und Augen auf, seine Zunge quillt dick und hässlich hervor, Arme und Beine zucken und reißen wider die Fesseln, bis sein Körper jäh zusammenbricht und wie ein Sack Futterrüben in den Stricken hängt. An den Beinen laufen Pisse und Kot herunter. Gleich danach flammen Reisigbündel auf, entzünden den Scheiterhaufen. Nesselhemd und Haar des Mädchens lodern. Qualm und der üble Geruch versengten Haars und brennenden Fleischs dringen auf die Galerie zu. Messbuben schwenken schwere Weihrauchkessel, schlagen damit klirrend gegen die Brüstung.
Sich selbst sieht er, sieht sich als jungen, biegsamen Kerl. Im Sächsischen hatte er promovieren wollen. Seiner Jugend wegen setzte man ihn hintan. Da hatte er sich an der Universität in Altdorf eingeschrieben. Nun also war er Jurist und Zeuge, wie ein unschuldiges Ding als Hexe verbrannt wurde. Und er hat dabei gestanden, duldsam, hat nicht laut herausgeschrieen, hat sich gedrückt mit schlechtem Gewissen, abgewendet und Galle gekotzt wie an besoffener Bauer.
Nein, denkt er, davon will ich nicht schreiben, nicht davon, dass es mich zeitlebens gebissen hat, weil ich aus Schwäche stumm blieb vor dem Unrecht.
Armes Weib, denkt er noch einmal, Rauch und Gestank und ihr stummer Schrei haben die Sonne und mancherlei anderes dunkel gemacht. Einer Glaubenslehre wegen wurde gegen Gott verstoßen.
„Schreib!“, befiehlt er zu Eckhart hin. „Schreib!“
Und Eckhart senkt gehorsam die Feder ins Tintenfass.“
Erstmals 1974 erschien im Kinderbuchverlag Berlin der DDR „Der Eselstritt“ von Hans-Ulrich Lüdemann: Endlich Betriebsferien. Aber da gibt es einen Toten auf der Urlaubsinsel. Nutzte der Täter die Gewitternacht? Da war doch noch eine Motoryacht, die im Schutz der Dunkelheit anlegte? Nahm jemand tödliche Rache am unbeliebten Geschäftsführer? Und wo ist seine Frau? Jeder verdächtigt jeden. Die Kinder der Kollegen leiden unter diesem allgegenwärtigen Misstrauen. Endlich treffen Ermittler vor Ort ein. Sie offerieren schließlich eine überraschende Lösung des Falles. Im folgenden Textausschnitt geht es aber erst einmal um die Sorgen eines jungen Sportlers und um Blumen für seine Mutter:
„5. Kapitel
Rolf lag auf dem Sofa in seinem Zimmer. Die Arme hatte er unter dem Kopf verschränkt. Sein Blick wanderte an der Wand entlang. Schräg über ihm begann eine Girlande aus Judogürteln. Der weiße war mit dem gelben verknüpft, dieser wiederum mit dem orangefarbenen. Die Prüfung für den grünen wollte Rolf im Trainingslager ablegen. Am Ende der Gürtelreihe waren vier Urkunden senkrecht untereinander an die Wand genagelt. Auf Rolfs Leiterregal standen neben kleinen Eisenautos, von denen die meisten ein Geschenk des Vaters waren, mehrere Bücher über Kampfsport. Rolfs Rundblick endete mit Stöhnen. Als Herr Langhans wieder auf Tour gefahren war vor zwei Tagen, hatte er noch einmal unmissverständlich seine Meinung bekräftigt, dass der Sohn sich die Teilnahme am Trainingslager aus dem Kopf schlagen sollte. Und nun lag auf der Schreibplatte unter dem Bücherbord ein Formular, auf das die Eltern ihre Unterschrift setzen mussten. Zum Zeichen dafür, dass ihr Sprössling mit der Judogruppe auf Fahrt gehen durfte. Dass sein Vater sich doch noch anders besinnen würde, diese Möglichkeit hielt Rolf für wahrscheinlich. Aber dann half es nichts mehr. Heute Nachmittag beim Training mussten die Unterlagen abgegeben werden. Die Mutter zu bitten, traute Rolf sich nicht. Er wusste, dass sie wieder Ärger mit Vater bekommen würde. Angestrengt dachte der Junge nach. Als die Türklingel anschlug, tat er so, als wäre nichts zu hören gewesen. Rolf wollte sich nicht stören lassen. Die Mutter konnte es nicht sein. Sie hatte angerufen, weil sie nach der Frühschicht zum Friseur gehen wollte. Und Chris war zu ihren Klassenkameraden gegangen, um für das Abitur zu büffeln.
Als es das vierte Mal klingelte, erhob sich Rolf langsam. Er zog die Hausschuhe über und schlurfte aus dem Zimmer.
„Ich komm ja schon!“, rief er ungnädig, da es erneut läutete. Als der Junge die Tür öffnete, stand Herr Brümmer vor ihm, in der Hand einen kleinen Blumenstrauß.
„Hab ich den Kämpfer bei der Mittagsruhe gestört?“, fragte der Betriebsleiter gutgelaunt.
Rolf trat zur Seite und ließ den vierschrötigen Besucher eintreten. Dabei musste er sich bis an die Wand zurückziehen, denn der schmale Flur reichte gerade für den schwergewichtigen Herrn Brümmer. „Meine Mutter ist noch nicht da“, sagte Rolf. Er nahm die Blumen, die der Mann ihm in die Hand gedrückt hatte. „Setzen Sie sich ins Wohnzimmer. Ich komm gleich. Will bloß eine Vase suchen.“
Otto Brümmer kannte sich aus. Immer wenn er eine neue Idee hatte, und die hatte er oft, brauchte er Rolfs Mutter. Manchmal arbeiteten sie hier oder in Brümmers Wohnung, dessen Frau sich dann still in eine Ecke zurückzog und las.
„Die sind aber teuer, was?“, fragte Rolf sachverständig, als er die Vase mit den fünf Rosen auf die kleine Anrichte neben der Balkontür stellte,
„Deiner Mutter Arbeit für den Betrieb ist nicht mit Geld zu bezahlen, mein Junge.“
Rolf fühlte, wie ihm etwas Warmes aus der Bauchgegend bis in die Haarspitzen hochstieg. Dieses Gefühl hatte er immer, wenn er seine Gegner besiegt hatte und der Mattenrichter den Namen Rolf Langhans ganz deutlich für alle Zuschauer ausrief. Ja, meine Mutter ist in Ordnung, dachte Rolf. Er öffnete die Balkontür, um frische Luft einzulassen.
„Wir waren um zwei verabredet“, sagte Herr Brümmer, der sich auf einem Sessel niedergelassen hatte. Neben ihm lehnte eine kleine Aktentasche am Tischbein. „Sicherlich dauert es beim Friseur etwas länger.“
Rolf setzte sich auf die Couch. Sie schwiegen. Der Junge überlegte, ob er Herrn Brümmer etwas zu trinken holen sollte. Bei Mutter war es immer so gewesen. Mal ein Zitronensaft, das andere Mal ein Bier.
„Was macht dein Training?“, fragte Herr Brümmer plötzlich.
Rolf schrak zusammen. „Das Training“, er zog die Worte etwas in die Länge. Und in diesem Augenblick erkannte er eine Möglichkeit, mit der er allen Sorgen aus dem Wege gehen konnte. Zwar war ihm nicht ganz wohl dabei, aber hatte er eine andere Chance, die Unterschrift zu bekommen?
„Schwierigkeiten?“, wollte Otto Brümmer wissen. Er setzte sich aufrecht.
„Brauchst du wieder einmal einen Übungspartner? Räum den Tisch weg. Bis deine Mutter kommt, habe ich Zeit.“ Der Betriebsleiter wollte aufstehen und das Jackett ablegen.
Aber Rolf schüttelte den Kopf. „Ich muss gleich zum Training. Trotzdem, helfen könnten Sie mir schon, Herr Brümmer.“
„Dann zier‘ dich nicht lange und rede.“
„Moment!“ Rolf lief nach nebenan in sein Zimmer. Sekunden später kam er zurück und legte das ausgefüllte Formular auf den Couchtisch.
Brümmer nahm das Papier und las.
„Ich habe heute Morgen vergessen, es Mutti zur Unterschrift zu geben. Aber heute ist letzter Termin. Wenn Sie vielleicht unterschreiben würden?“ Rolf verschluckte sich fast vor Eifer. „Vati ist ja wieder seit zwei Tagen unterwegs, wissen Sie.“
Herr Brümmer nickte verständnisvoll. Mein Gott, dachte er, wenn wir nur solch einen Sohn haben würden. Der so ehrgeizig trainiert und auch ansonsten seinen Eltern keine Schande macht. Die Langhans waren zu beneiden. Brümmer schüttelte unwirsch den Kopf. Was sollten diese Gedanken. Seit fünfzehn Jahren wussten er und seine Frau, dass sie keine eigenen Kinder haben würden. Wozu diese Grübelei. Sie war nutzlos und schmerzend.
Rolf war zusammengezuckt, als der Mann den Kopf schüttelte. Aus, dachte er. Die letzte Chance dahin. Und er überlegte schon, ob es dann überhaupt Zweck hatte, zum Training zu gehen. Wenn er das Formular nicht unterzeichnet abgab, würde es für ihn unangenehme Fragen hageln. Warum, weshalb und so weiter. Bei schlechten schulischen Leistungen durfte er nicht mit dem Verständnis des Trainers rechnen. Das hatten andere vor ihm oft genug erlebt. Anders war es, wenn einer das Geld für das Trainingslager nicht aufbringen konnte. Da sprang die Betriebssportgemeinschaft ein. Doch wegen des Geldes hatte Rolf bereits vorgesorgt. Zwei Sonntage hatte er in der großen Gaststätte im Gernroder Kulturpark Gläser und Geschirr abgeräumt. Da man diese Hilfskräfte dringend brauchte, wurden sie auch gut bezahlt …
Ungläubig beobachtete Rolf, wie Herr Brümmer einen Stift aus der Brusttasche zog und schwungvoll seinen Namen an die Stelle setzte, wo die Erziehungsberechtigten gegenzeichnen sollten. Noch immer staunend, nahm der Junge das Papier in die Hand. In Vertretung: Otto Brümmer. Nie hatte sich Rolf so über eine schwungvolle Handschrift gefreut wie in diesem Augenblick. „Vielen Dank, Herr Brümmer!“
Auf einmal hatte Rolf es ungeheuer eilig. Hinter dem Vorhang auf dem Flur lag der gepackte Sportbeutel. Als der Junge an der Wohnungstür stand, drehte er sich noch einmal um und lief zum Wohnzimmer zurück. Herr Brümmer war damit beschäftigt, den Inhalt seiner Aktenmappe gleichmäßig auf dem Tisch zu verteilen. „Im Kühlschrank steht Pilsner“, sagte Rolf laut.
Überrascht blickte Brümmer hoch. Der Junge war wie aufgedreht. Der Betriebsleiter lachte. Er freute sich, mit welcher Begeisterung der Sohn der Kollegin Langhans seinem Judosport nachging.
„Auf Wiedersehen, Uke“, sagte Rolf ernst.
Herr Brümmer erhob sich leicht in seinem Sessel. Mit Uke wurde derjenige bezeichnet, der sich als Übungspartner dem Angreifer zur Verfügung stellte.
„Auf Wiedersehen, Tori“, antwortete der Betriebsleiter mit einer leichten Verbeugung.“
Erstmals 1988 veröffentlichte Jurij Koch beim Verlag Neues Leben Berlin „Augenoperation“. Unter dem veränderten Titel „Schattenrisse“ erschien das Buch 1989 auch beim Spectrum Verlag Stuttgart und 1993 beim Deutschen Taschenbuchverlag dtv München: Er bewegt sich in einer eingedunkelten schattenreichen Welt: Gerat Lauter, noch nicht achtzehn. Er wartet darauf, dass seine mit Kalklauge verätzten Augen operiert werden können. Ob er danach wieder sehen wird? Die Chance steht fünfzig zu fünfzig. Alles begann mit dem Bewerbungsschreiben. Wer äußert sich auch so offen über sich selbst und stiftet damit Verwirrung. Nur noch zu sagen, was wahr ist – ein selbstgewählter Anspruch, dessen Folgen Gerat zu spüren bekommt, zu Hause, später im Betrieb, in der Liebe zu Claudia, seiner Lehrerin, von der er nicht weiß, zu wem sie hält, als es um die Aufdeckung eines großen Betruges geht.
Unter dem wiederum veränderten Titel „Tanz auf der Kippe“ wurde der Roman von Jurij Koch 1991 von der DEFA verfilmt. Regie führte Jürgen Brauer, der auch das Drehbuch schrieb und die Kamera führte. In den beiden Hauptrollen waren Frank Stieren als Gerat Lauter und Dagmar Manzel als Claudia Johanz zu sehen. Weitere prominente Mitwirkende des 97-Minuten-Streifens waren Winfried Glatzeder und Peter Bause sowie der früher am Mecklenburgischen Staatstheater Schwerin engagierte Schauspieler Wolf-Dieter Lingk. Uraufgeführt wurde „Tanz auf der Kippe“ am 16. Februar 1991 in der Sektion Panorama während der 41. Internationalen Filmfestspiele Berlin im Berliner Haus der Kulturen der Welt. Die Kinopremiere fand am 25. April 1991 im Berliner Progress-Clubkino Felix statt. Die erste Ausstrahlung im Fernsehen folgte am 25. Oktober 1992 im ZDF. In einer Filmkritik hieß es: „… ein aufbegehrender Jugendlicher, der sich gegen die gesellschaftlichen Zwänge zur Wehr setzt und schwer verletzt wird, als er gegen einen Korruptionsfall einschreitet, endet im Sinne des Wortes auf dem Müll. Eine in verschachtelten Rückblenden erzählte Beschreibung des Endzustandes der ehemaligen DDR, die geschickt eine Liebesgeschichte mit einer Kriminalhandlung verbindet. Konsequent inszeniert, sympathisch frisch gespielt von den beiden Hauptdarstellern, metaphorisch schlüssig in seiner Botschaft.“ Hier eine Begegnung mit dem jungen Helden, der erst noch auf seine Augenoperation warten muss. Außerdem geht es um eine gewisse Stelle von Männerhosen:
„4. Kapitel
Wichtig ist, dass der Arzt den Trepan senkrecht ansetzt, damit die undurchsichtige Hornhaut des Auges genau ausgeschnitten werden kann. Was mit einem Rasierklingenmesser geschehen kann. Auch das herausgeschnittene Spenderauge muss er so zwischen den Fingern halten, dass kein schiefes Transplantat entsteht. Wenn es aber passiert, kann er den Fehler ausgleichen, indem er erst den Teil vernäht, der gut auf den Rand des Empfängerfensters zugeschnitten wurde, dann muss er das andere Ende so zurechtpitzeln und ziehn, dass es passt, aber wiederum nicht so stark, dass es am anderen Ende zerrt, was ein schiefes Fenster ergeben könnte. Ich möchte mit keinem solchen herumlaufen.
Ein gewisser Himly hat vor mehr als hundert Jahren vorgeschlagen, getrübte Hornhaut durch Glas zu ersetzen. Reisinger hat’s paar Jahre später versucht. Es hat geklappt. Dann wurden Hornhäute von Tieren benutzt. Dann von Menschen. Auch von lebendigen. Jemand verzichtete für einen anderen auf ein Auge. Das ist nicht mehr üblich, sagt Hedderoth. Nur in Romanen.
Woher weißt du das alles? fragt er mich.
Aus einem Ihrer Bücher, antworte ich. Von diesem Castroviejo.
Wie kommst du zu dem Buch?
Durch Petra.
Er weiß nicht gleich, wer Petra ist. Ich sage, die Kleine, die so leise spricht. Nun weiß er, wer gemeint ist. Ich versteh nicht, dass so ein Mann wie er, der Augen hat zum Sehen, nicht sofort weiß, wer Petra ist.
Sie hat dir’s vorgelesen?
Ja.
Er wird zum Telefon gerufen und geht ins Nebenzimmer. Mir fällt eine Geschichte ein. Ich weiß nicht, warum sie mir in diesem Zusammenhang einfällt, weil es keinen richtigen gibt. Es war auf einer Betriebsfeier in irgendeinem Kombinat. Wo unsere Klasse ein Programm abgeliefert hatte. Jedenfalls war dort so ein Mann, Direktor oder noch mehr, zu dem eine verflucht schöne Frau .gehörte. Aber er schien sie nicht zu sehen. Ließ sie den ganzen Abend allein am Tisch und drückte sich in der funzligen Bar unterhalb der Bühne herum, mit einer unglaublich hässlichen Ziege, dass ich glaubte, in einen Stall geraten zu sein. Ich saß ungefähr einen Meter von den beiden entfernt und sah, wie sie ihm an die Hosen ging. Ich meine die Stelle, wo der Schneider sich entschuldigt, wenn er dort Maß nehmen muss. Sie ging ihm an den Stoff und quasselte dabei von einer Modenschau, für die sie angeblich die Texte geschrieben hatte. Ich dachte, ich höre Radio Tirana. Und der Alte quetschte ihre Hand an die Barbrüstung und nickte zu dem Schwachsinn, als meldete ihm die Sekretärin erfüllte Pläne. Selbst als Esel wie er hätte ich ihr mit dem Schwanz eins versetzt, dass im Stall das Licht ausgegangen wäre. Ich ging zu seiner Frau in den Saal und bat sie zum Tanz.
Sie wunderte sich und fragte: Sie wollen mit mir tanzen, junger Mann?
Klar!
Wir tanzten ein paar Touren. Ich fragte sie, ob es sich um ihren Mann handelt, der so einen angegrünten Anzug anhat und aussieht wie der Oberförster im abgeholzten Revier.
Ja, antwortete sie. Was ist mit ihm?
Sie sollten ihm ein Fernglas kaufen.
Wie das?
Er kann ein Reh von einem Schwein nicht unterscheiden.
Sie überlegte ein Weilchen und löste sich dann ruckartig aus meinen Armen. Was erlauben Sie sich! Was mischen Sie sich in unsere Angelegenheiten!
Schon gut, sagte ich.
Sie setzte sich auf ihren Platz und wartete auf die Rückkehr ihres Jägers.
Ich weiß nicht, warum mir das eingefallen ist. Hedderoth ist kein Esel und hat sicherlich eine schöne Frau. Jedenfalls hab ich noch keinen Professor mit einer hässlichen Frau gesehn. Es ist erstaunlich, dass einem solchen Mann nicht sofort die Frau einfällt, die gemeint ist, wenn der Name Petra fällt. Ich stell mir Petra wie Rotwild vor. Hochbeinig, schnell, scheu, braun. Ich wünsche mir, dass sie an meinem Bett steht, wenn ich aus der Narkose erwache. Aber sonst ist nichts gewesen und wird nichts sein.
Einmal ist sie bei mir geblieben. In Kleebuschens kalter Bude. Sie hatte mir den ganzen Abend aus dem Castroviejo vorgelesen. Als sie nach Hause gehen wollte, fing ein Gewitter an. Ich gab ihr mein Bett und legte mich neben sie auf den Boden. Wir lagen lange wach und erzählten uns. Wo sie herkommt und so. Über ihr Dorf, das von der Kohle aufgefressen worden ist. Dass ein neues entstanden ist. In das die Einwohner des alten gezogen sind. Dass sie wieder aufs Dorf zurück will. In eine Ambulanz. Wie ich später mit meiner Lehre zurechtkommen werde. Wir sprachen über Dinge, die völlig unwichtig waren, weil wir zum ersten Mal nebeneinander lagen. Aber keiner kam auf den Gedanken, dass sie wirklich unwichtig waren. Man kann in der Nacht nebeneinander liegend die Welt auseinander nehmen und wieder zusammensetzen. Es war kalt. Petra sagte, dass ich zu ihr kommen kann, wenn ich friere. Ich legte mich zu ihr und meinen rechten Arm über sie. Sie ihren linken über mich. Wir hauchten uns gegenseitig den Atem ins Gesicht. Gute Nacht, sagte sie. Schlaf gut!
Ich wusste, dass sie mich überhaupt nicht für bescheuert hielt. Während mich Ines für bescheuert gehalten hätte, wenn ich mit ihr eine halbe Nacht über das Dorf und die Welt diskutiert hätte, ohne aufs Thema zu kommen. Ines hatte mir nicht gefallen, aber ich hatte Lust gehabt, mit ihr zu schlafen. Petra gefiel mir.
Ich geh im Hof der Klinik spazieren. Bis zum Gewächshaus, in dem nichts wächst, soviel ich seh. Und zurück zum Tor. Es ist still geworden im Gelände. Petra hat ihren freien Tag. Manchmal geht sie mit mir spazieren. Wir gehen etwas weiter. Aber nicht zu weit. Weil es verboten ist, zu weit zu gehen. Es ist, als hätte Hedderoth alle Patienten nach Hause geschickt. Und das Personal beurlaubt. Damit es Kräfte sammelt für die nächste große Operation. Meine. Ich bilde mir ein, dass ich überall hinter den Fenstern im Gespräch bin. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Hedderoth und seine Leute mit etwas anderem beschäftigt sein könnten als mit mir. Mit meinen Unterlagen. Aufnahmen. Befunden. Als ich ihm heute nach dem Frühstück begegnete, sagte er: Ach ja! Und eilte zurück in sein Zimmer. Ihm war, als er mich gesehen hatte, noch etwas eingefallen, was mit meiner Operation zusammenhing. Wenn er mir nun nicht begegnet wäre! Wenn ein dringenderer Fall dazwischenkommt! Es ist nicht auszuschließen, dass ein dringenderer Fall dazwischenkommt!“
Dieser Roman und auch der nach dieser literarischen Vorlage entstandene DEFA-Film sind auf jeden Fall eine dringende Empfehlung. Gleiches gilt für die anderen vier Sonderangebote dieses Newsletters, noch einmal besonders aber für den packenden Leibniz-Roman von Manfred Richter, bei dem sich der Leser so fühlt, als wäre er bei den Geschehnissen tatsächlich dabei. Und zugleich macht das Buch Lust, sich noch detaillierter mit diesem Universalgenie und seinem Denken zu beschäftigen. Spannend allein die Zahl der Themenfelder, auf denen sich dieser „geistige Überflieger“ und wissenschaftliche Grenzgänger bewegte: Theologie, Philosophie, Bergbau, Mathematik, Geschichte, um nur einige zu nennen. Er entwickelte Pläne für ein Unterseeboot, erfand einen Windmesser und eine mechanische Rechenmaschine, die multiplizieren konnte.
Und nicht zuletzt soll hier noch an einen ebenso wichtigen wie sehr optimistischen Gedanken des großen Aufklärers erinnert werden, der große Hoffnung in die menschliche Vernunft setzte, auch wenn er selbst in seinem Leben mehrfach enttäuscht wurde: „Jeder Mensch besitzt Fähigkeiten zur vernünftigen Lebensführung.“ Und fast wie eine Bedienungsanleitung gegenwärtiger Auseinandersetzungen liest sich folgender Gedanke des gebürtigen Leipzigers, der viel Lebenszeit in Hannover verbrachte und dort auch starb: „Woher weißt du, dass deine Vernunft besser ist als meine? Welches Kriterium hast du für die Wahrheit?“
Apropos Hannover. Auch die berühmten Leibniz-Kekse aus dem Hause Bahlsen haben mit Gottfried Wilhelm Leibniz zu tun, wie auf der Homepage des Unternehmens nachzulesen ist: „1891. Geburt des LEIBNIZ Cakes. Hermann Bahlsen bringt den LEIBNIZ Cakes auf den Markt. Da es allgemein üblich ist, Nahrungsmittel nach bekannten Persönlichkeiten zu benennen, gibt er seinem Butterkeks den Namen des bekannten Einwohners Hannovers: Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716).“ Nur echt mit 22 Zähnen und ohne t dazwischen – eben wie Leibniz, der Namensgeber. Der schrieb seinen Familiennamen allerdings tatsächlich erst ab 1671 so. In frühen Schriften anderer Autoren hieß er – analog zu demjenigen seines Vaters, Friedrich Leibnütz, und dessen väterlichen Vorfahren – auch „Leibnütz“ oder auch „Leibnitz“ sowie Godefrid Guilelmus Leibnitius auf Latein. Aber das wirklich nur nebenbei.
Viel Spaß beim Lesen, beim Keks-Probieren und vielleicht beim besseren Kennenlernen eines Universalgelehrten, einen schönen Frühling und bis demnächst.
EDITION digital war vor 25 Jahren ursprünglich als Verlag für elektronische Publikationen gegründet worden. Inzwischen gibt der Verlag Krimis, historische Romane, Fantasy, Zeitzeugenberichte und Sachbücher sowie Kinderbücher gedruckt und als E-Book heraus. Ein weiterer Schwerpunkt sind Grafiken und Beschreibungen von historischen Handwerks- und Berufszeichen sowie Belletristik und Sachbücher über Mecklenburg-Vorpommern. Bücher ehemaliger DDR-Autoren werden als E-Book neu aufgelegt. Insgesamt umfasst das Verlagsangebot, das unter www.edition-digital.de nachzulesen ist, mehr als 1.000 Titel (Stand März 2020). Alle Bücher werden klimaneutral gedruckt.
EDITION digital Pekrul & Sohn GbR
Alte Dorfstraße 2 b
19065 Pinnow
Telefon: +49 (3860) 505788
Telefax: +49 (3860) 505789
http://www.edition-digital.de
Verlagsleiterin
Telefon: +49 (3860) 505788
Fax: +49 (3860) 505789
E-Mail: editiondigital@arcor.de
![]()