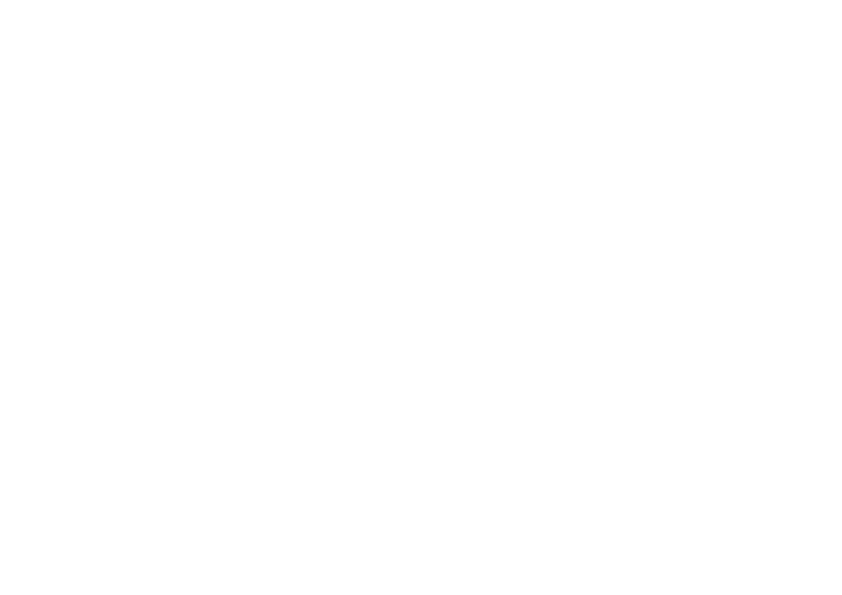Mit einer schrecklichen Katastrophe im Kosmos beginnt „Die Kristallwelt der Robina Crux“ von Alexander Kröger. Wie geht es weiter? Hat die junge Kosmonautin noch irgendeine Chance?
Ebenfalls von Alexander Kröger stammt „Die Engel in den grünen Kugeln“. Allerdings verhalten sich diese „Engel“ gar nicht engelhaft, sondern sehr kriegerisch.
In „Lea – Ein Leben im Sperrgebiet“ erzählt Dorothea Iser von einem Mädchen, dass es im Leben nicht leicht hat und sich gegen viele Widerstände durchsetzen muss.
Jan Flieger lässt seinen Helden in „Sternschnuppen fängt man nicht“ eine schwere Zeit durchleben und über die Liebe und den Sinn des Lebens nachdenken.
Ganz Ähnliches passiert einer Ärztin und dem Fahrer eines schwer verunglückten Kombinatsdirektors in dem Roman „Die Neigung“ von Uwe Berger.
Soweit die aktuellen Sonderpreisangebote. Zum Normalpreis dagegen ist der aktuelle Beitrag der Rubrik Fridays for Future zu kaufen. Jede Woche wird an dieser Stelle jeweils ein Buch vorgestellt, das im weitesten Sinne mit den Themen Klima, Umwelt und Frieden zu tun hat – also mit den ganz großen Themen der Erde und dieser Zeit. Und da hat die Literatur schon immer ein gewichtiges Wort mitzureden und heute erst recht. Aus Anlass der 80. Wiederkehr des Beginns des von Hitler angezettelten Zweiten Weltkrieges am 1. September 1939 befasst sich der Fridays-for-Future-Newsletter gegenwärtig mit dem Thema Krieg und Frieden: Wie und warum „entstehen“ eigentlich Kriege? Und was erleben Menschen im Krieg? Eine bemerkenswerte Antwort darauf gibt in dieser Woche ein neues, sehr berührendes Buch von Manfred Kubowsky, das auf authentischen Dokumenten beruht und das als Mahnung an den Beginn des Zweiten Weltkrieges vor 80 Jahren zwischen dem 30. August und dem 1. September im E-Book-Shop www.edition-digital.de kostenlos heruntergeladen werden kann.
Erstmals Mitte dieses Jahres veröffentlichte Manfred Kubowsksy als Eigenproduktion der EDITION digital seinen Briefroman aus der Zeit der Schlacht um Moskau (1941) „Hellblaue Blitze vor rotem Himmel“ – sowohl als gedruckte Ausgabe wie auch als E-Book: 23 Original-Feldpostbriefe, die eine junge Berliner Pianistin ihrem Liebsten an die Front vor Moskau schickte, haben sich von 1941 bis heute erhalten. Erschütternde Zeugnisse tiefer Liebe, verbunden mit angstvoller Sorge um den geliebten Mann, der zunächst noch in naivem Vertrauen, bald aber erfüllt von Zweifel und Wut, für Hitlers Wahnsinns-Blitzkriegs-Idee vor Moskau in Dreck und Schnee steckt …
Die Briefe reflektieren zunehmend und erstaunlich offen auch die Gräuel des Naziregimes und Kriegserscheinungen wie Rationierung von Lebensmitteln und Bombenangriffe an der „Heimatfront“ Berlin. Die Kapitel zwischen den Briefen aber erzählen realistisch und packend vom Frontgeschehen, vom siegessicheren Beginn des Moskau-Feldzuges bis zu seinem sehr bitteren Ende nach nur wenigen Monaten. Hier der Anfang dieses berührenden Buches, in dem Autor Manfred Kubowsky die Hintergründe dieses Projektes erklärt und seine Hoffnung auf ewigen Frieden:
„1 Die Briefe. Ein Prolog
Sie wären fast vermodert, zusammen mit dem uniformierten, leblosen Körper des Soldaten. Nicht mehr liebevoll ans Herz gedrückt, sondern verfault, zerfallen in der blutgetränkten Erde vor Moskau.
Sicher hatte der tote Soldat die Rufe des deutschen Exil-Schriftstellers nicht gehört, der von der sowjetischen Seite aus mittels eines Megafons die Deutschen aufforderte, den sinnlosen Kampf zu beenden
Nun kniet der Autor vor ihm …
Er nimmt dem toten Gefreiten die Erkennungsmarke ab.
Der Soldat hat nichts dagegen …
Sanft zieht er dann die Hand aus dem Innern der Uniformjacke.
Die starre Hand umklammert ein Päckchen kleiner, hellblauer Feldpostbriefe.
Der Autor entnimmt die Briefe der starren Hand, ganz sachte, sanft, aber mit notwendiger Kraft. Der tote Soldat hat nichts dagegen …
Feldpostbriefe:
An den Gefreiten
Hans Treskatis
07862 D
Feldpost, keine normale Post. Das hat nichts mit dem Feld zu tun, das der Bauer bestellt. Hier geht es um das Feld der sogenannten Ehre.. .es ist das Feld, auf dem nur einer Ernte hält: der Tod.
Der tote deutsche Soldat wird begraben werden, irgendwie, man hofft es.
Der deutsche Schriftsteller in Filzstiefeln und wattiertem weißem Mantel schaut kurz in den ersten Brief.
Der tote Soldat hat auch dagegen nichts …
Geheimnisse. Süße Geheimnisse. Liebesbriefe, Sorgenbriefe aus Berlin. Die Briefe der fleißigen Schreiberin vom Pariser Platz.
Im Augenblick des Todes hatte Hans in die Uniformjacke gegriffen, die Briefe umklammert, vielleicht mit einem letzten hoffnungsvollen, sinnlosen Gedanken:
Eli, du und deine süßen, lieben Briefe, lasst mich nicht sterben für diesen Wahnsinn, lasst mich leben für euch, für dich, bitte …
Der Autor mit dem weißen Mantel konnte Hans und seine Kameraden nicht retten.
Aber er rettet die Briefe.
Verlässt das „Feld der Ehre“.
Verwahrt sie sorgfältig unter seinem Mantel. Nimmt sie mit nach Moskau.
Feldpostbriefe.
Hellblaues Schreibpapier und ebensolche Umschläge in kleinem Format, kauften die Lieben in der Heimat in den Schreibwarengeschäften. Konnten die Briefe portofrei an die Front schicken. Portofrei! Welch ein Vorzug! Nur leider wurden die meisten dieser portofreien Briefe zerfetzt oder verbrannt mit ihren Empfängern. Die an Hans Treskatis geschriebenen blieben erhalten.
2015, siebzig Jahre nach Kriegsende, als ich dieses Buch schrieb, sahen die Briefe noch wie neu aus. Auch heute, fast achtzig Jahre seit dem Beginn des 2. Weltkrieges, liegen die Briefe vor mir wie gerade geschrieben: saubere Blätter, eng bedeckt mit der klaren, steilen Handschrift der Elisabeth Hoernemann, der jungen Pianistin, die in Berlin am Pariser Platz wohnte, ziemlich nahe an Reichskanzlei und Führerbunker …
Hitler hatte eine Woche vor Beginn des Moskau-Feldzuges zu seinen Generälen gesagt:
Was ich von Ihnen verlange, ist nur eins: die Tür mit einem kräftigen Stoß einzutreten. Das Haus fällt dann ganz von allein zusammen!
So begann der Blitzkrieg.
Es ging tatsächlich alles recht schnell.
Stalin zog sich zurück. Sammelte Kräfte. Entwickelte Strategien. Nach einem halben Jahr hatte Hitler die Blitzkriegsschlacht verloren. Das Haus war nicht zusammengefallen. Die Deutschen zurückgeworfen. Zurückgelassen auf der blutgetränkten Erde: unzählige Gefallene, deutsche Soldaten, von Kugeln durchsiebt, von Granaten zerfetzt, von Panzern zermalmt, in Schnee und Eis begraben; manchmal ragten Teile von den Gefallenen heraus aus dem Eis, ein Arm, ein Fuß, bis „General Winter“ sie mit neuem, barmherzigen Schneefall bedeckte.
Der deutsche Schriftsteller Willi Bredel, gebürtiger Hamburger, ehemaliger Häftling im KZ Hamburg-Fuhlsbüttel, Pazifist, Emigrant, Frontagitator gegen den Krieg, rettet Elisabeths Briefe aus der Hand des toten Gefreiten …
Wieder in Moskau, liest er sie, ist erschüttert: Dreiundzwanzig Briefe, eng beschrieben, zwischen Juli und Oktober gesendet an ihren geliebten Hans an der Ostfront.
Die junge Berlinerin bangt um ihren Geliebten, spricht ihm Mut zu, ist überzeugt, sie werde ihn wiedersehen, ihn gesund in die Arme schließen; all das Schreckliche wird Vergangenheit sein und vergessen, auch jene furchtbaren Ereignisse in Berlin …
Ja, vom ersten bis zum letzten Brief schreibt sie nicht nur von ihrer Liebe und von einfachen Dingen des Tages, nicht nur von ihrer Angst und Sorge um ihren Liebsten; sie schreibt auch zunehmend offener über Dinge, die sie hier im „friedlichen Berlin“ erlebt: von Rationierung der Lebensmittel, von der Diskriminierung von Juden, der Häufung von Todesanzeigen in den Zeitungen, schreibt von bekannten Leuten, die plötzlich einfach verschwunden sind, von beginnenden Bombenangriffen und angstvollem Ausharren in Luftschutzkellern …
Manchmal schreibt sie so offen in ihrer gewachsenen Verzweiflung, dass man sich wundert, dass die Briefe die Zensur passierten …
Nach der Kapitulation Nazideutschlands im Mai 1945 kehrt der Schriftsteller Willi Bredel zurück in die Heimat; er kommt über Rostock nach Mecklenburg-Vorpommern, mit ihm die Briefe.
Er gründet in Schwerin zusammen mit dem Pfarrer Karl Kleinschmidt und dem Grafiker Herbert Bartholomäus und anderen antifaschistischen Kulturschaffenden den „Kulturbund zur demokratischen Erneuerung Deutschlands“. In den folgenden Jahren sind seine Tage durch unglaubliche Arbeitsfülle gekennzeichnet; die Briefe geraten zunächst in Vergessenheit. Doch um 1950 herum recherchiert er intensiv, um eventuell Elisabeth und ihre Angehörigen zu finden, vergeblich.
Bredel geht später nach Berlin, wird Präsident der Akademie der Künste der DDR, gerät zunehmend in Widerspruch zur Doktrin der Ulbricht-Partei, regt sich oft sehr auf über Engstirnigkeit und Intoleranz auf, erleidet 1964 mit nur 62 Jahren einen tödlichen Herzinfarkt.
Seine schwedische Ehefrau May, nun Witwe, lebt jetzt allein in der großen Wohnung in der Berliner Ifflandstraße, umgeben von Bredels riesiger Bibliothek, in der irgendwo Elisabeths Briefe schlummern.
Fast dreißig Jahre später.
May ist in einem Pflegeheim, die Tochter muss die Wohnung auflösen. Ich werde gebeten, Bredels Bibliothek zu katalogisieren und nach Schwerin, der langjährigen Wirkungsstätte des Autors, zu schaffen. Am letzten Tage meiner Berliner Arbeit halte ich die Feldpostbriefe in der Hand. Ich frage die Tochter: Was soll damit geschehen?
Nimm sie an dich,
meint sie,
der Vater wollte etwas draus machen, ist nicht dazu gekommen; vielleicht gelingt es dir …!
Ich nehme die Briefe nach Schwerin mit. Lese sie, bin erschüttert. Lege sie weg. Andere, immer neue Aufgaben bewegen mich, unter anderem meine Arbeit im Kulturbund in Mecklenburg, dem ich später einige Jahre als Präsident vorstehe, bis zum Jahre 1990 …
Wieder vergeht viel Zeit, 25 Jahre!
Wieder mahnen, erinnern mich die Briefe, sie irgendwie zu veröffentlichen, doch erst 2015, nachdem meine Frau mich nach schwerer Krankheit verlassen hatte, nahm ich sie wieder zu Hand.
Ist es die Verzweiflung über den Verlust, ist es das wieder erwachte Trauma aus der zerbombten Berliner Kindheit, was mich nun treibt? Vielleicht auch das Wissen und Erleben, dass immer noch Gewalt und schreckliche Kriege diese Welt erschüttern?
Die steile Handschrift der Elisabeth Hoernemann muss in den Computer übertragen werden. So erfasse ich erneut die ganze Tragik zweier Liebender inmitten eines verbrecherischen Krieges. Die literarische Nachempfindung der Geschehnisse an der Moskauer Front ergibt sich fast wie von selbst.
Liebe, Hass, Angst, Verbrechen, Hoffnung, Glauben und Irrglauben; und doch immer wieder Hoffnung durch die Liebe …
Inzwischen sind 77 Jahre vergangen, seit die Briefe der eisstarren Hand eines toten deutschen Soldaten vor Moskau entnommen wurden.
Und in diesem Jahre, am 1. September, wird es 80 Jahre her sein, seit der Verbrecher Hitler den schlimmsten Krieg begann, den die Welt bisher gesehen hat.
So bin ich wieder erschüttert.
Bin auch froh, darüber geschrieben zu haben. Glaube, dass das Buch seine Leser finden wird. Hoffe auch, dass so etwas nie mehr geschieht, dass überhaupt alle Kriege aufhören.
Aber wer weiß das schon?
Februar 2019 Manfred Kubowsky“
Und damit zu den fünf aktuellen Sonderangeboten. Erstmals 1997 erschien als Band 137 der Reihe „Spannend erzählt“ im Verlag Neues Leben Berlin „Die Kristallwelt der Robina Crux“ von Alexander Kröger. Dem E-Book liegt die überarbeitete Auflage zugrunde, die 2004 im Eigenverlag KRÖGER-Vertrieb Cottbus veröffentlicht worden war: Wie ein gewaltiger Spiegel ragt plötzlich die Fläche eines Riesenkristalls vor Robina auf. Und obwohl die junge Kosmonautin das Höhenruder zurückreißt, erfolgt Sekundenbruchteile später ein schmetternder Aufprall. Das Beiboot ist auf jenem geheimnisvollen Kristallboliden havariert, den die Besatzung der REAKTOM auf der Heimreise zur Erde entdeckt hat. Bestürzt sucht Robina Kontakt zum Raumschiff, um die Bergung zu veranlassen, doch die Funksignale bleiben ohne Antwort. Etwas Unfassbares ist geschehen. Die REAKTOM ist verschwunden, und Kernstrahlung deutet auf eine Katastrophe. Niemand wird Robina retten können; sie ist allein in dieser unwirtlichen Kristallwelt, viele Lichtjahre von der Erde entfernt. Tiefe Verzweiflung ergreift die junge Kosmonautin, der nur ein Hoffnungsschimmer bleibt: Da ist jenes fremde Funkfeuer, dessen kalte Lumineszenz den Boliden in rhythmischem Abstand aus der Schwärze des Alls reißt. Auch in diesem Falle präsentieren wir den Anfang des Buches – ein schreckliches Unglück geschieht:
„Prolog
In dem Augenblick, als der Pilot offenbar die Gefahr erkannt hatte und das Landeboot zu einem riskanten Durchstart vor der spiegelnden, schrägen Wand zwang, durchbrach ein greller Blitz das pulsierende Dämmerlicht. Ein ungeheurer horizontaler Schub schmetterte das Heck des Bootes auf die glatte Fläche. Das Flugzeug glitt nach oben, und der Rumpf wurde gegen das Spiegelnde geschleudert. Die Trümmer rutschten ein Stück empor, dann, nach dem toten Punkt, die Schräge immer schneller nach unten, wobei sich der verbeulte Rumpf so drehte, dass er längs der Kante zu liegen kam, dort, wo der Kristall aus der Ebene wuchs. Eine der Stabilisierungsflächen schob sich über das Boot, die zweite prallte vor dem Rumpf auf, überschlug sich und schlitterte einige Meter in die Ebene hinein.
Dann herrschte Ruhe.
Rhythmisch pulsierte die kalte Lumineszenz aus unbestimmter Quelle, überzog die bizarre Welt aus reflektierenden Flächen von Kuben und Oktaedern, Quadern und Rhomboedern mit prachtvollem Farbspiel.
Scheinbar rasch zogen in tiefster Allschwärze funkelnde Sonnen.
Das im Lumineszieren matt schimmernde Wrack lag still, würde Teil werden der toten Materie ringsum, eingerieselt von splittrigem Kristallschutt.
- Kapitel
Zuerst fühlte Robina das Pochen in den Schläfen, danach den Drang des Blutes zum Kopf. Der übrige Körper erfühlte sich, als ob er schwebe.
Dann gelangten Bilder ins Bewusstsein, wirr und ungeordnet: Boris winkt – die Mundwinkel leicht nach unten gezogen, als blicke er geringschätzig, die Augen, als sähen sie längst anderes – wie in jenen Tagen, als ihn die Gemeinsamkeit ungeduldig werden ließ …
Da steht Ed, gebeugt, lächelnd unter dem Schmerz des kranken Wirbels. Er streicht über ihren Arm beim Abschied, Ed, den sie lange nicht sehen und nur durch 100 Ohren wird sprechen können.
Und da beugt sich Frank zu ihr, klopft vor dem Ausschleusen auf den Schutzanzug: „Mach’s gut, Robi!“ Die Trennung wird nur kurz sein.
,Mein Kopf – zu tief – der Druck … Was ist …?’
Robina durchfuhr es siedendheiß: ,Frank!’
Und dann etwas anderes: Der Bolzplatz. Knapp vor dem Gesicht wischt der Boden aus gewaschenem Sand und glasklaren Plast-Oolithen vorbei. Die langen Haare ziehen eine feine Spur.
Empörte Passanten lösen den Knoten des Strickes, der die Füße des baumelnden Mädchens verbindet und der dazu diente, hängend über das Seil zu hoppeln. Und sie bedauern das ach so zarte, hübsche und jetzt wütend weinende Kind, dem das Blut zu Kopfe gestiegen ist, und sie schimpfen auf die rüden Bengel, die aus sicherer Entfernung grinsend die Szene beobachten.
Dabei hatte Robina gar nicht geweint, weil sie mit dem Kopf nach unten hing, wie die Leute annahmen; sie wäre allemal in der Lage gewesen; bis zur Seilstütze zu hoppeln und sich dort empor zu hangeln. Nein, Ed, der liebe Bruder, hatte, ihre Lage schamlos ausnutzend, ihrer Sportpuppe den Akkumulator entnommen und ihn seinem Maulwurf einverleibt, der beim Wettgraben am langsamsten schaufelte.
Natürlich gab es beim Hoppeln einen Blutandrang zum Kopf hin – wie im Augenblick …
Langsam, ganz langsam formte sich die Frage: ,Wo bin ich? Was, was ist geschehen?’
Robina öffnete die Augen; sie spürte Schmerzen im Nacken; das Pochen lief durch Hals und Kopf. Was sie sah, war wenig. Sie benötigte Sekunden, um sich zu orientieren. Dann begriff sie: Sie lag vor dem Steuersitz des Beibootes, der beängstigend schräg über ihr hing. Ihr linkes Bein klemmte verdreht zwischen Steuerung und dem Schalenrand des Sessels, der Helm stieß gegen die Pedale. Robina übersah ein Stück der Kabinendecke, des Sessels und die Armaturenverkleidung von unten. Platzangst überfiel sie. ,Aufstehen!’, befahl sie sich, ,sehen!’ Aber auch als sie sich mühevoll aufgerichtet hatte, überblickte sie nur wenig mehr.
Sie brauchte eine Weile, um zu begreifen, dass es sich bei der grau glänzenden Wand vor der Bugscheibe um einen Teil des Bootes selbst, eine der Stabilisierungsflächen handelte. Rhythmisch zuckten darüber Streulichter der geheimnisvollen Lumineszenz des Boliden.
Robina durchlief abermals ein Angstschauer. Sie wandte sich zum Mikrofon und musste dazu den Kopf in eine unbequeme Lage drehen. Betont forsch sagte sie: „Hallo, Frank?“ Sie konnte nicht verhindern, dass die Stimme zitterte, der Ruf belegt klang.
Und noch etwas irritierte: Sie hörte ihre eigene Stimme nicht über das Außenmikrofon des Anzugs. Wieder ergriff sie eine Angstwelle, als ihr bewusst wurde, dass die Hermetik der Kabine gestört sein musste.
,Die Gefährten holen mich hier weg!’
Sie lauschte auf das beruhigende Summen der Sprechanlage des Anzugs. Hier schien alles in Ordnung zu sein.
„Hallo, Frank!“
Stille. Außer diesem feinen Summen – Stille …
Robinas Blick glitt unstet über die Armaturen. Die Zeiger standen auf Null. Die Signallampen, unheimlich dunkel, tot in den Fassungen, beschworen abermals Bangigkeit herauf.
„Hallo, Frank, Stef!“
Robina spürte, wie Schweiß ausbrach, wie die Kopfhaut zu prickeln begann.
„Mandy?“
Sie lauschte nicht mehr, ob das leise Summen von einer vertrauten Stimme durchbrochen würde. Sie schrie: „Frank, zum Teufel, so melde dich doch!“
Nichts.
Plötzlich klatschte sich Robina die behandschuhte Linke an den Helm. „Drehst durch, Robi“, sagte sie laut, und sie hielt sich die Uhr vor das Helmfenster. „Sie können dich nicht hören, absoluter Funkschatten – noch siebenunddreißig Minuten, Mist!“
Erleichtert atmete Robina auf. ,So ein Unsinn. Ein wenig havariert, und gleich spielt man verrückt. Es hätte doch schlimmer kommen können. Ich lebe, bin wohlauf, in dreißig Kilometer Entfernung sind die Gefährten, die schön verschnupft sein werden über den Schrotthaufen, den ich fabriziert habe.’
Robina betätigte Schalter, zuckte mit den Mundwinkeln, als sie den implodierten Bildschirm wahrnahm. ,Nichts mehr zu machen mit dem schönen Boot’, dachte sie. ,Zeit, dass wir heim kommen!‘
Aber warum? Wie konnte das überhaupt geschehen?’ Robina versuchte sich zu erinnern. Zunächst ließen sich die Bilder nur schwer ordnen bei dem dumpfen Gefühl im Kopf: Unversehens hatten sich die Konturen des Landezeichens aus der strengen Geometrie der Kristalle gelöst. ,Na, setze ich eben ein wenig später auf; zieht sich doch weit, diese ebene Landefläche. Dort das Massiv. In dem befindet sich die Grotte. Da werde ich eben wenden, hinfahren, ausladen …’
Da – Robina fühlt, wie ihr die Haare zu Berge steigen. Von vorn, gleichsam aus dem Boden, stürzt ein Beiboot wie das ihre auf sie zu, kommt rasend näher.
Ohne Überlegung reißt sie am Höhenruder. Das Boot reagiert.
„Jawohl, es hat reagiert!“, rief sie laut, aus ihrer Erinnerung auftauchend.
Auch das zweite Boot vor ihr stieg, sie sieht deutlich die Unterseite des Rumpfes und die Stabilisatoren.
,Mein Spiegelbild!’, durchfährt es sie.
Da kam die Lichtwoge, der verdammte Schub …
Robina fand in die Wirklichkeit zurück.
,Blitz? Hatte es überhaupt einen Blitz gegeben? Oder entstand der nur beim Aufprall – so wie Sterne bei einem Schlag auf den Kopf? Jedenfalls habe ich das Boot an die Fläche eines dieser miesen Riesenkristalle gesetzt. Schweinerei! Das werde ich wohl verantworten müssen.’
Die Aussicht auf ein Disziplinarverfahren wurde von dem Glücksgefühl, die Havarie unbeschadet überstanden zu haben, verdrängt.
,Nur schade um das Boot. Aber es wäre schon dumm gewesen, jetzt, da wir auf dem Heimweg sind, sich noch etwas zuzuziehen oder den Gefährten gar eine Leiche zu bescheren.’
Robina probierte systematisch ihre Gliedmaßen durch und stellte abermals erfreut fest: außer einem leichten Ziehen im Nacken und einem dumpfen Brummen im Kopf fühlte sie keinen Schmerz.
,Ich müsste aussteigen’, dachte sie, ,mir das Ganze von draußen betrachten.’
Sie musterte die Kabine eingehend: Großflächige Beulen, die von außen die Verkleidung deformierten, Geräte aus den Halterungen gerissen. Die Tür zum Laderaum stand halb offen. Robina hangelte hin. Die Sauerstoffflaschen lagen durcheinander, Konservenboxen dazwischen, einige geplatzt, ihr Inhalt klebte an Kanistern und Dosen.
Dann blickte Robina ungeduldig zur Uhr. Es fehlten noch zehn Minuten. Erfahrungsgemäß kam aber, wenn auch qualitätsgemindert, in einer solchen Konstellation die Funkverbindung bereits zustande, wenn es keine Überlagerungen durch das fremde Funkfeuer gab.
Robina nahm eine bequemere Haltung ein und war fest entschlossen, nun zu senden, bis die Verbindung stand. Stereotyp rief sie im Abstand von je einer halben Minute. Sie lauschte in der Gewissheit, dass sie trotz des eigenartigen Knatterns eine Antwort nicht überhören würde.
Jedoch wuchsen nach Minuten vergeblichen Rufens Erregung und Konzentration. Sie spürte unwillkürlich Unruhe aufsteigen. Die augenblickliche Konstellation zwischen dem Boliden und dem Raumschiff verhinderte wohl die Verbindung, vielleicht schirmte auch die über das Wrack geschobene, abgebrochene Stabilisierungsfläche zu sehr ab, oder aber der Rumpf lag so ungünstig, dass zusätzlicher Funkschatten entstand, oder der Kristall selbst …
Robina zwang sich zur Ruhe. „Hallo, Frank!“, rief sie gleichförmig.
Dann drängten sich ihr die Namen der anderen Gefährten in den Sinn: Sie rufen! Frank hatte mit ihr Verbindung zu halten. Aber jeder andere, der sie hörte, würde sich ebenfalls melden.
Aufreizend langsam tropften die Ziffern der Uhr. Dann kam die Zeit, zu der Funkmaximum herrschen musste. Robinas Stimme begann zu zittern. Unter großer Beherrschung ließ sie noch einige Minuten verstreichen, danach rief sie, rief …
Dann dachte sie abermals: ,Ich muss hier raus, es ist doch klar, dass hier etwas nicht stimmt, etwas nicht funktioniert. Sie können mich nicht hören! Sicher rufen auch sie bereits.’ Noch bevor sie erwogen hatte, ob sie die Funkkonstellation noch bis zu deren Ende abwarten oder sofort aussteigen sollte, zwängte sie sich zur Schleuse. Ihre Bewegungen wurden hastiger, dazwischen rief sie, nun lauter, weil sie sich von der Bordsprechanlage entfernte, ungeachtet dessen, dass in der Kabine der Schall nicht mehr übertragen wurde.
Sie kam trotz der Schräglage ohne Schwierigkeiten in die Schleuse, und dort stellte sie fest, dass die Außenluke klaffte. Erst jetzt wurde ihr bewusst, dass ihr Ruf in den letzten Minuten die Gefährten gar nicht hatte erreichen können: Mit neuer Hoffnung schaltete sie die Funkanlage des Raumanzugs ein und rief mehrmals hintereinander. Aber auch jetzt als Antwort nur das leise Summen und das eigenartige Knattern, die im Geräusch ihres Atems fast untergingen.“
Elf Jahre vor „Robina“, erstmals 1986, hatte Alexander Kröger ebenfalls im Verlag Neues Leben Berlin und zwar als Band 199 dessen Reihe „Spannend erzählt“ seinen Wissenschaftlich-phantastischen Roman „Die Engel in den grünen Kugeln“ herausgebracht. Dem E-Book liegt die Originalausgabe von 1986 zugrunde. Bei der Wiederauflage wurde lediglich auf neue Rechtschreibung umgestellt: Dicht presst sich Igor Walrot an den Boden, während ringsum die todbringenden blauen Blitze aufzucken. Etwas Unbegreifliches ist geschehen. Da sind in Nordeuropa fremde Raumschiffe gelandet und überziehen die Erde mit Krieg. Viele meinen, dass es sich bei den Auseinandersetzungen um ein Missverständnis handelt, und wollen die Fremden wie Gäste begrüßen, doch Igor glaubt nicht an die Friedfertigkeit der Besucher aus dem All. Bestärkt wird er in seiner Meinung von Dagmar, jenem dunkelhaarigen Mädchen, das immer in der vordersten Kampflinie zu finden ist. Und so übernimmt er auch den gefährlichen Auftrag, der ihn bis in die Basis der Außerirdischen führt, die seltsamerweise wie Engel aussehen. Kriege sind zum Zeitpunkt der Handlung auf der Erde Geschichte. Es dauert lange, bis die Menschen wirksamen Widerstand leisten können. An einem packenden Einzelschicksal schildert Kröger das leidvolle abenteuerliche Geschehen um die Eindringlinge. „Die Engel in den grünen Kugeln“ ist ein utopischer Roman von 1986, der im Jahre 2000 als überarbeitete Neufassung unter dem Titel „Falsche Brüder“ erschien. Er ist gleichzeitig eine Parallelhandlung zu „Robinas Stunde Null“ von Alexander Kröger. Hier ein Auszug aus dem spannenden Buch, in dem es ziemlich militärisch zugeht:
„Am Spriegelgerüst hatte man eine großmaßstäbliche Karte des Gebiets, in dem wir uns befanden, befestigt, und der Offizier begann zu erläutern, wie der weitere Rückzug taktisch so gelenkt werden sollte, dass der Gegner, der auf einer Front von etwa fünfundzwanzig Kilometern vorrückte, von besiedelten Gebieten und der Straße Utsjoki-Inari weiterhin abgelenkt würde. Die ständige Feindberührung der letzten Tage hätte gezeigt, dass ein solches Vorgehen nicht hoffnungslos zu sein brauchte. „Das Ziel der Angreifer ist offenbar Inari“, er zeigte die Siedlung im Süden der Karte, einen Ort unter fünfhundert Einwohnern, „hier sind wir im Augenblick, und hier entlang wollen wir sie haben. Freilich, wir müssen mit weiteren Verlusten rechnen. Aber ihr begreift, dass es um mehr geht.“
Er erläuterte konkrete Handlungen, die bei diesem und jenem Verhalten des Gegners eingeleitet werden sollten, und dann wurde die Mittagsmahlzeit ausgegeben.
Die Erläuterungen wurden von den Kämpfern widerspruchslos aufgenommen. Doch ein Blick in die Gesichter hätte jedem klargemacht, was sie von der Wirksamkeit all dessen, was da geplant wurde, hielten.
Ich zog mich mit meiner Assiette in den Schatten zurück, saß neben Hugh, vor mir hockten drei meiner Kameraden, die mit mir am Vortag zur Truppe gestoßen waren.
„Was aber ist, wenn sie sich nicht beirren lassen?“, fragte einer, es war jedoch ungewiss, ob er überhaupt eine Antwort erwartete. Wer von den Kameraden hätte sie ihm auch geben sollen.
„Wenn wir nur ausreißen, haben sie nicht die geringste Veranlassung, auf ihr Ziel zu verzichten. Sie müssten in eine Wut geraten, die sie hinter uns hertreibt, mit dem Willen, uns zu vernichten.“
„Wenn alles stimmt, was man über sie sagt, haben sie den. Und immerhin, seit wir vor ihnen herlaufen, sollen sie ja langsamer vorrücken. Auch das ist schon etwas, da bleibt mehr Zeit, die Bevölkerung zu evakuieren.“
„Und wenn sie nicht alles besetzen?“
Hugh mischte sich in das Gespräch der Neulinge mit großem Ernst, der im merkwürdigen Gegensatz zu seiner heiteren Gesamterscheinung stand. „Unser einziger Vorteil ist, dass sie so langsam sind. Aber was ihnen in die Hände – weiß der Teufel, ob sie welche haben – fällt, ist erledigt, kaputt oder tot. Nach ihnen gibt es keine Menschen mehr, Jungs, ich habe es oben in Leppälä gesehen. Wenn sie leben bleiben, willenlose, vegetierende Wesen … Und das kann man in diesem langsamen Tempo mit der ganzen Erde machen, sukzessive, ein Dorf, eine Stadt. Lass es zehn, fünfzig oder hundert Jahre dauern. Vielleicht begnügen sie sich mit einem Kontinent.“ Hugh machte eine Pause. Dann setzte er hinzu: „dass sie niemanden in ihre Gewalt bekommen, deshalb sind wir hier. Ich fürchte nur, sie werden unsere Taktik durchschauen, denn wer von dort anreist“, er wies mit einem Kopfheben in den hellen Himmel, „den sollte man nicht unterschätzen.“
Er holte tief Luft. Offenbar überstieg diese lange Rede seine Norm.
„Eben!“ Ein junger Mann, noch neuer als ich, rief es unbeherrscht. „Ein Missverständnis ist das, die größte Dummheit, sich ihnen entgegenzustellen. Ihr werdet sehen …" Er blickte, nach Bestätigung heischend, um sich.
Niemand sprach.
Dann fragte Hugh: „Wer bist du?“
Irritiert antwortete der Junge: „Seppo, Vitala Seppo. Es wird euch leid tun, ihr werdet sehen … “
Ich aß ohne Appetit, lustlos. Zu sehr noch saß mir das Geschehen – noch keine dreißig Minuten her – in den Knochen. Und dieser Hugh hielt hier einen Vortrag wie vom Katheder, zugegeben, zur Sache … Wir sitzen herum, essen Frikassee aus der Assiette, während unterdessen, keine fünfhundert Meter entfernt, ein teuflischer, unerbittlicher Feind, in seinen Absichten und Fähigkeiten nicht erkannt, lauert, vielleicht in diesem Augenblick auf seine schleichende, fast lautlose Art vorrückt, mit Waffen vorrückt, denen nichts entgegenzusetzen ist.
Und überhaupt, dieses lächerliche Häuflein! Ich blickte den Waldrand hinauf und hinunter. Dreißigtausend sollen insgesamt eingesetzt sein – und täglich kommen mehr -, dreißigtausend, die den Feind ständig eingeschlossen halten. In früheren Kriegen bedeutete das im Regelfall dessen Untergang. Hier? Sozusagen ein wandernder Kessel, ein aufwendiges Beobachten mit Menschenopfern. Mehr nicht!
Und dort, wo die Eindringlinge durchgezogen sind, ist alles vernünftige menschliche Leben ausgelöscht. Wir dürfen dies feststellen, versuchen, den Unglücklichen, die leben, zu helfen. Und niemand und nichts konnte es bisher verhindern.
Diese Weisheiten hatte ich aus den „Pausengesprächen“, aus den paar Brocken, die die „Alten“ fallen ließen, die Alten, die nun schon fast vier Wochen „kämpften“. Offiziell erfuhr man nichts Zusammenfassendes, man wusste nicht, was hinter dem Kessel wirklich geschah, wie viele Verluste an der Front eingetreten und wie viele Opfer unter der Bevölkerung zu beklagen waren. Vielleicht funktionierte nicht einmal eine zentrale Berichterstattung. Und niemandem, das wusste ich auch, konnte daraus ein Vorwurf erwachsen. Das Stadium der Verwirrung, der Überraschung, des Unfasslichen war noch nicht überwunden, und dennoch musste man handeln …
Ich hatte meine Portion aufgegessen, wenn auch ohne jeden Appetit. Der gesunde Menschenverstand sagte mir, dass in Situationen wie der meinen die Gelegenheit entscheidend sein konnte. Wer weiß, wann es das nächste Mal etwas zum Essen gab?
Plötzlich klang jenseits des Waldstreifens wieder das knallende Bersten auf. Trotz der Sonnenhelle zuckte blauer Schein über die Fahrzeuge, die Gesichter. Wer noch das Foliengeschirr auf den Knien hatte, warf es von sich, ließ sich zu Boden fallen.
„Aber, aber, Jungs“, rief Hugh in das Geknalle hinein. „Ihr müsst sie doch nun schon kennen. Jetzt legen sie – zugegeben, ein wenig eher als erwartet – ihren Teppich. Zum Glück für uns jenseits des Waldstreifens. Wenn sie aufgehört haben, kommen sie. Bis dahin ist nichts zu befürchten.“ Er kratzte mit dem Löffel letzte Soßenreste aus dem Aluminiumblech und schleckte sie mit Behagen.
Ein wenig beschämt setzte ich mich auf, klopfte Erdklümpchen und Moosteile von meiner Bluse. Andere taten es mir gleich, aber nur soweit sie Hughs Stimme vernommen hatten. Im weiteren Umkreis lagen die meisten, wie ich beim vorigen Angriff gelegen hatte, flach auf dem Boden, als wollten sie sich hineinquetschen. Ein beschämendes und gleichzeitig ein Furcht einflößendes Bild, sinnfällig für die Ohnmacht.
„So“, sagte Hugh, indem er sich mit dem Handrücken den Mund wischte, ganz, als beendete er auf einer Landpartie ein vorzügliches Picknick. Dann stand er auf, spähte durch die Baumreihen, horchte.
„Dacht ich mir’s doch!“, sagte er. Was er sich gedacht hatte, behielt er jedoch für sich.
Durch Hughs Verhalten aufmerksam geworden, lauschte ich. Ja, das musste es sein. Das Bersten klang in dichter Folge, aber einmal links, einmal rechts auf. Sie schossen nicht mehr in diesen vorausschaubaren Linien. Verdammte Hunde! Immerhin hielten sie noch den Streifen ein.
Die Hundertschaftsführer wurden zusammengerufen. Offenbar galt es, der neuen Situation Rechnung zu tragen. Der Befehl lautete dann auch: Rückzug auf anderthalbfache Entfernung zum nächsten zu erwartenden Vorstoß des Feindes, um nicht wie vordem in die Feuerlinie zu geraten.
Na also, dachte ich bitter, das ist doch wieder einmal eine Aktion!
„Komm mit!“, forderte mich Hugh unvermittelt auf.
Als ich verständnislos blickte, wies der Kamerad nach vorn in das Wäldchen hinein. „Du hast sie doch noch nicht gesehen, vielleicht klappt es.“
Einen Augenblick schwankte ich zwischen Angst und Neugier. Schließlich überwog der Wille, die permanente Furcht einfach zu unterdrücken.
Während wir wie Pilzsucher in den Wald eindrangen, war es mir, als nickte Hugh einigen seiner Gefährten zu, auch „alten Hasen“ wie er, und diese schickten sich ebenfalls an, indem sie ihre Waffen aufnahmen, Hugh zu folgen.
Hinter uns klangen Befehle auf, die Truppe rüstete zum weiteren Rückzug.
Mir war, als hemmte etwas meinen Schritt. Ich blieb einen Augenblick stehen, sah mich unschlüssig um.“
Erstmals 1983 erschien im Militärverlag der Deutschen Demokratischen Republik der Roman „Lea – Ein Leben im Sperrgebiet“ von Dorothea Iser: Erzählt wird die Geschichte des Mädchens Lea, das in einem Gebirgsdorf an der Grenze aufwächst. Bei einem Unfall, den sie dort als Fünfjährige hatte, wurde ihr Arm schwer verletzt. Sie weiß, irgendwann wird er steif sein. Das will sie nicht erleben müssen. Sie träumt sich weg. In einer Kinderstadt möchte sie alle, die kein Zuhause haben, aufnehmen. Der Nachbarjunge Josse sagt, was auch werden wird, ich halte immer zu dir. Aber sie müssen sich trennen, weil jeder in einer anderen Stadt studieren wird. Am pädagogischen Institut begegnet Lea Henning Soremba, der als Unteroffizier in ihrem Heimatort gedient hat. Er ist froh und unruhig zugleich, als er Lea wieder trifft. Er will ihr die Angst vor kommenden Jahren nehmen. Sie soll nicht rücksichtslos gegen sich selbst sein, sich nicht abfinden und aufgeben. Sie steigen auf zu neuen Träumen. Da kommt Josse und holt Lea zurück. Er braucht sie, denn er ist völlig verzweifelt, nachdem sein Vater als Kriegsverbrecher entlarvt wurde. Josse kämpft um Lea. In dem folgenden Textauszug begegnen wir Lea auf dem Wege ins pädagogische Institut:
„2. Kapitel
Auf dem kleinen Bahnhof im Thüringischen sammelten sich die Studenten des neuen Kurses. Lea suchte in ihren Gesichtern nach Neugier auf den anderen, Lust auf das Lernen, auf die Arbeit. Sie sah Frau Schmitt, wie sie lächelnd nickte und mit dem Finger über Namen auf der Liste fuhr, die ein Student eingetragen hatte, sah sie wieder lächeln und nicken. Nicken, daran erkennst du sie, hatte Hanne gesagt, die gute Schmitt, stellvertretende Direktorin soll sie inzwischen sein. Stimmte. Immatrikulation also wie jedes Jahr. Zwei Wochen würde Lea in der Burg wohnen, die sie von einer Ansichtskarte kannte. Die hatte ihr Hanne vor sieben Jahren geschickt. Hanne gehörte zu den letzten, die Kindergärtnerin bei der Schmitt wurden. Auch sie hatte ihre Ausbildung auf der Burg begonnen. Das Institut änderte alle paar Jahre das Programm. Zuerst bildete es Unterstufenlehrer aus und bekam danach seinen Namen. Dann zogen künftige Kindergärtnerinnen ein, und nun sollten hier Erzieher ausgebildet werden, solche für Kinder und solche für Jugendliche. Alle zusammen trafen sich, um in dieses Lager zu fahren.
Zwölf Kilometer bis zur Burg, hörte Lea sagen und Stimmen wie, die hat’s gut, als Frau Schmitt zu den Männern in den grünen Wartburg stieg. Der Bus verspätete sich. Wer waren die Männer im Auto?
Rüssel, natürlich. Lea hörte den Namen, und eine Stimme sagte, viel zu gutmütig soll er sein, unser Jumbo. Ich muss schon bitten, war seine Rede, wenn er hilflos vor der Klasse stand.
Wetzel ist der andere, der schlanke, sagte die Schwarzhaarige, die Gundula hieß. Sie strich sich dabei das Haar aus der Stirn. Der soll noch nicht lange dabei sein.
Einen Werkhof wollen sie uns zeigen, war eine andere Stimme zu hören.
In Lea spannte sich die Erwartung bei dem aufregenden Gedanken, zu jenen zu gehen, die in ihrem Leben wenig Halt fanden, geschlagen worden waren, gestoßen, verstoßen, die sich wehrten, indem sie selber schlugen, stießen und verstießen, die nichts glaubten und niemandem trauten. Sie würde irgendwann vor ihnen stehen und nicht sagen können, die Welt ist schön — hört ihr? Sie ist trotzdem schön. Lea könnte sie nicht rütteln, als müssten sie aus einem Albtraum geweckt werden, nicht rütteln, wie sie es mit sich tun musste, wenn sie es selbst vergaß. Wie oft stand sie vor einer Tiefe, ein Schritt nur hätte genügt. Sie ließ auch mal die Arme über dem Abgrund hängen oder die Beine pendeln, vorsichtig rutschend, wie das wäre, dieses endgültige Fallen. Sie zog sich zurück, drückte das nasse Gesicht ins Gras oder wärmte es auf kaltem Stein. Was wir durchhaben mit ihr, hörte sie die Mutter, wozu das alles. Wer will schon nutzlose Sorge gewesen sein. Es ist, als kann man mit diesem Gedanken nicht Ruhe finden.
Kraftverkehr anrufen, sagte einer zu dem Studenten, der auf die Uhr sah. Der antwortete, fünf Minuten warten wir noch.
In diesen fünf Minuten hatte der grüne Wartburg die Vorläufer des Höhenzuges erreicht. Die Straße stieg an und ließ sich dann weich fallen. Noch lag nicht einmal die Hälfte des Weges hinter ihnen.
Hoffentlich klappt es mit den Bussen, sagte Wetzel, während er seine Augustäpfel verteilte. Er wusste, wann die Studenten auf der Burg sein mussten. Danach hatte er seinen Plan entwickelt, präzise, natürlich, so arbeitete er, so lebte er.
Ich denke, auf Ihren Studenten Romma kann man sich verlassen, sagte Frau Schmitt lächelnd. Und wenn’s schiefläuft, muss ihm was einfallen. Eine gute Bewährung für einen, der im nächsten Jahr schon mit eigener Gruppe unterwegs sein kann. Es wird nicht immer alles glattgehen.
Sie wird doch nicht …? Wenn sie die Busse gar nicht bestellt hatte … Ein Verdacht wuchs in Jumbo.
Wetzel dachte, das darf sie nicht, nicht ohne uns zu informieren. Außerdem wäre das Romma gegenüber unfair. Er konnte nicht lange darüber nachdenken, denn er wurde von ihr nach seinen Plänen befragt. Darauf hatte er gewartet, dass er seine Konzeption darlegen könnte. Aber jetzt ärgerte er sich. Warum tat sie überlegen, lächelte ihn an, als wüsste sie längst, was er ihr sagen wollte? Darum fragte er noch einmal nach dem Zeitplan. Wird er zu halten sein?
Warum denn nicht? Frau Schmitt ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. Wir sind auf alles vorbereitet.
Jumbo stellte sich vor, wie die Studenten sich durch die Stadt zum Busbahnhof schleppen. Wie Sonne auf den kahlen Platz brennt und alle auf den Bus hoffen.
Auch Wetzel dachte an die Studenten. Drei Stunden werden sie mindestens brauchen. Ob das der richtige Auftakt ist, bleibt zu bezweifeln. Da kann er das Manuskript in der Tasche lassen, da wird nichts mit seiner Rede.
Frau Schmitt lachte. Als könnte sie Gedanken lesen, sagte sie, es fährt ein Linienbus. Mindestens das wird Romma herausfinden. Wir müssen sie nicht wie Kinder behandeln. Manchmal sind ein paar Härten ganz gut. Den Studenten muss man auch körperlich etwas abverlangen.
Ehe das Lachen aus Jumbos Gesicht verschwand und ehe Wetzel spitze Worte fand, hielt der Fahrer auf dem grünen Randstreifen.
Verdammter Mist, schimpfte er, hätte längst in die Werkstatt müssen.
Er stieg aus, klappte die Motorhaube auf, hoffentlich nicht das Getriebe.
Endlose Pause, ehe er einsteigen ließ.
Wieder aussteigen. Wie lange sie schon festsaßen.
Beunruhigende Frage Frau Schmitts, was, wenn …
Gewissheit dann und Entschluss Jumbos. Laufen!
Halt, der Bus, sagte Wetzel.
Natürlich. Frau Schmitt lachte. Zwei Kurven abwärts die letzte Haltestelle.
Also vorwärts, in diesem Falle rückwärts. Lachte sie denn immer? Tempo, Tempo. Ängstlichkeit kam in Wetzel auf, zu spät zu kommen, den Motor zu hören, der sich mit der Auffahrt quält. Anderes in ihm trat zurück, wurde unwichtig. Er war nur da, um jedes Geräusch wahrzunehmen, das aus dem Tal heraufkam, um es einzuordnen. Hinter ihm die beiden. So erreichten sie die erste Kurve, und dem Ziel nah, bangte er um jedes Motorengeräusch, verärgert vom Lachen hinter sich.
Auf derselben Straße zur selben Zeit sagte die dicke schwarzhaarige Studentin, die Gundula heißt, zu Lea: Wenn das so weitergeht, prost Mahlzeit! Lea blieb stehen, um die Tasche abzusetzen. Ihr Körper schien nur Arm zu sein, an dem die Tasche hing, die sie in den Asphalt ziehen wollte.
Mein Koffer dagegen, die Schwarze stöhnte, und noch den Beutel. Sie wischte sich übers Gesicht. Lea winkte einem Auto.
Hier doch nicht, sagte die Schwarze.
Ich kann nicht mehr, dachte Lea. Diese Tasche, immer an derselben Hand. Die Handfläche brannte ihr von den Griffen. Wenn Josse jetzt mit seiner Jawa käme wie gestern. Sie sah auf ihren Verband. Er war durchblutet.
Sieht schlimmer aus, hatte Josse gesagt. Im ersten Augenblick sieht es immer schlimmer aus, als es ist. An diesen Satz erinnert sie sich gut, obwohl viele Jahre inzwischen vergangen sind, auch an die Stimme, die das fünfjährige Mädchen Lea Kaiser damals damit in die Wirklichkeit zurückholte. Die Wirklichkeit war das Sofa in der guten Stube, auf das sie Lea gelegt hatten. Und die Stimme gehörte Manfred Neubert. Keiner antwortete ihm. Nur Lea schrie, als sie ihn sah. Da fragte er, ob er was für sie tun könne. Den Arzt rufen, ein Auto schicken. Woher sollte er das nehmen? Vater und Mutier standen um Lea herum und schwiegen.
Dafür kann niemand, sagte Neubert. Das ging so schnell.
Was war schnell gegangen? Da war Sonne, ja. Und ein Feuer – ja, Feuer brannte, und Josse, natürlich war Josse dabei. Er röstete Kartoffeln. Qualm zog über das Feld und biss in den Augen. Vater hob mit der Forke Stauden aus, Mutter sammelte und sortierte. Den Eimer für Schweinekartoffeln durfte Lea weitersetzen, bis sie ihn umkippte.
Weil du nicht aufpasst. Erika zog Lea an den Zöpfen und schüttelte sie. Los. Aufsammeln!
Otto dachte, was macht sie denn mit dem Mädchen. Er sagte nichts. Erziehung überließ er ihr.
Dann sollte Lea gehen. Aber nach Hause wollte sie nicht. Hanne würde sie Gänse hüten schicken. Das war langweilig. Zu Josse mit seinen verbrannten Kartoffeln war sie gern gelaufen. Er stocherte in der Glut. Manchmal hörte sie ihn husten. Einfach über den Feldrain hin zu ihm, wo Mutter sie sah? Josse hieß eigentlich Josef, wie sein Vater Sepp und sein Onkel Juschko. Er musste schon morgens in die Kirche, manchmal zweimal am Tag, und er redete ein komisches R und verdrehte die Worte beim Sprechen wie alle seine Verwandten. Am Sonntag trug er weiße Kniestrümpfe — na, wenn die Eltern sie mit dem auf dem Acker sahen. Mutter sagte, Josse verdirbt das Mädchen. Er war ein Jahr älter und traute sich schon zu rauchen, aber an dem Sonntag nicht. Ja, Sonntag war. Er blieb auf seinem Feld und Lea auf ihrem. Mutter jagte sie nicht weg, aber es war langweilig wie bei den Gänsen. Bei Lene Liersch war es nie langweilig. Da gab es den Dackel Hexe mit krummen, kurzen Beinen und die kleinen Katzen. Was macht Sie, Jungfer Katze, schläft Sie oder wacht Sie, piepste Lea, wenn sie zur Lene Liersch kam, die ihr mit tiefer Stimme antwortete:
Da ging die Katz die Tripp die Trapp, da schlug die Tür die Klipp die Klapp.
Dann das helle Lachen der Lene Liersch, die das Mausejunge hinter der Tür hervorzog, auf den Arm nahm, in die Luft warf und wieder auffing. Zu ihr durfte Lea auch nicht mehr, weil Lene Liersch ein raffiniertes Weibsstück war, das sich die Brust hochschnallte. Das hatte Mutter zu Vater gesagt.
Man müsste wie die gelben Blätter fliegen können, die der Wind aufwirbelte und bis in die Wolken trieb. Lea würde ihnen gern folgen. Sie kletterte über volle Säcke auf den Kartoffelwagen. Fliegen, fliegen. Die Mutter drohte. Otto dachte, was verlangt sie denn von dem Mädchen. Er sagte, lauf nur.
Lea rannte mit ausgebreiteten Armen über das Feld, umkreiste den Rain und lief dem Wald zu.“
„Sternschnuppen fängt man nicht“ – so der poetische Titel des Buches von Jan Flieger, das erstmals 1987 ebenso wie vier Jahre zuvor der Lea-Roman von Dorothea Iser ebenfalls im Militärverlag der Deutschen Demokratischen Republik Berlin erschien: Ein Matrose, der auf einem Raketenschnellboot der Volksmarine dient, bekommt einen Abschiedsbrief von seinem Mädchen. Mareike, so heißt das Mädchen, das er liebt, schreibt ihm, dass er sie vergessen solle und dass sie ihren Polterabend mit einem anderen feiern wird. Doch das will sich Brinkmann nicht gefallen lassen. Er bittet um außerplanmäßigen Urlaub und begibt sich auf die lange Reise von der Küste bis zu Mareike und zu diesem Polterabend. Fast verpasst er den Termin, aber dann steht er in dem Saal, wo der Polterabend schon im Gange ist, sieht Mareike und sieht den anderen …
Weitere Informationen finden Sie im Anhang.
EDITION digital wurde vor 25 Jahren von Gisela und Sören Pekrul gegründet und gibt Kinderbücher, Krimis, historische Romane, Fantasy, Zeitzeugenberichte und Sachbücher (NVA-, DDR-Geschichte) heraus. Ein weiterer Schwerpunkt sind Grafiken und Beschreibungen von historischen Handwerks- und Berufszeichen sowie Belletristik und Sachbücher über Mecklenburg-Vorpommern. Insgesamt umfasst das Verlagsangebot, das unter www.edition-digital.de nachzulesen ist, derzeit fast 1.000 Titel (Stand August2019).
EDITION digital Pekrul & Sohn GbR
Alte Dorfstraße 2 b
19065 Pinnow
Telefon: +49 (3860) 505788
Telefax: +49 (3860) 505789
http://www.edition-digital.de
Verlagsleiterin
Telefon: +49 (3860) 505788
Fax: +49 (3860) 505789
E-Mail: editiondigital@arcor.de
![]()