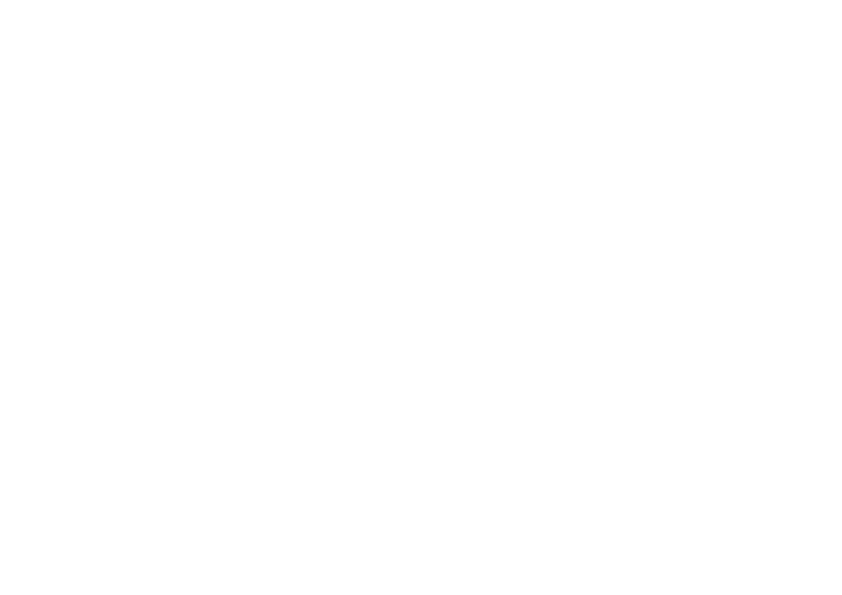In dem Historischen Roman „Das Gottesurteil“ von Heinz-Jürgen Zierke geht es um einen Mord, um einen angeblichen Mörder und um dessen Braut. Was aber ist die Wahrheit?
Das nächste Buch ist nicht zuletzt durch einen damals in der DDR viel gesehenen Fernseh-Mehrteiler bekannt und sogar berühmt geworden – „Das grüne Ungeheuer“ von Wolfgang Schreyer. Außerdem gibt es noch ein Angebot zum Super-Sonderpreis. Mehr dazu am Ende dieser Ausgabe.
Jetzt aber begeben wir uns zunächst mit Lutz Dettmann und seiner Familie auf See und auf eine auf ihre Art abenteuerliche Reise nach Tallinn – und in die eigene Vergangenheit.
Erstmals 2002 erschien im damaligen Schweriner Verlag Stock & Stein „Sommertage in Estland. Aufzeichnungen einer Reise“ von Lutz Dettmann: Im Juli 2000 fährt der Autor mit Frau und beiden Kindern mit der Fähre nach Tallinn, um seinen estnischen Freund Valdur und dessen Familie zu besuchen. Er hatte Valdur als 13-jähriger Schüler kennengelernt, als er bei einer DDR-Freundschaftsreise im Jahre 1974 dessen Familie als Gastfamilie zugeteilt bekam. Zwei Wochen Urlaub verleben beide Familien gemeinsam in Estland. Der Autor lässt uns teilhaben an der mehrtägigen Reise zur Ostseeinsel Hiiumaa, die sie intensiv durchstreifen. Zurück in Tallinn, wird das übrige Estland in Tagesausflügen erkundet: die Ordensburgen in Toolse und Rakvere, die Hermannsburg, Ivangorod, Narva, die Burg von Paide, Schloss Kadriorg, die Altstadt von Tallinn, die unter Denkmalschutz stehende Stadt Kohtla-Järve, die Mitte der 1950er Jahre erbaut wurde, und anderes. Die Reise ist zugleich ein Exkurs in die wechselvolle Geschichte des Landes. Sie führt den Leser zu den Spuren der dänischen, deutschen, russischen und sowjetischen Besatzung. Ordensburgen, Schlösser, estnische Dörfer, historische Altstädte, aber auch alte Bunkeranlagen und zahlreiche Reste sowjetischer Militäranlagen werden nacherlebbar beschrieben. Der Autor schildert die nahezu unberührte Natur und idyllische Dörfer, in denen das Leben scheinbar stehengeblieben ist, aber auch leer stehende Industriestandorte aus Sowjetzeiten und die beginnenden Veränderungen unter dem Einfluss des Westens. Und immer wieder die Gastfreundschaft und Wärme der befreundeten Familie, deren Verwandte und Freunde. Der hier präsentierte Textausschnitt findet sich ein Stück hinter dem Anfang des auf seine Art abenteuerlichen Buches, aber noch auf dem Schiff:
„Sonnabend, 29. Juli 2000
Wie ein Stein geschlafen! Aber der Rest der Familie ist noch besser als ich. Tief und fest schlafen sie den Schlaf der Gerechten. Die Sonne lugt durch einen schmalen Spalt am Rollo vorbei in die Kabine. Draußen ist strahlend blauer Himmel und die Morgensonne spiegelt sich auf dem Wasser vieltausendfach. Na also, es geht doch! Solch Wetter 14 Tage! Unter mir vibriert leicht das Schiff. Es ist erst sechs Uhr. Kein Bootsmann mit der Pfeife wird uns wecken. Ich schnappe mir unseren Estland-Reiseführer und blättere in ihm. Bei den Bildern von Tallinn bleibe ich hängen.
Zum vierten Mal besuche ich nun diese Stadt. 1974, ich war 13, kam ich mit dem Freundschaftszug nach Tallinn. Wir waren vorher einige Tage in Moskau gewesen. Man kurvte uns durch die Stadt, Leninmuseum, Allunions-Ausstellung, Roter Platz. Lenin bekamen wir nicht zu sehen, er wurde gerade renoviert. Aber sonst, alles wollte man uns Pionieren und FDJlern zeigen. Wir waren erschlagen von der Größe Moskaus! Alles war überdimensional: Die Zuckerbäcker-Universität, der Prunk der Metrostationen, die riesigen Plätze. Sterne aus Putz an den Gebäuden, als Mosaik in den Metrostationen, der leuchtende Stern auf dem Spasski-Turm der Kremlmauer. Sterne auf Plakaten – überall Sterne. Bleibende Kindheitserinnerung von Moskau: Die Getränkeautomaten auf den Plätzen. Für eine Kopeke füllte sich der von Tausenden Zähnen zerbissene Plastebecher mit Mineralwasser. Der Durst war so groß, doch ich konnte mich nie überwinden, aus diesen Bechern zu trinken! Moskau kam mir so fremd vor!
Und dann Tallinn. Ich fühlte mich sofort heimisch. Diese Stadt erinnerte mich an Rostock: Die alten Hansekirchen, die wundervolle Altstadt, aber auch die riesigen Neubauviertel. Standen ähnliche Bauten nicht auch in Schwerin und Rostock? Wir wurden aufgeteilt und kamen zu Gasteltern. Sofort wurde ich in die Familie aufgenommen. Valdur, der Sohn meiner Quartiereltern zeigte mir die Stadt, und am Abend führten wir lange Gespräche. Und manchmal zweifelte ich, denn was mir dort erzählt wurde, passte nicht in das Bild, welches uns in der Schule und im Vorbereitungslager vermittelt worden war. Von einem gewaltsamen Anschluss an die UdSSR war nie die Rede gewesen, und von Massenverhaftungen und Deportationen schon gar nicht. Irgendwie stimmte da etwas nicht! Egal, die Tage in Tallinn vergingen wie im Flug. Der Abschied fiel uns allen schwer. Große Wiedersehensschwüre wurden gesprochen, wir wollten uns schreiben.
Und wirklich, zwei Jahre später kam Valdur im Jugendaustausch nach Schwerin. Wir schrieben uns weiter, wurden älter, die Verbindung riss schließlich für Jahre ab. Aber immer, wenn im Fernsehen oder Radio das Wort Estland fiel, wurde ich aufmerksam. 1989 bekam ich beim Umzug Valdurs alte Adresse in die Hände. Neugierde trieb mich, ihm zu schreiben. Und nach Wochen kam Antwort! Die Post hatte schier Unmögliches geleistet, denn seine Eltern waren inzwischen mehrmals umgezogen.
1991, Estland war inzwischen wieder frei, besuchte er uns mit seiner Frau, dann fuhren wir nach Tallinn. Und so hat sich der Kontakt gefestigt, wurde zu einer Freundschaft. Wenn dies unsere ehemaligen Genossen Staatsoberhäupter wüssten! So haben sie ihr Ziel doch noch erreicht: Freundschaft mit den Völkern der Sowjetunion. Gut, die Völkerfamilie gibt es ja nun nicht mehr. Aber, dass unsere Völkerfreundschaft 1993 auch für einen Westautokauf herhalten musste, daran haben unsere weisen Führer wohl auch nicht in ihren kühnsten Träumen gedacht.
Kurz nach acht. Bewegung auf dem Schiff und in der Kabine. Kinderlachen, draußen im Kabinengang. Heute Nachmittag sind wir in Tallinn. Die Vorfreude wird größer. Im Restaurant beim Frühstück herrscht ein babylonisches Sprachengewirr: Russen, Engländer, Deutsche, auch finnische Laute. Esten werden sicher auch unter den Passagieren sein. Aber meine entwöhnten Ohren können noch nicht die estnischen von den finnischen Lauten trennen. Durch die großen Panoramascheiben sieht man das glitzernde Meer. Einige Küstenmotorschiffe sind weit entfernt zu sehen. Dort hinten, das müsste die schwedische Küste sein. Oder sind wir schon weiter? Wir wissen es nicht. Die Kellnerinnen sind freundlich. Das Büfett quillt über. Viel Fisch, Garnelen, eingelegter Hering. Mein Geschmack, auch am Morgen. Aber meine Familie steht mehr auf süße Sachen, und die Gesichter verziehen sich, als ich mit meinem Teller an unseren Tisch komme. Später, wir wollen auf das Panoramadeck, herrscht Gedränge auf Deck 5. Der Tax-free-Shop hat geöffnet und befindet sich fest in finnischer Hand. Es werden Alkohol und Zigaretten gebunkert. Die Preise für Schnaps, trotz Zollfreiheit, für uns jenseits von Gut und Böse. An Bord der Finnjet herrscht nicht nur die finnische Zeit, sondern herrschen auch finnische Preise. Nun können wir auch verstehen, warum die Finnen gestern an der Bar so zuschlugen.
Die Zeit will und will nicht vergehen. Dann vor dem Mittag, wir lassen es ausfallen, denn das Frühstück war so reichlich, ein estnischer Sender im Kabinenradio. Na also, das Ziel ist nicht mehr weit. Jede halbe Stunde läuft ein Titel von Tina Turner im Radio. In Tallinn scheint das Turner-Fieber ausgebrochen sein. Kurz vor 13.00 Uhr – ein Knacken im Lautsprecher. Eine weibliche Stimme kündigt dreisprachig an, dass wir in einer Stunde in Tallinn einlaufen.“
Erstmals 1965 legt Heinz-Jürgen Zierke im Hinstorff Verlag Rostock seinen Historischen Roman „Das Gottesurteil“ vor: Wirbelnde Hufschläge und raue Landsknechtsflüche hallen durch die Heide. Der Heidereiter Peter Schulze ist mit einer Axt hinterrücks erschlagen worden. Der Mordstahl gehört Kersten Pyper, dem Müller von Belling, dessen Braut der Amtshauptmann Valentin Barfuß gefangengesetzt hat. Liebt Barbara einen Mörder? Wird sie ihr Kind in Unehren zur Welt bringen müssen? Die dramatische Befreiung des Mädchens lässt drei Frauen in den Verdacht geraten, Umgang mit dem Satan zu haben. Doch auch die Folterungen bringen kein Licht in die Mordtat. Kersten stellt sich schließlich dem herzoglichen Gericht, weil er die Frauen vor dem Scheiterhaufen retten will. Er wird verstrickt in das Ränkespiel habgieriger Patrizier und landesherrlicher Obrigkeiten. Ein Gottesurteil entscheidet das Ringen um Recht und Gerechtigkeit. Die Liebenden aber, Kersten Pyper und Barbara Dittmers, müssen fliehen: eine Hansestadt öffnet ihnen die Tore. Auch diesmal ist die Handlung des Buches schon ein wenig vorangeschritten. Hoher Besuch ist gekommen:
„Während Kersten Pyper durch die Heide nach Liepe jagte, dass der Stute grünliche Schaumflocken an den Trensenringen herabhingen, stand noch immer die Schar der Bauern und Kossäten auf dem Platz vor der Bellingschen Kirche. Auch die Frauen hatten die Herdfeuer gelöscht, die Mägde die Reisigbesen in die Ecke gestellt und waren den Männern nachgeeilt. Die Kinder folgten ihnen. Sie tollten zwischen den Erwachsenen herum, stießen hier jemand an, traten dort jemand auf die Füße und verstanden von dem, was da vorn vorgelesen wurde, kein Wort. Störten sie zu sehr, waren sie mit Winken und Blicken nicht zur Ruhe zu bringen, erhielten sie wohl auch einen Knuff oder eine Kopfnuss. Sie verlegten ihre Spiele dann um einige Schritte, und nur die Größeren drängten sich neugierig zwischen die Männer und Frauen, die erregt und mit heißen Ohren dem Prediger zuhörten. Die Kälte spürten sie nicht.
Es war dies der Präpositus von Sankt Marien und Sankt Spiritus. Dass er selber kam und nun gar mitten in der Woche, hatte das Dorf auf die Beine gebracht. Wilken Hanen, der Küster, hatte eine Bank aus seinem Hause holen müssen, eine recht breite, auf die sich der füllige Präpositus setzte, und eine Fußbank, auf die der geistliche Herr seine Füße legte, damit er sie sich nicht verkühlte. Noch andere seltene Gäste waren gekommen. Zur Linken des Geistlichen, etwas zurück, stand der herzogliche Heidereiter von Saurenkrug, sein Pferd am Zaumzeug haltend. Seine drei Knechte waren nicht abgesessen. Sie umklammerten ihre kurzen Spieße, als warteten sie nur auf den Befehl, auf die Bauern einzustechen. Ihre Gäule, in den Zügeln kurz gehalten, tänzelten unruhig hin und her; die Erregung der Menschen übertrug sich auf sie. Hätte es einer der mutwilligen Knaben gewagt, sie mit einem Stein zu werfen oder auch nur das widrige Summen der Bremsen nachzuahmen, die Tiere wären davon gesprengt, ohne ihren Reitern zu gehorchen. Aber die drohenden Spieße der Knechte schreckten auch die übermütigsten Knaben zurück.
Der Heidereiter hatte aus seiner Satteltasche eine lange gesiegelte Pergamentrolle hervorgezogen, die er dem Geistlichen übergab, und dieser las nun daraus vor. Der Präpositus las mit hoher, tragender Stimme, wie er es von seinen Predigten in dem weiträumigen Schiff der Marienkirche gewöhnt war. Aber die Bauern, so angestrengt sie ihm auch zuhörten, verstanden ihn doch nur halb. Der Text war lang und hochdeutsch, wie sie es nur aus den Sonntagspredigten kannten — und auch da sprach der Präpositus, wenn er seinen Pfarrkindern so recht die Meinung sagen und ihnen für ihre vielfältigen Sünden die ewige Verdammnis androhen wollte, das heimische Platt. Überdies enthielt das Schriftstück so viel unverständliche, fremdländische Wörter, dass man hätte Advokat sein müssen, wenn man sie alle begreifen wollte. Aber eines verstanden sie alle, vom Schulzen Jürgen Möller bis zu Pawel Rülows schieläugiger Witwe, die schon am Stock ging: was ihnen der gnädige Herr Herzog durch den Präpositus und den Heidereiter auszurichten hatte, bedeutete nichts Gutes.
Und der Präpositus las: „… also hat Seiner Fürstlichen Gnaden, der hohen erheischten Notdurft nach, mit reifem, vollbedachtem Rat, aus allerhand bewegenden stattlichen und ansehnlichen Ursachen, zur Beförderung des gemeinsamen Besten Seiner Fürstlichen Gnaden Landschaft und Hintersassen, Seiner Fürstlichen Gnaden Torgelowschen Wald gänzlich geschlossen und darauf geordnet, dass hinfüro keiner, weder Seiner Fürstlichen Gnaden Bauern, noch sonst jemands, aus gedachtem Walde einige Eschen, Buchen, Eichen, Espen oder Tannen und Kienen weder zu verbauen, noch zu verkaufen oder sonsten in einige Wege hauen solle.“ Unter den Bauern entstand Unruhe. Um den Wald ging es also, um das Holz, das sie brauchten, um am Morgen die Suppe und mittags den Brei zu kochen, um Brot zu backen und an Sonn- und Feiertagen Fleisch zu braten, Holz, mit dem sie im Winter ihre Hütten und Katen heizten. Mit dem Silber, das sie für verkauftes Holz bekamen, bezahlten sie ihre Pacht, und für Holz tauschten sie sich in der Stadt Salz ein und Pajäewalker Bier.“
Das nächste Buch wurde erstmals 1959 beim Verlag Das Neue Berlin unter dem Titel „Das grüne Ungeheuer" veröffentlicht. Es war die literarische Vorlage für den gleichnamigen mehrteiligen Fernsehfilm „Das grüne Ungeheuer“ von Rudi Kurz aus dem Jahre 1962. In diesem und in den folgenden Jahren erschienen beim Deutschen Militärverlag der DDR mehrere überarbeitete Fassungen unter dem geänderten Titel „Der grüne Papst“. Dem hier angebotenen E-Book liegt die überarbeitete Fassung von 1965 zugrunde: Karibisches Meer, Juni 1954: Ein junger Deutscher gerät in Not und schließt sich Männern an, deren Geschäfte er nicht kennt. Schmuggeln sie Rauschgift, plündern sie Schiffe aus, sind es Kidnapper? Die Bande fürchtet keinen Richter, sie hat einen langen Arm – und Flugzeuge, Schnellboote, Sendestationen. Er kann nicht mehr zurück. Von jener Insel auf der Mosquitobank, die ein Piratennest ist, gelangt er in die Hauptstadt einer kleinen Republik zum Haus eines kaffeepflanzenden Greises, durch Urwälder, Tropenflüsse und über Kaktussteppen. Er lebt zwischen Gangstern und Landsknechten, trifft aufrechte Männer und Laffen, dient einem windigen General, dann einem frommen Obersten. Ihm begegnen Hafenpolizei, Indios, Mädchen, Papageien, Spitzel. Er trifft eine glutäugige Schönheit, die ihm die Haut ritzt und seine Spottlust weckt, bevor er sie liebgewinnt. Sie lehrt ihn ihre Heimat sehen; und im Lichte aufdämmernder Erkenntnis findet er sein Gewissen wieder. Wolfgang Schreyer gibt in diesem abenteuerlichen Roman dem Helden selbst das Wort. Darin liegt der besondere Reiz seiner Geschichte.
Halb zeitgeschichtliche Reportage, halb Abenteuerroman, entstand dieses Buch zu einer Zeit, in der die cubanische Revolution noch nicht gesiegt hatte und niemand die Ereignisse in Chile voraussehen konnte. Der gesellschaftliche Hintergrund dagegen, den der Text auch da veranschaulicht, wo Figuren und Handlungen kühn erfunden sind, entspricht überall den Tatsachen. Der Wert des Romans liegt bei aller Unterhaltung, die er dem Leser bietet, in der Information über ein fernes kleines Land (Guatemala) und einen Vorgang scheinbar am Rande des Weltgeschehens, der nicht länger als zwölf Tage Schlagzeilen machte (der von der CIA organisierte Sturz von Jacobo Arbenz Guzmán). Heute erscheint uns dieser Vorgang in schärferem Licht; er gewinnt an Bedeutung, wenn man an die Verbrechen der chilenischen Konterrevolution denkt und an den Überfall der USA auf die friedliche Antilleninsel Grenada im Oktober 1983, der den Putsch der Bananengesellschaft in Guatemala auf erschreckende Weise wieder aktuell werden ließ. Einen Eindruck von den unerwarteten Schwierigkeiten des Helden bekommt der Leser in diesem Textausschnitt:
„Die Hexe im Cadillac
Wenig später saßen wir in einem Espresso. Steve bestellte schwarzen Kaffee, den er nötiger hatte als ich. „Wieso“, fragte er und legte seine riesige Hand auf mein Knie, „steckst du denn in der Klemme, Oberleutnant?“ So hatte er mich damals immer genannt, obwohl ich nie Offizier gewesen bin. Er wusste aber, dass ich bei der Luftwaffe war, und hatte oft seinen Spaß damit getrieben, wenn auch ohne jede Gehässigkeit. In der ersten Zeit fiel es den Siegern schwer, solche Anspielungen zu unterlassen, besonders wenn sie ein Kindergemüt hatten wie Steve. Es war eine sonderbare Sache, nach so vielen Jahren meinen alten Spitznamen wieder zuhören. Mir wurde traurig zumute, als ich hier im Hafen von Savannah um zwei Uhr morgens an die Heimat dachte.
„Dieses Drecknest“, sagte ich, „ist mit Abstand der mieseste Fleck in den ganzen Vereinigten Staaten. Jeder Halunke hier hat einen Elektrorasierer, ist damit zufrieden, braucht keinen neuen, und das Klima soll auch nicht gesund sein. Die ganze Stadt stinkt nach toten Fischen, schon gemerkt?“
„Du kommst vom Thema ab“, antwortete Steve.
„Mir geht’s langsam über die Hutschnur“, sagte ich. „Das sollte man mit den Leuten nicht machen. Da spaziere ich heute Nachmittag die General Green Avenue entlang, immer auf dem Bordstein, und denke über den schlechten Geschäftsgang nach – ich verkaufe Rasierapparate, Steve, das heißt, ich versuche es -, plötzlich merke ich, wie ein cremefarbenes Sportcoupé leise neben mir herfährt. Am Steuer sitzt ein Mädchen, Steve, sieht mich an und lächelt, verstehst du, nur mit den Augen. Himmel, war die süß! Ein Traum, alter Junge. Der Cadillac schnurrt immer so neben mir her, stell dir das vor…“
Er sagte nichts, sondern pfiff durch die Zähne.
„Ich stieg dann ein; wir waren uns beide kolossal sympathisch. Sie hieße Joan, wäre achtzehn und ginge noch aufs College, erklärte sie mir, heute hätten die Sommerferien angefangen, sie sei zu jedem Blödsinn aufgelegt. Als wir in meinem Zimmer ankamen, warf sie sich ohne Umstände aufs Bett, strampelte in der Luft herum und bat mich, schnell noch was zu trinken zu holen. Ich lief über die Straße, denn die Pension ist völlig trocken, und als ich wiederkam, war’s passiert.“ Ich drehte mich um, denn eben traten zwei Männer ein; doch sie kümmerten sich nicht um uns. „Joan stand am Telefon“, fuhr ich leise fort. „Mit zerrauftem Haar, fast nackt, rote Kratzer auf Schultern und Hals; die Bluse war zerrissen, das Bett zerwühlt, eine Vase lag in Scherben. Sie schrie, ich hätte sie mit Gewalt hierher geschleppt, aber das ließe sie nicht mit sich machen, sie würde die Polizei anrufen. Ich begriff überhaupt nichts, sah, wie sie eine Nummer wählte, und hörte, dass sie das Überfallkommando alarmierte. Da hab‘ ich mich aus dem Staube gemacht, ohne Geld, ohne Gepäck; der Schlüssel steckte noch außen, ich sperrte sie einfach ein. Mit hysterischen Weibern werd‘ ich nicht fertig… Vermute, jetzt fahndet die Stadtpolizei nach mir.“
„Worauf du Gift nehmen kannst“, sagte Baxter. „Nur, wenn du meinst, sie war hysterisch, irrst du dich, Sohn. Das ist bloß ihr Geschäft. Die Gesetze sind hart in Georgia; auf Vergewaltigung stehen zehn bis dreißig Jahre Kerker. Da hättest du sie lieber geheiratet, glaube ich, damit sie ihre Aussage ändert. Und bei der Scheidung würde sie ’ne hübsche Abfindung von dir bekommen haben, oder ’ne nette Lebensrente, das hättest du dir aussuchen dürfen. Was glaubst du denn, wovon sie den Cadillac bezahlt?“ Er legte Geld auf die Theke, ich aber blieb sitzen. Ich wagte mich nicht mehr auf die Straße hinaus.
„War ’ne schlechte Idee, in dieses lausige Nest zu gehen“, sagte ich und behielt dabei die Tür im Auge. „Hatte vorher ’nen feinen Job bei der Compañía Dominicana de Aviación. Leider kündigten sie mir im April, weil der Chefpilot Rauschgift geschmuggelt hatte, und sie meinten, ich hinge mit drin. Hätte sonst nie dieses widerliche Pflaster betreten.“
„Du bist geflogen?“, fragte Steve leise, und ich konnte bemerken, dass seine Augen sich weiteten. „Du fliegst noch?“ Er wurde plötzlich ganz munter.
„Als Copilot“, antwortete ich. „Die dominicanische Gesellschaft nahm es mit den Papieren nicht so genau; man konnte was.“
Baxter betrachtete mich zärtlich. „Möchtest hier weg, was?“
„Muss verschwinden, Steve.“
„Lässt sich machen, Oberleutnant.“ Mit einem Ruck stand er auf; ich folgte ihm. Wir gingen in zwei benachbarte Kabinen, über die Trennwand hinweg tauschten wir unsere Jacken, Hüte und Hosen aus. Er gab mir zehn Dollar, auch eine Übernachtungsadresse. Hastig vereinbarten wir, uns am nächsten Mittag vorm Denkmal des Generals Pulaski zu treffen; dann verabschiedeten wir uns und verließen unauffällig das Espresso.
Die Hafenstraßen lagen in tiefer Finsternis, nur an den Fassaden der Amüsierlokale geisterte Neonlicht. Steves elegantes Jackett schlotterte mir um die Schultern, und die Hosen waren zu kurz; immerhin, der Hut passte. Jedes Mal wenn ich Schritte hinter mir hörte, bog ich ab. Doch ich erreichte das neue Quartier, ohne dass man versucht hätte, mich festzunehmen. Savannah ist, wie schon vermerkt, ein erbärmliches Nest. Nicht mal auf die Polizei dort ist Verlass.“
Erstmals 1973 veröffentlichte Elke Nagel (Willkomm) im Verlag Neues Leben Berlin ihre Erzählung aus der Zeit der Hussitenbewegung „Mit Feuer und Schwert“. Das Buch erschien damals wie bereits eingangs erwähnt als Band 114 der Reihe „Spannend erzählt“ und war in der DDR Schullektüre: Böhmen, spätes Mittelalter: Jan fiebert dem Tag entgegen, an dem er endlich die Klosterschule verlassen und seinen Vater suchen kann, der als einer der führenden hussitischen Kämpfer in einem Burgverlies gefangen gehalten wird. Jan will ihn befreien. Zusammen mit seinem Freund Henning flieht er aus dem Kloster und schließt sich dem Heer der Hussiten an, das von Monat zu Monat erstarkt, bis es die Burg zu erstürmen vermag. Jan ist dabei; als einer der Ersten sucht er nach dem versteckten Verlies. Kann er den Vater noch retten? Eine spannende Geschichte aus den ersten Jahren der Hussitenkriege in Böhmen. Und so beginnt diese Erzählung:
„Erstes Kapitel
Die Flamme von Konstanz
Der Junge hetzte durch den Wald, so schnell es das dichte Gestrüpp und seine noch kurzen Beine zuließen. Er hatte seinen Verfolgern einiges voraus: Klein und wendig, ausdauernd, gewöhnt an vielerlei Strapazen, bekannt mit fast jedem Fleckchen dieses Waldes, vergrößerte er seinen Vorsprung von Minute zu Minute. Während die Reitknechte von gestürzten Baumriesen aufgehalten wurden und, einen Durchgang suchend, nach rechts und nach links ritten, erreichte Jan „seinen“ Baum, konnte ihn ungesehen ersteigen und sich in der dichten Krone niederlassen. Es gab hier eine Astgabelung, wie Jan sie sonst noch nirgendwo gefunden hatte, obwohl er vertraut war mit den Kronen vieler Bäume in der Nähe seines südböhmischen Heimatdorfes. Sie war stark und breit auseinandergebogen, sodass ein leichter Bub wie Jan, zwölf Jahre alt, bequem darauf sitzen konnte, angelehnt an ein dichtes Gewirr von Ästen und Blättern. Hoch aufgerichtet aber konnte er ein gut Teil des Waldes überblicken, ohne selbst gesehen zu werden.
Als er sich in Sicherheit wusste und ausruhen konnte, überfiel den Jungen plötzlich eine große Mutlosigkeit. Ihn bekamen sie nun nicht mehr. Nein, ihn nicht – aber den Vater! Hatten sie den Vater schon? Weil sie darauf vorbereitet waren, hatten sie die Männer, die ihnen im Hohlweg auflauerten, zwar frühzeitig bemerkt, aber doch nicht zeitig genug! Der Vater war zur linken Seite den Hang hinauf geflohen, er, Jan, zur rechten. So hatten sie es für diesen Fall ausgemacht, vorher, als der Vater dem Jungen die mögliche Gefahr erklärte. Denn der Vater war gewarnt worden, heute Mittag auf dem Markt in Sezimovo Ústi. Eier, Leinen und Wolle hatten sie verkauft, einen Teil der eingenommenen Groschen wieder für Salz ausgegeben. Da war ein Mann zwischen sie getreten, hatte dem Vater etwas ins Ohr geflüstert, war sofort wieder in der Menge verschwunden. Der Vater hatte kurz, laut und grimmig aufgelacht. Dann waren sie in die enge, winklige Gasse gegangen, in der Simon wohnte, bei dem sie Martinek treffen wollten.
Jan hatte den Mann auf dem Markt – er war klein und bucklig gewesen, mit einem jungen, guten Gesicht – schnell wieder vergessen über dem, was sie bei Simon, dem Schmied, von Martinek, dem Wanderprediger, erfuhren; denn der brachte aus Prag die Nachricht vom Tod des Magisters Jan Hus mit. Der Scheiterhaufen, den die Kardinäle des Konstanzer Konzils ihrem verhassten Gegner angezündet hatten, war vor vierzehn Tagen niedergebrannt, die Asche des „hartnäckigen Ketzers“ in den Rhein gestreut worden, um jedes Andenken an ihn auszulöschen. Aber an diesem Julinachmittag des Jahres 1415, in der kleinen südböhmischen Stadt Sezimovo Ústi, im Holzhäuschen eines seiner armen Bürger, brannte die Flamme von Konstanz weiter.
Sie brannte in Franticek, den man den Albigenser nannte, denn er glaubte, ein Nachkomme jener kühnen Aufrührer zu sein, die vor zwei Jahrhunderten in Südfrankreich gegen Mönche und Pfaffen gekämpft hatten. Sie brannte in Jan, Franticeks Sohn, den seine Freunde „Kleiner Magister“ nannten, weil er klug und redegewandt war und bei ihren Spielen immer Magister Jan Hus sein durfte, seit sie diesen vor zwei Sommern hatten predigen hören vor der Burg Kozi Hradec. Sie brannte auch in dem Schmied Simon, dem Freund aller Armen und Geschundenen, aller Ketzer und aller Aufrührer. Und hell loderte die Flamme des Konstanzer Scheiterhaufens in Martinek, der als Wanderprediger durch das Land zog, weil ihm das Geld fehlte, mit dem er sich hätte eine Pfarrstelle kaufen können. Seinen Predigten lauschten schon seit zwei Jahren Hunderte von Menschen Südböhmens, trafen sich auf freiem Feld oder auf verborgenen Plätzen tief im Wald, denn der Pan, Herr Oldrich von Rozmberk, auch der Abt des St.-Stephan-Klosters, sie schickten Bewaffnete, die Menge auseinanderzujagen.
Martinek, in der Hütte des Simon, sagte mit leiser, vor Erregung heiserer Stimme zu den beiden Männern und dem Jungen: „Sie haben ihn verbrannt, aber er hat die Wahrheit nicht geleugnet. Sie glaubten, sie könnten auch die Wahrheit verbrennen. Dabei sind es nicht Hunderte, sondern viele Tausende, die so denken wie er. Wie könnten sie da die Wahrheit verbrennen? Und überhaupt – sie lässt sich gar nicht verbrennen, die Wahrheit!“
Später, auf dem Heimweg, fragte Jan: „Sag, Vater, sie haben ihn verbrannt, weil er ein Ketzer war. Müssten sie uns da nicht auch verbrennen?“
„Warum?“
„Wer anderes glaubt oder lehrt, als die Kirche vorschreibt, den heißen sie einen Ketzer. Auch wir glauben anderes, gehen nicht mehr zum Pfarrer in die Kirche, sondern halten selbst Gottesdienst, dort hinten im Wald. Und anders als der Pfarrer sprecht ihr dort – Martinek oder du oder wer immer predigt!“
„Recht hast du, Junge“, sagte der Vater, „halb Böhmen ist heute ketzerisch, und ein Lob ist’s für jeden, den man Ketzer nennt! Aber können sie halb Böhmen verbrennen? Und wenn sie’s täten, Junge – es wäre ihr Ende! Wir glauben nicht mehr an die Unfehlbarkeit ihrer Päpste und Pfaffen, an ihre heuchlerischen Reden. Und auch daran glauben wir nicht mehr, Jan, dass unser Elend von Gott gewollt ist und so bleiben muss für alle Zeiten!“
Sie hatten die Stadt hinter sich gelassen und wanderten nordwärts. Der Weg führte durch Wälder und über gerodetes Land, auf dem das Korn schon reifte, über flache Hügel und durch sanft abfallende Täler. Zur Linken schimmerte ab und an die Luznice als silbernes Band durch das Grün der Bäume und Wiesen; zur Rechten grüßte auf einer Anhöhe Kozi Hradec, Zuflucht des Magisters Hus, als der Bann des Papstes ihn vor drei Jahren aus Prag vertrieben hatte.“
Und hier folgt noch ein Angebot zum Super-Sonderpreis von 99 Cents. Gerade frisch herausgebracht hat die EDITION digital „Leben auf Messers Schneide. Die Memoiren von Cartouche, dem Meisterdieb“ des österreichischen Autors Arnold Hiess – und zwar sowohl als gedruckte Ausgabe wie als E-Book: Ein Historiendrama nach dem Leben von Cartouche, dem Meisterdieb von Paris. Sein Kampf gegen alle Konventionen, aber für die Menschlichkeit und für die Liebe. Basierend auf realen Ereignissen in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts schuf der Autor nicht nur einen archaisch-wuchtigen, brillant erzählten Mix aus Survival- und Rachedrama, sondern ein aufwühlendes Sozialepos vor dem Hintergrund des französischen Absolutismus in der ausgehenden Ära von Sonnenkönig Ludwig XIV. Dabei entwickelt sich der Held der Geschichte inmitten aller brutalen Wirren seiner Zeit zu einem hingebungsvollen und leidenschaftlichen Charakter voller Tatkraft für Mitmenschlichkeit und Liebe. Der Autor nimmt den Leser mit auf eine erschreckend gut erzählte Tour de Force: Einmal hineingerissen in das erbärmliche Dasein in den düsteren Armenvierteln von Paris, schnürt einem fast jede Szene gnadenlos die Kehle zu und man wird es schwer haben, vor dem Ende der Geschichte noch einmal in die Normalität des Lebens zurückzufinden …
Arnold Hiess erzählt nicht nur die fesselnde, bildgewaltige Geschichte eines Meisterdiebes aus Paris. Er lässt auch die längst vergessene Welt des geheimnisumwitterten Templerordens wieder auferstehen, mit all ihrer weltumspannenden Mystik, ergreifenden Menschlichkeit – und forscht nach dem bereits lange verloren geglaubten Wissen des alten Geheimbundes. Der Glanz und das Elend des höfischen Absolutismus ist auch der Hintergrund einer großen Liebesgeschichte, deren Botschaft klar ist: Der Tod, so grausam er auch die Liebe zweier Menschen entzweien mag, könnte jedoch am Ende wieder zusammenfügen, was zusammen gehört. Vielleicht sogar für die Ewigkeit …
Zur Einstimmung in die wechselvolle Lebensgeschichte von „Cartouche“ präsentieren wir hier den Anfang des Prologs zu diesem spannend geschrieben Buch, das gleich mit einer Verfolgung beginnt:
„Halt! Du verdammter Dieb!“, schrien die Wachen in die kalte und finstere Nacht hinein. Kurz davor versteckte ich mich in dem Schatten einer verlassenen Schreinerei. Ich war völlig außer Atem und mein Herz raste, da ich mir eine wilde Verfolgungsjagd mit den beiden geliefert hatte. Nun kamen sie immer näher und näher; ich bemühte mich, so gut es ging, nicht zu atmen, und versuchte, mich nicht zu bewegen. Die Rüstungen der beiden waren schwer und machten furchteinflößende Geräusche. Sie wurden immer lauter. Hecheln und Schnappatmung war mittlerweile zu vernehmen und ich dachte, sie sollen bloß weiterlaufen. Bloß weiterlaufen … Immer und immer wieder.
Ich hatte Glück. Ohne mich und das Haus eines Blickes zu würdigen, liefen sie mit tosendem Getrampel in die Dunkelheit hinein. Langsam beruhigte sich mein Herzschlag, und ich machte mich auf den Weg in eine nahe gelegene Scheune, in der ich meistens übernachtete. Gierig packte ich nun den Laib Brot aus, den ich Stunden zuvor bei einem Festmahl der Reichen im Arrondissement Luxembourg in der Nähe des Palastes erbeutet hatte. Hastig verspeiste ich ihn und biss mir, getrieben von meinem grenzenlosen Hunger, mehrmals in die Zunge. Tagelang hatte ich nichts mehr zum Essen gehabt; und es war ein Festmahl …
Eigentlich hatte ich eine lustige Kindheit, und ich trieb trotz der Not der einfachen Leute allerlei Schabernack. Wir wohnten etwas außerhalb der Pariser Stadtmauern, und mein Vater war Weinbauer. Er war ein großzügiger, warmherziger und dennoch sehr strenger Mensch. Meine Mutter liebte uns beide über alles – sie war die wichtigste Bezugsperson meines ersten Lebensabschnitts. Im Jahre 1700 – ich war sieben Jahre alt – bekam ich die Pocken, eine widerliche Krankheit. Ich habe jedoch fast keine Erinnerungen mehr an diese Krankheit, da ich wochenlang fast nur schlief; doch meine Mutter war schwer in Sorge um mich. Viele mit denselben Symptomen starben, doch ich überlebte. Ein Andenken an diese fürchterlichen Tage zierte von nun an mein Gesicht und Teile meines Körpers: Narben. Überall Narben.
Es schien alles so wunderbar zu sein; doch mein Leben sollte sich an jenem Junitag im Jahre 1705 völlig verändern. Ich ging früh zu Bett und war ein glückliches Kind. Meine Mutter sang mir vor dem Einschlafen noch etwas vor, küsste mich auf die Stirn, und löschte die Kerzen …
„Wach auf!“, schrie meine Mutter mit sich überschlagender Stimme, als sie mit donnerndem Getöse die Türe zu unserem Schlafgemach aufriss. Ganz verschlafen und verwirrt schweifte mein Blick durchs Zimmer, als sie das Fenster öffnete.
„Was ist denn los, Mutter?“, fragte ich. Sie beugte sich zu mir herab und weinte. Die Tropfen kullerten in Strömen über ihre Wangen.
„Keine Zeit mehr“, sagte sie mit verängstigter und weinerlicher Stimme, während sie mir über die Wangen streichelte. „Mein Sohn, du musst gehen. Lauf, so schnell du
kannst, und ich hoffe, du verstehst es eines Tages“, fuhr sie fort und drückte mir dabei einen Sack mit Lebensmitteln in die Hand.
In Windeseile zog sie mir Kniehose und Mantel über und zerrte mich ans Fenster.
„Du musst jetzt stark sein“, sagte sie, um kurz darauf „Lauf, so schnell du kannst, LAUF, LAUF, LAUF … “ schluchzend hinzuzufügen, als sie sich fahrig durch ihre volle, kastanienbraune Haarpracht strich. „Egal, was passiert, egal, was geschieht, und egal, was du hörst – dreh dich nicht um. Lauf!“, sagte sie mit versteinerter Miene und in bestimmendem Ton. „Versprich es mir!“, fauchte sie mich an.
„Ja, Mutter, wie Ihr wünscht“, antwortete ich ihr fast artig, und so kletterte ich durchs Fenster ins Freie.
„Je t’aime, meine Junge. Je t’aime … auf Ewig!“, hauchte sie in die Nachtluft hinein, und schloss weinend und ganz erdrückt das Fenster, als sie mir mit ihren braunen Augen einen letzten Blick zuwarf.
Verwirrt, aber dennoch bei Sinnen befolgte ich die Anweisungen meiner Mutter und ging los. In dieser Nacht herrschte große Dunkelheit und Stille, kein Mondlicht schien, dennoch konnte ich mir meinen Weg bahnen, und so streifte ich durch die angrenzenden Weingärten. Ein laues Sommerlüftchen wehte, die Grillen zirpten, und es war noch immer angenehm warm. Eigentlich schien es wie ein ruhiger Abendspaziergang, als plötzlich verängstigte, weinerliche Schreie und Gewinsel dieses Bild trübten. Ich war bereits ein paar hundert Meter von unserem Anwesen entfernt, dennoch konnte man abscheuliches Geschrei und widerliches Stöhnen und Weinen vernehmen, ohne einen genauen Wortlaut zu verstehen. Eine dieser Stimmen war aber ganz klar die meiner Mutter. Sie schrie jetzt so laut, so durchdringend und schauderhaft … Die Schreie sollten mich mein ganzes Leben verfolgen.
Trotz aller Bedenken setzte ich meinen Weg fort, schließlich hatte ich es versprochen. Ich liebte meine fürsorgliche Mutter, ich konnte ihr keinen Wunsch abschlagen. Außerdem hielt ich in meinem kindlichen Leichtsinn alles bloß für ein Spiel.“
Doch natürlich war es alles andere als ein Spiel. Mehr über die Hintergründe dessen, was und warum damals geschah, das sollte Cartouche allerdings erst viel später erfahren. Und auch manch anderes Geheimnis wird im Laufe der Zeit gelüftet …
Es lohnt sich also sehr, diese spannende Lebensbeschreibung zur Hand zu nehmen, die übrigens nur deshalb geschrieben wurde, weil Cartouche seine … – aber nein, wir wollen an dieser Stelle nicht mehr verraten als einem neugierig machenden Newsletter erlaubt ist. Neugierig gemacht haben wir hoffentlich auch auf die anderen vier aktuellen Deals der Woche – von Tallin über Böhmen bis in die Karabik.
Viel Spaß und viel Spannung beim Lesen und Mitfiebern, weiter einen schönen Sommer und bis demnächst.
EDITION digital wurde 1994 gegründet und gibt neben E-Books (vorwiegend von ehemaligen DDR-Autoren) Kinderbücher, Krimis, historische Romane, Fantasy, Zeitzeugenberichte und Sachbücher (NVA-, DDR-Geschichte) heraus. Ein weiterer Schwerpunkt sind Grafiken und Beschreibungen von historischen Handwerks- und Berufszeichen sowie Belletristik und Sachbücher über Mecklenburg-Vorpommern. Insgesamt umfasst das Verlagsangebot, das unter www.edition-digital.de nachzulesen ist, derzeit mehr als 900 Titel (Stand Juli 2018).
EDITION digital Pekrul & Sohn GbR
Alte Dorfstraße 2 b
19065 Pinnow
Telefon: +49 (3860) 505788
Telefax: +49 (3860) 505789
http://www.edition-digital.de
Verlagsleiterin
Telefon: +49 (3860) 505788
Fax: +49 (3860) 505789
E-Mail: editiondigital@arcor.de