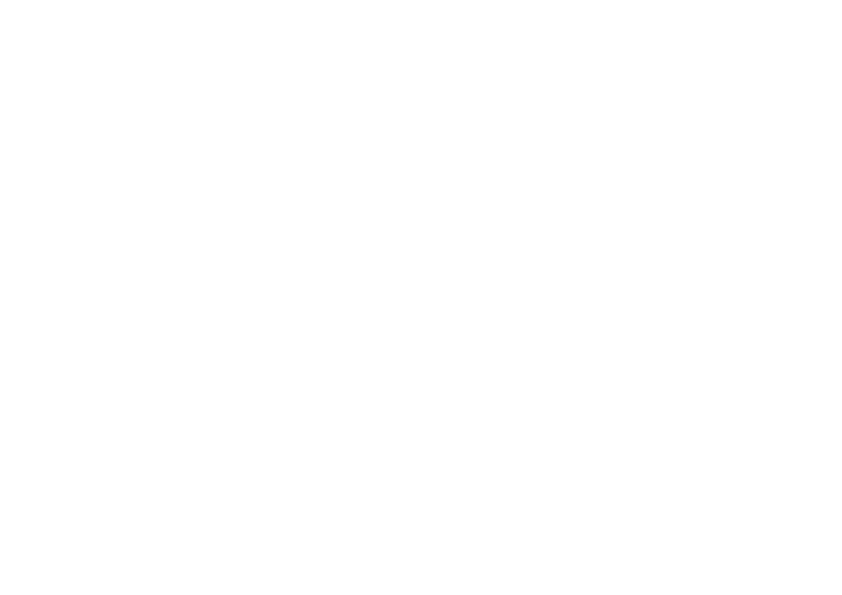Außerdem ist in dieser Woche ein E-Book von Hardy Manthey für sieben Tage zum Superpreis von nur 99 Cents zu haben. Mehr dazu am Ende dieser Ausgabe.
„Anna kann deutsch. Geschichten von Frauen“ von Helga Schubert erschien erstmals 1985 – also noch zu DDR-Zeiten – im Luchterhand Literaturverlag in Frankfurt am Main – und damit im Westen, wie man damals sagte: Es war der Erzählungsband, in dem die Autorin Geschichten von Frauen aus dem Osten gesammelt hatte. Ob es die Polin Anna ist, die von ihrem unternehmungslustigen Kater anerkennend sagt: Lieber ein blutiges Ohr und zufrieden, oder ein spätes Mädchen, ob es eine Frau mit ihrem Liebhaber an einem freien Vormittag ist oder die Begegnung auf einer Insel: Alle Frauen in diesem Buch leben mit einer unerwarteten Herzens-Tapferkeit. Ernst Jandl schrieb über die Kurzgeschichten der Autorin: Helga Schubert hat diese junge, der Lyrik eng verwandte Prosagattung mit Meisterschaft europäisiert. Hier die ersten drei Abschnitte der ersten von Helga Schuberts Frauen-Geschichten aus der Mitte des achtziger Jahre des vorigen Jahrhunderts:
„Die Silberkrone
1
Wenn Marie was von mir will, kommt sie hintenherum. Durch den Garten, übern Hof. Wie sich alle hier im Dorf besuchen. Sie hält einen Topf Suppe in den Händen oder einen Tellermit Kartoffelpuffern, in Speck gebraten, eine Schüssel Eier, einen Strauß Rhabarber, frischen Zwiebellauch oder kleine Gurken. Und sagt: Da, nimm, hoffentlich stör ich nicht. Ich bedanke mich. Sie holt sich den Schemel unterm Küchentisch vor, setzt sich breitbeinig und legt die Hände zwischen die mächtigen Schenkel auf ihren Schoß. Mittag brauch ich erst halb zwölf aufsetzen. Das Haus und das Vieh hab ich fertig. Da dacht ich, gehste mal rüber. Marie sieht mir abwesend beim Teigrühren zu. Dann fällt ihr Blick auf die Johannisbeerreiser, die wir gestern eingepflanzt haben. Nimm mirs nicht übel, die schwarzen Johannisbeeren habt ihr zu dicht gesteckt. Ich will mich ja nicht einmischen, aber das werden solche Büsche. Dabei breitet sie die Arme aus. Dann sieht sie sich unruhig um, ich rühre weiter.
Paul ist noch nicht zurück aus dem Stall, aber ich will dich nicht belasten, sagt sie leise und sieht mich an. Ihre Augen sind feucht.
Meinst du, er sitzt noch in der Kneipe?
Sicher. Und gestern nach der Silberhochzeit von seiner Schwester war er auch blau. Den Rückweg, das letzte Stück, bin ich zu Fuß gegangen. Ich hatte solche Angst. Denn wenn das Pferd die Peitsche sieht, läuft es zu schnell, das ist mir nichts. Was das mal werden soll mit ihm. Sie hat Tränen in den Augen.
Er ist doch nicht schlecht zu dir, wenn er betrunken ist? Das war einmal, sagt sie bitter. Jetzt geh ich ihm aus dem Weg. Ein falsches Wort – und er ist hoch. Sprich nicht drüber. Mit gesenktem Kopf sieht sie nach links und rechts in die Richtung der anderen Häuser und redet noch leiser: Sprich nicht drüber, aber manchmal denke ich, wenn er mal auf der Straße liegen bleibt – ich weine ihm nicht nach.
Sie verbirgt ihr Gesicht in den Händen. Und weint bitterlich. Er hat sich vielleicht an den Alkohol schon gewöhnt. Es richtet sich nicht gegen dich.
Er spricht ja schon seit Wochen kein Wort mehr mit mir. Wenn ich meine Kinder nicht hätte. Ich arbeite ihm wohl nicht genug.
Aber du stehst doch jeden Morgen um vier auf.
Und abends wird es oft neun, halb zehn, bis ich ins Bett kann. Aber es muss wohl nicht genug sein.
Warum lässt du es dir gefallen?
Wo soll ich hin, noch mal von vorn anfangen? Lieber nehme ich mir einen Strick. In der Stadt könnt ich nicht leben. Ich brauch meine Tiere um mich rum. Du siehst ja immer, wie ich mit denen wirtschafte, die Schafe, die Hühner, die Enten, die Gänse, die Kaninchen. Gib mir mal die Kartoffelschalen, die koch ich für die Schweine ab. Hast du auch Konsummarken?
Und wenns mal nicht anders ist und du siehst Inletts, bringst du mir welche mit? Wenn wir die Enten schlachten, will ich die Federn da reinstopfen. Es können Kopfkissen-Inletts sein, Farbe ist egal. Die kann man ja immer noch später in ein Bett-Inlett stopfen. Ich kann dir das Geld schon mitgeben, wenn du willst. Dann will ich mal wieder an die Arbeit.
Sie steht auf und stellt den Schemel untern Küchentisch. Schön, wenn man sich mal so richtig aussprechen kann. Es wird einem gleich anders ums Herz. Ich hab Salzheringe gewässert und eingelegt. Werd dir mal welche rüberbringen. Du kennst ja meine Küche. Ahoi, sagt sie freundlich und geht hinaus.
Aus alten Gummistiefeln hat sie sich Schuhe zurechtgeschnitten. Die grünen Trainingshosen in der Größe 56 sind aus einem Übergrößengeschäft. Dazu trägt sie einen orangefarbenen Pullover, den ihr die Oberschwester geschenkt hat. Darüber einen blau gemusterten Nylonkittel aus dem Landwarenhaus. Auf dem Weg zurück singt sie mit hoher kindlicher Stimme und rollendem R: Warum weinst du, holde Gärtnersfrau? Sie weiß, dass ich ihr nachsehe und zuhöre. Darum dreht sie sich in ihrer Haustür noch mal um und winkt.
Wenn ich mich doch auch so leicht trösten lassen könnte, denke ich. Tagelang muss ich grübeln, wenn mich etwas bedrückt. Aber Marie ist nach so kurzer, andeutender Klage erleichtert. Eben hat sie geweint, jetzt singt sie, immer noch, ich höre sie durchs offene Fenster mit der zweiten Strophe beginnen. Vielleicht spricht sie sonst so kurz und so selten über sich. Dann war das eben wirklich eine Aussprache für sie.
2
Marie ist nicht von hier. Sie hat in Pauls kleine Wirtschaft eingeheiratet. Sie lernten sich durch eine Annonce kennen: Witwer mit Kleinkind sucht Frau vom Land. Sie war damals 24 und allein, schon sechs Jahre in Stellung bei einem Bauern. Sie dachte, ein Kind braucht Liebe, das soll es mal nicht so haben wie ich, und antwortete. Paul und Marie wurden sich bald einig. Sie fand hier Arbeit, und bald heirateten sie. Zuerst waren sie beide bei den Kühen. Er half ihr die schweren Kannen schleppen. Und zu Hause seine kleine zweijährige Tochter. Sie wollte das Kind wie ein eignes behandeln; aber trotzdem zeigte jemand aus der Nachbarschaft sie an, sodass die Fürsorge alles überprüfen musste. Die kam aber nur einmal und nicht wieder. Ein Jahr nach der Hochzeit gebar sie einen Sohn und zwei Jahre danach eine Tochter. Nun hatte sie drei Kinder. Tagsüber die Arbeit als Küchenhilfe, morgens und abends die Bauernwirtschaft und einen Mann, der gerne ins Gasthaus ging. Ihre drei Kinder haben jetzt schon Kinder. Aber sonst ist alles so geblieben, Tag für Tag.
Pauls erste Frau war sehr schön. Das kann man an ihrer Tochter sehen, die jetzt 25 ist. Sie hat stolze dunkle Augen, starke Wangenknochen und volle Lippen. So alt wie ihre Tochter ist Pauls erste Frau geworden. Weil sie das zweite Kind nicht wollte, zerstach sie die Frucht in sich mit einer Stricknadel. Sie starb qualvoll an einer Leichenvergiftung. Ihrem Mann hatte sie nichts von der Schwangerschaft erzählt, sagte mir Marie. Sie pflegt regelmäßig das Grab dieser ersten Frau. Und im Fotoalbum ist ihr Bild auf der ersten Seite eingeklebt. Ist sie nicht schön, fragt sie mich unsicher. Sie sei auch ganz hübsch gewesen, damals, mit24, als sie herkam, hellblond und schlank. So schlank wie jetzt ihre eigene Tochter. Pauls Tochter bekam es nicht zu spüren, dass Marie nicht ihre richtige Mutti war. Aber Paul schimpfte, dass sie sie benachteiligt. Dabei hat sie ihr so viel Liebe gegeben.
Denn die Liebe, die wir geben, kehrt ins eigne Herz zurück. Sie muss immer gut zu allen Menschen sein. Sie weiß, wie sehr die das brauchen. Manchmal sagt sie nur ein gutes Wort zu den Kranken, bei sich auf der Arbeitsstelle. Dort gibt sie Essen aus, auf der Station für die Kranken und im Kasino für das medizinische Personal. Und wenn sie mal fehlt, wegen Krankheit oder Urlaub oder weil sie Überstunden abbummelt, fragen sie alle am nächsten Tag, wo sie gewesen ist, und sagen, dass sie sie vermisst haben. Liegt mal jemand aus dem Dorf bei ihr im Krankenhaus, besucht sie ihn jeden Tag, bringt ihm einen Apfel oder eine Flasche Brause. Das ist gleich so was Persönliches. Im Krankenhaus fühlt sie sich glücklich, weil sie andere Gesichter sieht und alle freundlich zu ihr sind. Wenn nur nicht der lange Weg zur Arbeit wäre. Morgens um fünf aus dem Haus, mit dem Fahrrad 20 Minuten bis zum Bus, dann eine halbe Stunde in die Stadt. Von dort noch zehn Minuten Fußweg. Zurück fährt der Bus zehn nach vier. Darum kann sie vorher noch einkaufen. Voll beladen mit Taschen und Beuteln kommt sie nach fünf zu Hause an.
Sie besorgt dann das Kleinvieh, macht Abendbrot und kocht für den nächsten Tag vor, denn Paul verträgt das LPG-Küchenessen (LPG = Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft) nicht. Oder er sagt es nur, weil er lieber zu Hause isst. Er hat geteilten Dienst, muss im Schweinestall am frühen Morgen und am späten Nachmittag die Tiere füttern, tränken und saubermachen. Die kennen kein Wochenende. Manchmal war er auch schon Springer, aber jetzt hat er 145 Schweine. Mit seiner Erfahrung bemerkt er, wenn es einem Tier nicht gut geht. Dann holt er den Tierarzt. Die Vorschriften sind streng. Gerade mit Schweinen muss man aufpassen. Sie stecken sich schnell an. Wenn sie notgeschlachtet werden müssen, sind sie manchmal noch zu dünn. Der Fleischplan wird nicht erfüllt, und die Prämie am Jahresende stimmt nicht.
Marie kocht also abends für ihn vor. Dann wäscht sie ab, treibt die Enten zurück in den Stall, verschließt ihn gut. Sie verschließt auch den Hühnerstall und denkt vorwurfsvoll an Paul, der das einmal vergaß. So konnte der Marder zwölf Hühner töten. Dann setzt sie sich ins Wohnzimmer und schaltet den Fernseher an. Dabei liest sie die beiden abonnierten Zeitungen: die von der großen Partei und die von der kleinen. In der Zeitung von der großen Partei stehen mehr Verordnungen, und in der von der kleinen mehr Durchführungsbestimmungen, Gemüsepreise, gesuchte Täter und Gerichtsberichte. Wenn sie Glück hat, gibts im Fernsehen einen Krimi oder eine Liebesgeschichte. Wenn sie kein Glück hat, liest sie ein Buch zum zweiten Mai. Sie hat ihre Bücher alle schon gelesen und kann immer wieder darüber ins Weinen kommen, so schön sind sie. Die Handlung spielt auf der Heide oder in den Bergen. Manchmal auch an der weiten See. Dort wird ein unschuldiges Mädchen zu Unrecht schlecht behandelt, von der bösen Stiefmutter oder einem Verführer. Aber sie wird gerächt, alles geht gut aus. Die böse Stiefmutter und der Verführer ändern sich, sehen ihre Schuld ein, beugen sich der sanften Gewalt der nun in den Adelsstand Erhobenen oder schon blaublütig Geborenen oder sie werden vernichtet, Natürlich nicht durch das gute Mädchen, sondern durch eine Naturgewalt. In ihre Kutsche schlägt der Blitz, eine Sturmflut ereilt sie, eine Lawine begräbt sie. Und Marie fängt das Buch wieder von vorn an. Auch mich will sie dafür begeistern. Sie erzählt mir die Handlung mit singender Stimme in ihren einfachen Worten. Meist schläft sie aber beim Fernsehen ein und kommt nicht zum Bücherlesen, jedenfalls wochentags nicht. Wenn sie ins Bett geht und die Übergardinen zuzieht, sieht sie noch mal zu uns. Das ist irgendwie gemütlich, sie weiß auch nicht, wenn von gegenüber Licht scheint.
Einmal, als Paul zu betrunken ist und sich mit dem Sohn in die Haare kriegt, steigt sie heimlich aus dem Schlafzimmerfenster, holt sich unsern Hausschlüssel aus dem Versteck und gelangt unbemerkt von ihrem Mann in unser Bett. Sie weiß, dass wir nicht da sind. Und beichtet es mir gleich am Bahnhof, als ich in der nächsten Woche in ihren Bus einsteige, in den nach der Arbeit um zehn nach vier. Da war es so schön ruhig, und nach ein paar Minuten kam dann ihre Stieftochter in unsere Betten nach. Du hättest es ja doch gemerkt, meint sie, wenn du jetzt nach Hause kommst. Da will ich es lieber gleich sagen.
Ist Paul auch noch nachgekommen, frage ich.
Nein, der hat mich nicht mal gesucht.
Zu Hause beziehe ich die Betten neu. Sie wüsste nicht, warum, wenn ich ihr das erzählen würde.
3
Das Haus hat Paul von seinen Eltern geerbt. Ein Bruder ist jung gestorben, nach der Operation im Krankenhaus. Nun hat er noch zwei Brüder und eine Schwester. Die Schwester kommt nur zu Hochzeiten hier ins Haus. Sie ist richtig fein geworden in ihrer Ehe. Zur Silberhochzeit trug sie alles aus Silber, eine silberne Bluse und auch etwas Silbernes im Haar. Das hat sich Marie genau angesehen. Sie wohnt ein Dorf weiter. Der eine Bruder wohnt zwei Dörfer weiter. Er kommt manchmal am Sonntag mit seiner Familie und dem Pony-Gespann zu Besuch. Der andere Bruder aber wohnt auch in unserm Dorf. Der kommt nicht zu Besuch. Dieser Bruder hat eine fröhliche Familie. Am Sonntag geht er mit seiner Frau am Arm auf der Dorfstraße spazieren. Und vor allem: Er hat ein Pferd, das ihm gehorcht. Paul hat auch ein Pferd, doch vor dem hat er Angst. Eigentlich sollte es eine Geldanlage sein, und er wollte mit der Zucht beginnen. Aber nun steht es nur herum. Vor dem Pflug tänzelt es schweißüberströmt, oder es bleibt stehen. Wenn Paul das Pferd zum Weiden angepflockt hat, reißt es sich bald los. Und dann sehen wir es in großen weiten Sprüngen am Horizont. Paul aber fährt mit dem Moped umher und erkundigt sich, wo sein Pferd sein könnte. Verkaufen kann er es nicht, dann hätte er ja kein Pferd. Und um das Pferd seines Bruders kann er schon gar nicht bitten. Da leiht er sich lieber das von der LPG, wenn er wirklich mal eins zum Arbeiten braucht.
1970 legte Wolfgang Schreyer im Deutschen Militärverlag Berlin die erste Druckauflage seiner essayistischen Untersuchung „Aufstand des Sisyphos. Dominikanische Tragödie“ vor: Gefoltert von Qualen, wälzt Sisyphos einen gewaltigen Stein bergan. Keuchend stemmt er sich gegen die Last und schiebt sie auf den Gipfel. Doch glaubt er die Bergspitze erreicht zu haben, rollt der Felsblock zur Ebene hinunter… Der griechische Mythos von Sisyphos erhellt die Situation in Lateinamerika. Nacht und Tag, Tag und Nacht wälzen die weißen, braunen, roten und schwarzen Arbeiter Amerikas den Felsblock ihrer unterdrückten Schöpferkräfte gegen das Schicksal der nicht selbstverschuldeten Unterentwicklung. Zweihundertdreißig Millionen Lateinamerikaner – das sind sieben Prozent der Menschheit! Und die Mehrzahl von ihnen lebt menschenunwürdig: Hunger, Krankheiten, Unbildung… Woher rührt dieses Elend inmitten einer verschwenderischen Natur? Eine zählebige, brutal herrschende Drillingsmacht ruiniert die lateinamerikanischen Völker: Feudaloligarchie, kreolisches Großbürgertum und Dollar-Imperialismus. Gibt es einen Weg, auf dem Sisyphos endlich und für immer den Gipfel erreicht? Die bitteren Erfahrungen des lateinischen Amerika im 20. Jahrhundert: Die Versuche in Bolivien, Guatemala, Santo Domingo, das Scheitern Jacobo Arbenz‘, Juan Boschs, Ernesto Guevaras – könnten sie nicht Zweifel wecken an den Möglichkeiten, das Schicksal zu wenden? In moderner essayistischer Form behandelt Wolfgang Schreyer ein immer noch brennend aktuelles Thema: Revolution vor der Haustür der USA. Aufstand des Sisyphos! Mit seinen hervorragend recherchierten Informationen ist dieses Buch eine sehr gute Ergänzung zu Schreyers Trilogie „Dominikanische Tragödie“ mit den Romanen „Der Adjutant“ (1971), „Der Resident“ (1973) und „Der Reporter“ (1980). Aber wie hatte die Tragödie eigentlich angefangen. Fangen wir mit dem Anfang an. Fangen wir mit Kolumbus an, Christoph Kolumbus:
„Der Entdecker
Es begann vor einem halben Jahrtausend auf der portugiesischen Insel Porto Santo am Rand des Atlantiks in der Nähe von Madeira mit einer Erbschaft und einer Ehe. Ein dreißigjähriger Seemann aus Genua, Cristoforo Colombo – später nannte er sich Cristóbal Colón oder auch Kolumbus –, hatte 1481 die Tochter eines adligen italienischen Kapitäns geheiratet; der Kapitän war im selben Jahr gestorben, Colón in dessen Haus gezogen. Unter der Hinterlassenschaft fand er eine schwere eisenbeschlagene Truhe mit Landkarten, Notizen, Plänen und wunderbaren Berichten über Schätze und Länder; Berichte, wie zahlreiche Reisende jener Epoche sie sammelten, ängstlich hüteten und als wertvollen Besitz weitergaben an ihre Kinder. Das Zeitalter der Entdeckungen war eben angebrochen.
Kolumbus studierte die Karten, Notizen, Pläne und wunderbaren Berichte, er verschaffte sich die Schriften berühmter Geographen, befragte Piloten, die die Meere jenseits Madeiras und der Azoren befahren hatten und behaupteten, das große, reiche Indien und das große, reiche China – damals Kathai geheißen – seien auf Westfahrt schnell zu erreichen, obwohl keiner von ihnen je dort gewesen war oder auch nur versucht hatte, dorthin zu kommen. Der westliche Seeweg nach Indien und Kathai wurde für Kolumbus zum Fetisch. 11 Jahre jagte er ihm nach, versuchte Geld für eine Expedition zu beschaffen, verhandelte mit Königen, Schranzen, Kaufleuten, stritt mit Gelehrtenkommissionen, feilschte um Titel, um künftige Profite. Mit 120 Mann und drei Schiffen brach er endlich im August 1492, im Auftrag der spanischen Krone, vom Hafen Palos (unweit der Hafenstadt Cadiz) westwärts auf. Seinem Flaggschiff „Santa Maria“ folgten die Karavelle „Pinta“ und das nur 17 Meter lange Hilfsschiff „Niña“. Dass Königin Isabella ihre Juwelen versetzt habe, um die Expedition auszurüsten, ist eine romantische Legende. Die Kosten, etwa 7 500 Dollar nach heutigem Geld, trug hauptsächlich die Kaufmannschaft von Palos.
Am 69. Tag der Reise meldete der Mann im Ausguck Land in Sicht – die Bahamas. Das Geschwader segelte an der schroffen Nordküste Cubas vorbei nach Haiti. Im Nordwesten der Insel gingen Kolumbus und seine Crew am 6. Dezember von Bord und wurden von kupferbraunen Menschen freundlich empfangen. Da Kolumbus sich in Indien wähnte, nannte er sie Indianer. Der Ankerplatz gefiel ihm, nicht nur des Goldes wegen, mit dem die Indianer geschmückt waren – Kolumbus und die Matrosen handelten es ihnen preiswert ab –, sondern auch, weil die Landschaft an Spanien erinnerte: die Vegetation, die Bergketten im Süden (dort schürften die Indios angeblich das Gold), die Hitze flimmernde Luft, alles war wie in Spanien, und Kolumbus trug die Insel unter dem Namen „Hispaniola“ in seine Seekarte ein.
Der ständige Nordostpassat allerdings war lästig; er ließ die Schiffe schlingern, verbreitete Seekrankheit, und auf der Weiterfahrt vom heutigen Cap Haitien nach Osten warf die Passatbrandung das Flaggschiff „Santa Maria“ auf eine Sandbank, wo es barst. Von der „Pinta“ hatte Kolumbus sich für einige Wochen getrennt, die „Niña“ konnte nicht alle Schiffbrüchigen aufnehmen. Am Ufer errichteten die Spanier aus den Trümmern des Wracks ein Fort, La Natividad: Weihnachten; 39 Mann blieben darin zurück – die erste koloniale Besatzungstruppe in der Geschichte Amerikas.
Im folgenden Herbst kam Kolumbus, nun auf dem Gipfel seines Ruhms, wieder nach Übersee – mit 14 Karavellen. Sie trugen 1 200 Bewaffnete, auch Reiter, ferner Beamte des Königs, 11 Geistliche und einen apostolischen Vikar aus Rom. 3 Lastschiffe bargen europäische Haustiere, Saatgut und Weinreben, die nach „Indien“ verpflanzt werden sollten. Dies war nicht mehr ein bloßes Erkundungsgeschwader, sondern eine Flotte von Kolonisatoren. Am 27. November 1493 erreichte sie La Natividad; man fand das Fort in Trümmern. Die Besatzung hatte sich nicht mit Tauschhandel begnügt, aus Schiffbrüchigen waren Eroberer geworden. Durch die Gewalttaten und Plünderungszüge gereizt, hatte der Stamm des Kaziken Caonabo die Spanier erschlagen. Kolumbus legte 60 Kilometer ostwärts ein neues Fort an, Isabella, und ließ den Plan einer Stadt entwerfen. Ein Suchkommando fand 7 Tage weit im Inneren der Insel Gold in den Bächen. Der Admiral sandte das Gros seiner Flotte heim, beladen mit Beute und zahlreichen Kranken; das Klima im Küstenstreifen war mörderisch. Er selbst brach in das Goldland auf, besetzte die Minen von Cibao und sicherte sie durch das Fort St. Thomas. Hier ließ er 56 Mann zurück und befahl ihnen, sich friedlich zu verhalten.
Überzeugt, das Goldland Ophir des biblischen Salomo entdeckt zu haben, der zweieinhalb Jahrtausend zuvor mit Märchenschätzen von einer See-Expedition zurückgekehrt war, schickte Kolumbus sich nun an, den Weg nach Kathai zu vollenden. Am 4. Mai 1494 landete er auf Jamaica. Hier widersetzten sich die Indios; sie wurden durch einige Schüsse und durch Bluthunde eingeschüchtert. Aber Gold war nicht zu finden. Darauf drang der Admiral in das Gewirr von Riffen und Inselchen ein, die Cubas Südküste säumen. Er nannte es „Garten der Königin“ und hielt es für jene Inselgruppe, die nach Marco Polo östlich von China liegen sollte. In Cuba glaubte er Japan vor sich zu sehen.“
Der VEB Hinstorff Verlag Rostock druckte 1977 die erste Auflage von „Amerikaheinrichs Rückkehr“ von Erich-Günther Sasse: Heinrich war in Amerika und wird von den Dorfbewohnern doch nicht als Globetrotter bewundert. Dieser Prahlhans schneidet so sehr auf, dass der Großvater – sein bester Freund – ihn vor die Tür setzt. Die dreizehn Erzählungen sind vorwiegend in einem Milieu angesiedelt, von dem der Autor sagt „Ich stamme vom Lande, und so ist mein Thema vorläufig das Land“. Sasses Erzählweise vermeidet Überflüssiges, beeindruckt durch psychologische Durchdringung, ist vor allem volkstümlich und lässt der Fantasie des Lesers Raum. So vermittelt seine Prosa Begegnungen mit Vergangenheit und Gegenwart, mit Alten und Jungen, mit Liebe und Zorn, ist heiter und ernst. Überzeugen Sie sich am besten selbst mit dieser Leseprobe, in der es um nichts weniger geht als um Leben und Tod:
„Mon dieu
Sie sagen, es wird wohl wieder mal losgehen, sagt Heinrich Grimm und trinkt einen Schluck vom Braunbier. So gut wie bei Thoms ist das Bier nirgendwo, weiß jeder und Heinrich auch, dabei ist er weit herumgekommen, er war doch bei den Soldaten. Aber zu Hause, sagt er, ist es doch am allerschönsten, prost Krischan. Und Krischan sitzt dabei und ruft seine Frau, die in der Küche ist: Kathrin, bring neues Bier! Und Kathrin kommt, gut gebaut, in der Mitte noch ziemlich schmal, Mitte vierzig vielleicht, drei Holzhumpen in der Hand. Sie stellt das Bier auf den Tisch.
Es ist halbdunkel in der Gaststube, zwei Kerzen brennen, und wenn ihr einer an den Hintern fasst, sieht es keiner, deshalb sagt Kathrin auch nichts, es könnte ja ihr Krischan sein, der alte Bock. Das haben wir gesehen, sagt Kathrin, den ganzen Tag sind welche gekommen, Franzosen und unsere. Und Krischan sagt, Bier saufen woll’n alle, aber bezahlen will keiner, Scheißsoldaten und Hunde verfluchte.
Nun wird es wieder losgehen, sagt der Schulze, der immer was Bedeutendes sagen will, wo er doch der Schulze ist, zu erkennen an der goldenen Uhrkette. Jetzt, wo das Winterkorn schon so hoch ist, prost Krischan!
Prost, sagt Krischan und trinkt und wischt sich mit der Hand den Schaum vom Mund. Sogar der Herr von Mönchmann trinkt Krischans Bier manchmal, wenn er im Dorf ist und sich erholen will von der Frau Baronin, die oben im Schloss betet für das Seelenheil des Gemahls, mit dem jungen katholischen Pfarrer. Und die jungen Herren kommen beide, wenn sie auf Abenteuer aus sind.
Der Schulze sagt was Bedeutendes, ich muss mal raus, und steht schwer auf und stolpert über sich selbst. Und Kathrin sagt, aber vorsichtig, Schulze. Ja, ja, sagt der und torkelt raus und lässt die Tür offen. Nun kommt Thoms Hofhund reingesprungen, das Vieh, schwarz wie die Nacht. Er wedelt mit dem Schwanz und springt Thoms künftigen Schwiegersohn an, aber der hat damit nichts im Sinn. Er haut dem Köter den Holzhumpen auf die Schnauze. Wo ich doch Hunde nicht ausstehen kann, sagt er.
Und Kathrin verkneift sich, was sie zu sagen hätte. Dass nämlich der Herr Grafe Soldat sein müsste, wie ihre Söhne, und wie das zu sein hat. Aber Grafes sind nun mal die größten Bauern im Dorf, und der junge Grafe hockt den ganzen Tag in der Gaststube, da sagt sie nichts. Oder doch was, ich will den Hund man an die Kette legen, solange Gäste hier sind.
Und der König, sagt Krischan. Ach der, sagt Andreas Grafe, der schon mehr sagen kann als die anderen, denn er hat vier Pferde im Stall, ach der! Jochen, der beim Kaufmann Salomon in der Stadt dient, ist heute zu Fuß gekommen, den weiten Weg. Drin ist was los, Franzosen über Franzosen, sogar der Stiefsohn vom Napolium, der Vizekönig von Italien, soll dabei sein, sagt Jochen, er hat ihn nicht gesehen, aber viele andere große Herren. Nein, sagt Kathrin, die wieder reinkommt, solche Leute. Und Krischan sagt, hol du man lieber neues Bier! Das macht sie auch, schnell ist sie wieder da.
Und die schöne junge Königin, unsere meine ich, so jung und schon tot, das macht der Kummer. Ach Gott, ach Gott, sagt Krischan. Und Kathrin sagt, aber der König hat wohl schon was Neues. Eine Gräfin, mindestens.
Warum auch nicht, sagt Heinrich, prost! Und Kathrin sagt, ihr Kerle, ihr seid doch alle gleich. Fünf Männer sitzen in Thoms verräucherter Gaststube um den Tisch. Heinrich Grimm, Andreas Grafe und Krischan selber und Otto Hinze, aber der ist bloß Schmied, er soll gefälligst das Maul halten. Der fünfte war der Schulze, der ist nicht mehr da.
Der ist voll, sagt Kathrin und räumt die leeren Humpen vom Tisch. Nun fragt Andreas Grafe doch, was er schon den ganzen Abend fragen wollte, wo Hannchen ist. Und Kathrin sagt schnell, damit Krischan nichts verrät, die schläft oben in ihrem Bette. Das ist nicht wahr, aber es weiß keiner. Johanna ist im Busch. Da hat Krischan sie in einem Baum versteckt, damit sie nicht den Franzosen in die Hände fällt, man hört von solchen Krankheiten, die sollen ja schlimmer sein als die Pest. Da draußen ist Johanna sicher. Der Busch ist nicht sehr weit, das Dorf liegt sowieso ziemlich abseits von der Straße, auf der die Soldaten marschieren. Und so oft kommen die Franzosen hierher nicht. Auf dem Schloss waren sie schon dreimal, da soll bald nichts mehr übrig sein. Obwohl die Frau Baronin Tag und Nacht betet mit ihrem frommen Pfarrer, aber das hält die Franzosen wohl nicht ab. Johanna ist jedenfalls sicher im Busch, und die drei Kühe hat sie mit und ein paar Schweine. Das Vieh wenigstens soll gerettet werden.
Die Söhne sind, darüber redet man besser nicht, oder doch, der eine ist bei Napolium. Und der andere bei denen, über die man nun wirklich nicht redet, es beruhigt zu wissen, dass es sie gibt, und manchmal beunruhigt es auch sehr. Man weiß doch nicht, was alles noch kommt. Kathrin seufzt, sie hat Angst um alle beide. Propheten sind genug durch das Land gezogen, die brauchen wir nicht, sagt sie. Und Krischan sagt, das Weib, was die wieder redet.
Andreas Grafe steht auf und sagt, ich will man gehen, in diesen Zeiten ist man besser in der Nacht zu Hause. Es ist spät geworden, sagt Heinrich Grimm. Die Männer gehen. Es fällt ihnen schwer, das gute Bier, das gute Bier. Und Krischan will Kathrin noch an die Bluse, aber Kathrin will nicht. Wenn das Kind kommt und überhaupt. Aber das Kind ist doch im Busch, brummt Krischan. Darum habe ich doch extra nicht so viel gesoffen, sagt er. Kathrin zieht ihre Bluse zurecht und sagt, ich geh noch raus zu Hannchen, Ruhe habe ich hier doch nicht. Sie legt sich ein schwarzes Tuch um die Schultern und geht und schreit und kommt wieder in die Gaststube gestürzt, da draußen liegt einer!
Quatsch, sagt Krischan. Doch, sagt Kathrin, sie guckt ziemlich aufgeschreckt. Da liegt wirklich einer, das sieht nun auch Krischan, der kriecht und stöhnt, dunkel, auf dunkler Erde, das ist ein Mensch. Und Krischan sagt, aber das ist doch ein Franzose, und so was in unser Haus! Man hört Lärm und Geschrei, das ist sehr weit weg, es wird hoffentlich nicht näher kommen. Das Mondlicht fällt auf den Mann, der da liegt. Und Kathrin sagt, hier können wir den doch nicht liegen lassen. Das wäre Krischan das liebste. Wir sind doch Christenmenschen, sagt Kathrin. Deshalb packen sie den Mann und tragen ihn ins Haus. Krischan fasst ihn unter die Arme, Kathrin nimmt die Beine. Krischan sagt, der Kerl ist ganz schön schwer.
In der Stadt ist der Vizekönig von Italien, und bei Marcus Salomon sind Franzosen einquartiert. Schadet nichts, sollen sie den ein bisschen ausnehmen, der hat noch genug. Alle im Dorf schulden ihm was. Nur Thoms nicht. Mit Juden lassen wir uns gar nicht erst ein, sagt Krischan immer, man weiß doch, wie die das machen. Hat Krischan auch nicht nötig, sich mit Juden einzulassen. Die Taler sind vergraben hinter der Scheune. Und die Wurst auch, in der großen, verschnörkelten Holztruhe, und Kathrins gute Wäsche liegt ganz obenauf.
Der Franzose stöhnt, als sie ihn schleppen, als sie ihn in der Gaststube auf den Boden legen, mon dieu. Und Kathrin sagt, mein Gott, so ein schöner junger Mensch. Darüber ärgert sich nun Krischan gewaltig. Er war auch mal schön und jung, jetzt hat er einen Wanst. Red doch nicht soviel, sagt er. Er hat Angst. Ein Franzose im Haus, man weiß nicht, wie das ausgeht. Die Kerzen auf dem Tisch flackern. Und Krischan denkt, so oder so, es geht nicht. Das sagt er auch zu Kathrin. Aber so schnell gibt Kathrin nicht auf. Sie sagt, lassen wir ihn in Frieden sterben, er hat uns nichts getan. Da ist Krischan anderer Meinung. Wer hat uns die Pferde aus dem Stall geholt? Wer hat die Kuh aufgefressen, gerade die beste Milchkuh, gerade frischmelkend? Und die Hühner dazu. Wer hat das Bier weggesoffen, fassweise? Ja, sagt Kathrin, die Franzosen schon, aber doch nicht der da, der ist doch noch so jung.
Aber, sagt Krischan, er bleibt ein Franzose. Er sieht auf den jungen Mann, der stöhnt, mon dieu, mon dieu, immer diese beiden Worte. Kathrin geht und kommt wieder und hat einen Packen Kleider unter dem Arm, die legt sie auf die Steine. Sie wälzt den Franzosen darauf. Der stöhnt: mon Dieu, mon dieu. Gott sei Dank, denkt Krischan, dass Johanna nicht da ist, so ein halb toter Franzose ist doch immer noch ein Franzose. Kathrin will ihm einen Schnaps geben, aber er presst die Lippen fest zusammen. Kathrin deckt ihn mit den Kleidern zu, nun hat er es warm. Die Nacht ist noch kalt, Anfang April, da liegt man doch lieber zusammen im warmen Bett. Krischan sitzt am Tisch und starrt vor sich hin, immer auf den Franzosen. Das ist nichts Gutes, weiß Kathrin, und sie hat Angst. Deshalb sagt sie, ich geh jetzt zu Hannchen in den Busch, er ist doch schon ruhiger.
Kathrin geht und bleibt sehr lange weg. Als sie wieder kommt, ist die Nacht bald vorbei. Krischan weiß, dass sie wirklich bei Johanna war, und sie hat ihr alles erzählt. Die Weiber! Krischan hat schwer gearbeitet. Er hat ein Loch gegraben in der Gartenecke, wo der Graben ist, der im Sommer immer austrocknet, dort, wo unter Weidenbäumen die Johannisbeeren stehen, die so sauer sind, dass sie meistens am Strauch vertrocknen, in der Ecke, wo der Kürbis von Jahr zu Jahr schlechter wächst, kümmerlicher, da hat er das Loch gegraben. Er wollte fertig sein, aber ganz hat er es doch nicht geschafft. Er kommt in die Gaststube, ein gewaltiger Mensch, der schwitzt und mächtigen Durst hat, das Hemd ist offen, die Ärmel sind hochgekrempelt, dass die behaarten Arme zu sehen sind.
Er erschrickt, als er Kathrin vor dem Franzosen stehen sieht, sie starrt durch ihre Finger, erst auf den Franzosen, dann dreht sie den Kopf zu Krischan um. Mein Gott, sagt sie, der junge Mensch! Nun könnte Krischan sagen, mit Gott für König und Vaterland, oder so was ähnliches, vielleicht auch, es lebe der König! Nur zugeben kann er nicht, dass er Angst hat, nicht vor Kathrin. Also sagt er leichthin, der wär doch sowieso hinüber, er guckt Kathrin dabei nicht an.
Krischan hat Kathrins Aussteuerlaken geholt, weiß gebleicht und grob gewebt, von Kathrins Großmutter mit den gichtigen Fingern selbst gemacht. Er rollt den Franzosen ein. Gleich so, wie er ist, man ist doch kein Leichenfledderer, das hat Krischan nicht nötig.
Nimm du die Stiefel, sagt er zu Kathrin.
Nein, sagt sie, nicht. Sie sieht Krischan ins Gesicht und schüttelt den Kopf.
Nimm du die Stiefel!
Da fasst sie an, sie hat Angst.
Der Hund kläfft auf dem Hof, dann heult er den Mond an. Als es Morgen wird, sind sie fertig. Krischan hat das Loch zugeschaufelt. Und Kathrin sitzt dabei auf dem Apfelbaumstumpf und kann sich nicht von der Stelle rühren, das Schultertuch ist verrutscht und die weiße, volle Brust zu sehen, und sie stöhnt, mein Gott, mein Gott.
Es ist nichts mehr zu sehen. Krischan streut den Rest Erde auf der Wiese breit. Der Tag zieht am Himmel hoch, erst ein roter Streifen dort, wo die Sonne aufsteigt, hinter dem Wald, in dem Johanna hockt, hoffentlich schläft sie. Der Himmel wird rot. Und Kathrin denkt, Gott erbarme dich unser, lass es noch dunkel bleiben. Der liebe Gott hört nicht, er schläft. Der Tag wird hell. Und die Vögel fangen verschlafen an zu singen, an diesem Tag singen die Vögel! Endlich ist Krischan fertig. Er lehnt sich auf den Spaten, wischt sich die Stirn ab und sagt, na also, komm! Er legt seinen Arm um Kathrins Schulter, der Arm ist heiß. Und Kathrin lässt sich an die Bluse kommen, mein Gott, was ist denn schon dabei. Mon dieu!
Die Franzosen mussten flüchten. Das Haus des Händlers Marcus Salomon haben sie in Brand gesteckt, weil er sein Geld nicht herausrücken wollte. Ich hab nicht, bin arm, aber jemand hatte gesagt, dass dort viel Geld sei. Und Krischan hat zu Kathrin gesagt, du siehst, wie recht ich hatte, Kathrin hat nichts gesagt und den Kopf gesenkt. Johanna kam nach ein paar Tagen unbeschädigt aus dem Busch zurück. Bald darauf heiratete sie den jungen Grafe, den größten Bauern im Dorf.
Kathrin pflanzt wie eh und je in der Gartenecke, bei den sauren Johannisbeeren, ihren Kürbis. Der wächst von Jahr zu Jahr besser. Und bald erntet im ganzen Dorf keiner solche Kürbisse wie Kathrin. Darauf ist sie stolz. Zu Erntedankfest spendet sie der Kirche den allerbesten. Manchmal steht sie dort in der Ecke und besieht sich die Kürbisse und guckt über den Gartenzaun weg auf das weite Land, über das viele Propheten gezogen sind, und flüstert, mein Gott. Aber immer öfter ist ihr so, als habe sie, was in jener Nacht passiert ist, nur geträumt. Wenn sie zu lange in der Ecke steht, ruft Krischan, bring neues Bier, die Gäste warten!“
Erstmals 1994 brachte der KinderbuchVerlag, der nach der Wende ein klein wenig anders geschrieben wurde als davor, das spannende Kinderbuch „Die Räuber mit den großen Koffern“ von Günter Saalmann heraus: Jana versteht gar nichts. Die fremde Stimme auf dem Anrufbeantworter krächzt und stammelt nur ein paar Worte. Doch irgendwie hört es sich wie eine Drohung an. Aber Jana ist kein Angsthase. Und Tim, ihr bester Freund, ist als Sohn eines Hauptkommissars fast ein Profi. Doch dann kommen sie, nachts, die Räuber mit den großen Koffern. Zunächst aber gibt es einen unheimlichen Anruf, und dann noch einen:
„1. Kapitel
Am Rande der Stadt Kalau, abseits der großen Chaussee, liegt der Galgenweg. Hier stehen einsam zwei Häuser. Das eine gehört Bostelmanns. Es ist Samstagabend. Jana Bostelmann sitzt vor dem Fernseher. Die Sendung heißt: Warnen uns übernatürliche Mächte??? Eine Dame mit großer Glitzerbrille berichtet von einem seltsamen Anruf: Meldet sich doch kürzlich ihr vor dreißig Jahren verstorbener Bräutigam! Er will sie warnen. Vor einem Vampirbiss! Ein böser Scherz, so hat die Dame geglaubt. Bis neulich, um Mitternacht – sie zeigt den Zuschauern die Bissnarbe an ihrem mächtigen Kinn und hebt die Oberlippe … Schaudernd schaltet Jana das Fernsehgerät aus.
Da sieht sie das Lämpchen am automatischen Anrufbeantworter des Telefons blinken. Sie drückt den Wiedergabeknopf, und eine tiefe, heisere Stimme meldet sich. Sie scheint aus weiter Ferne zu hallen: „Krächz … halloo wamiwien Gruft von Bostelmann … krächz, krächz …“ Die Worte gehen unter im Rauschen und Knacken. Die Kassette zwitschert beim Zurückspulen, Jana hört den unverständlichen Anruf wieder und wieder ab. Im ersten Augenblick hat sie Tim Dollenburg im Verdacht. Aber gleich wird sie unsicher. Der gute, dicke Tim? Nein. Der kommt nicht auf solche Späße. Und das Ganze klingt auch nicht nach Spaß. „Wamiwien Gruft von Bostelmann …“ Vielleicht hieß es auch: „Mawilien Gruft …“ Am Ende gar: „Familiengruft“? Jana überlegt. Soll sie ihren Papa verständigen? Auf dem Tisch liegt ein Zettel mit seiner eiligen Handschrift.
Mein liebes Janakind
Wenn irgendwas ist, ruf mich im „Wilden Mann“ an, es wird heute wieder spät.
Dein lieber sorgenvoller Papa
Der Papa ist abends fast nie daheim, er muss Schunkellieder singen und frohe Laune verbreiten. Er ist von Beruf Stimmungssänger und erfreut mit seinem bärenstarken Bass die Gäste im Weinlokal „Zum Wilden Mann“. Das liegt im Stadtzentrum, weit entfernt von dem einsamen Galgenweg.
Soll Jana ihren Vater von der Bühne weg ans Telefon rufen lassen? Und was kann sie ihm sagen? Etwa: Lieber Papa, eben kam ein Anruf aus der Familiengruft? Keine Panik, sagt sie sich. Der Papa hat zurzeit wirklich Sorgen genug. Wegen Mama. Die Arme liegt seit drei Tagen im Krankenhaus. Mit drei gebrochenen Rippen. Sie wollte nur eine Straße überqueren. An einer Stelle, wo gerade Telefonkabel neu in der Erde verlegt wurden. Ein gelbes Auto kam, ein Stoß, sie lag im Graben. Und der Fahrer hatte es sehr eilig, wegzukommen …
Nein, zusätzliche Sorgen kann der Stimmungssänger Bostelmann zurzeit nicht brauchen. Und seine Tochter? Sie wird den dummen Anruf einfach vergessen. Jana drückt zwei Tasten und löscht die „Familiengruft“. Aus dem Dachgeschoss dringt das ungeduldige Quietschen von Bruder Robby. Sie läuft die Treppe hinauf ins Kinderzimmer.
„Hast du dein Keksel schon wieder verschmiert?“, schimpft sie.
Robbys Mund ziert ein Bart aus gelbem Brei, er steht im Bett, rüttelt am Gitter und strahlt ihr entgegen. Jana seufzt, nimmt ihn aufs Knie, lässt ihn reiten. Singt ihm ein Gutenachtlied. „La la li la li la Laus, Mama liegt im Krankenhaus, Papa singt im >Wilden Mann<, holdrio taram tamtam, Opa, Oma sind nicht da, wohnen in Amerika, keiner kümmert sich um Jana und ihr gefräßiges Robby-Monster.“
„Badamadaba“, singt Robby-Monster mit und guckt sehr verständig, so sehr, wie nur ein Bursche von reichlich zwölf Monaten gucken kann. Mit seiner feuchten Pfote patscht er in Janas Gesicht. Sie beißt in die dicken Wurstelfinger und macht „Ham ham, altes Tinktier!“
„Ham ham?“, fragt Robby hoffnungsvoll.
„Kekse sind alle! Ab mit dir!“
Er bekommt sein Spielzeug in den Arm gedrückt, ohne das er nie einschläft: einen rot karierten Stoffsack, der lachen kann. Das Ding war in einem Paket, das Oma Vivian und Opa Thomas aus Amerika geschickt hatten. Wenn man draufdrückt, quiekt und quäkt und schnarrt es im Innern: „Hähähähahahuhu …“
Robby hört eine Weile zu, steckt dann zufrieden den Daumen in den Mund und dreht sich auf die Seite. Jana ist zwar müde, aber sie kann die Augen noch offenhalten. Also läuft sie wieder hinunter ins Wohnzimmer, setzt sich von Neuem in den Sessel, nimmt die Fernbedienung zur Hand. In dem Film hebeln Einbrecher mit Eisenstangen eine Stalltür auf, ein edler Hengst wiehert ahnungsvoll. Jana schaltet auf einen anderen Kanal. Hier sind bärtige Räuber dabei, einen kleinen Jungen in einen Teppich zu wickeln. Auf dem dritten Sender spricht eine Dame das „Wort zum Sonntag“ mit tröstender Stimme. Davon schläft Jana endlich ein. In der Nacht hört sie einen Knall. Ach, das ist nur Papas Kopf, denkt sie und schmiegt sich zufrieden an die breite Schulter des Vaters, der von seinem Auftritt heimgekommen ist und sie in ihr Bett trägt. Er hat sich wieder mal die Stirn an dem Balken über der Kinderzimmertür gestoßen, ihr großer Papa.
Der Sonntagvormittag bringt Küchenarbeit und verdrießliche Mienen. „Das kommt davon!“, gähnt Papa schlecht gelaunt.
„Familiengruft von Bostelmann“, murmelt Jana. Ein kleines Bauchweh krampft sich ab und zu in ihr fest.
„Hast du irgendwas?“, fragt der Papa nicht sehr aufmerksam.
„Ach, nichts weiter“, sagt Jana.
Bostelmanns Sonntagsessen besteht aus einer Tütensuppe mit gerösteten Semmelwürfeln. Robby-Monster bekommt grünen Spinat mit Spiegelei, von dem er eine gute Portion an die Tapete spuckt, obwohl Papa Zucker drübergestreut hat. Danach befreit Jana das brüderliche Hinterteil von braunem Spinat und windelt es frisch. „Ab ins Bett, Mittagsschlaf, altes Tinktier!“
Papa fährt Mama im Krankenhaus besuchen. Er ist gerade zehn Minuten zur Tür hinaus, da geht das Telefon. Jana ist zur Stelle: „Ja bitte?“ Im Hörer rauscht und knackt es wieder, und der Anfang ist abermals nicht zu verstehen. Nur für einen Moment kommt die Stimme deutlicher, es ist dieselbe wie gestern Nacht, aber diesmal hört sie sich näher an: „Krächz …, Sonntag … Mitternacht ist es aus … krächz … standen …“
„Hier wird nicht gegruselt!“ ruft Jana zornig. „Und es wäre reizend, wenn Sie sich vorstellen würden!“ Aber die Leitung ist plötzlich stumm. Jana legt auf. Was hat die Stimme sagen wollen, wenn man das Stück im letzten Teil ergänzt? Sonntag um Mitternacht ist es aus, verstanden? Das ist schon keine Warnung mehr. Das ist eine Drohung! Jana würde gern zu Tim hinüberlaufen, um sich mit ihm zu beraten. Aber da meldet sich Robby schon wieder.“
Zum Superpreis von nur 99 Cents ist in dieser Woche ein weiterer Teil der Zeitreisenden-Saga von Hardy Manthey im Angebot. Sein fantastischer Roman „Von der Hure Roms zur mächtigen Priesterin“ war bei der EDITION digital nur als E-Book-Ausgabe 2012 in erster Auflage, 2015 in zweiter, stark überarbeiteter Auflage erschienen: Teil 2 führt die schöne blonde Aphrodite, die eigentlich Maria Lindström heißt und eine schwedische Ärztin aus dem 22. Jahrhundert ist, noch rechtzeitig vor dem 3. Punischen Krieg mit ihrem Herrn Eklasteos aus Karthago auf ein Schiff nach Sizilien. Viele Qualen und Erniedrigungen hat sie zu erdulden, obwohl sie zur Hure Roms aufsteigt und schließlich eine angesehene und reiche, aber rechtlose Ehefrau wird. Von ihrem Ziel, eine Botschaft in das 22. Jahrhundert zu senden, ist sie weit entfernt. Auch dieser Teil ist wieder sehr spannend und lässt den Leser voller Neugier auf den nächsten Teil (Das Gold der Wüste – endlich am Ziel?) warten. In dem folgenden Textausschnitt befinden wir uns auf einem Schiff, das in „Thermae Selinuntinae“ ankommt:
„Die Küste am Horizont wirkt durch Lichter in der Abenddämmerung einladend. Die Sonne geht hinter steilen Bergen einer zerklüfteten Küste gerade feuerrot unter. „Das ist Thermae Selinuntinae!“, rufen mehrere Seeleute gleichzeitig begeistert aus. Tatsächlich werden die Bilder einer Stadt, die im weichen Abendlicht der untergehenden Sonne erstrahlt, sichtbar. Diese nun schon römische Provinz auf der Insel Sicilia wurde vor Jahrhunderten von einem Herrn Selinunt gegründet, hat ihr einer der schwatzhaften Seeleute erklärt.
Aphrodite ist jetzt eine begehrte Gesprächspartnerin der Seeleute geworden. Den Betrug, dass sie eine abgrundhässliche Frau sei, hat der Wind leider im wahrsten Sinne des Wortes auffliegen lassen. Sie kümmerte sich gerade um Alana, als ihr Schleier und ihr Kopftuch sich lösten und einem Seemann direkt in die Arme wehten. Gleich drei Seeleute haben es gesehen und sie sofort erkannt. Jetzt drehen sich die Männer begeistert nach ihr um, wenn sie ihre Fußglöckchen hören. Sie wird von allen Männern gut behandelt. Den Betrug hat man Eklasteos auch schnell verziehen, als er ein Fässchen Wein spendierte. So kann sie jetzt ungestört ein Farbenspiel genießen, wie es schöner nicht sein kann. Die Häuser fügen sich in die aufsteigende Küste harmonisch ein. Als die Sonne gerade hinter den Bergen verschwindet, sind es nur noch wenige Ruderschläge bis zur Kaimauer.
Von den günstig wehenden Winden und der Angst vor gefährlichen Verfolgern angetrieben, sind sie schneller als geplant in Thermae Selinuntinae angekommen. Das Wagnis, die gefährlichen Klippen zu durchfahren, bewirkte, dass sie von dort nur einen Tag für ihr erstes Etappenziel benötigten. Nun geht alles ganz schnell. Männer an der Kaimauer fangen geschickt die zugeworfenen Taue auf und zurren das Schiff an den Poldern fest. Die drei Sklavinnen werden wieder bepackt. Alana ist noch lange nicht wiederhergestellt, aber für antike Verhältnisse über den Berg. Sie kann alleine vom Schiff gehen. Was Frauen in der Antike aushalten müssen, ist für Menschen des ausgehenden zweiundzwanzigsten Jahrhunderts unvorstellbar.
Ob sie jemals so stark wie Alana sein wird? Sie glaubt es eher nicht. Sina und sie müssen nun auch noch Alanas Gepäckanteil übernehmen. Aphrodite muss jetzt auch wieder den Schleier und das Kopftuch tragen. So hat sie im Dunkeln Mühe, das Brett unter ihren Füßen zu finden. Endlich erreicht sie wieder festen Boden. Aber was ist das, der Boden schwankt ja?
Nur mit viel Mühe hält sie sich auf den Beinen. Zielstrebig geht Eklasteos einen steilen Weg hinauf auf ein großes Haus zu. Die unter ihren Schmerzen leidende Alana wird auch ohne Gepäck immer langsamer. Die Sklavinnen und Eklasteos Frau können ihm nicht so schnell folgen. Zum Glück liegt das Haus nicht zu weit vom Hafen entfernt. Als die Frauen atemlos das Haus erreichen, ist Eklasteos bereits mit einem Mann, der von Weitem durch seine beachtliche Leibesfülle auffällt, in ein Gespräch vertieft. Sein lautes Organ erreicht auch Aphrodites Ohren.
Der dicke Mann trompetet Eklasteos gerade an: „Was, du hast tatsächlich dein Weingut in Utica verkauft? Gehen die Geschäfte dort so schlecht?“ Das wehrt Eklasteos mit den Armen fuchtelnd ab und lügt: „Die Geschäfte liefen glänzend. Das Gut habe ich mit gutem Gewinn verkauft. Nun möchte ich meine Geschäfte mit Rom ausbauen. Das ist für mich der Zukunftsmarkt. Auch ist das, was die Mächtigen von Karthago und Rom so treiben, mir zu ungewiss! Wer Erfolg haben wird, ist mir längst klar! Ich setze auf Sicherheit. Hier in Sicilia hoffe ich, dass mich kommende Wirren auf meinem Gut in Syrakusae verschonen werden!“
„Kommende Wirren? Du siehst Gespenster, Eklasteos. Nun, wenn du meinst, mein Freund. Es sei so! Sei willkommen, mein Haus ist auch dein Haus!“ Mit einem Seitenblick auf Aphrodite sagt er noch zu ihm: „Was für eine Schleiereule hast du uns denn mitgebracht?“ Eklasteos antwortet: „Menelastos, mein Freund, danke für deine Gastfreundschaft. Diese Schleiereule ist eine Perle. Ich sage dir gleich, sie ist unverkäuflich. Lass uns schnell in dein Haus gehen, dort zeige ich dir aus alter Freundschaft diese erlesene Schönheit genauer. Diese voll erblühte Rose der
Liebe will ich dir für heute Nacht sogar gerne überlassen!“
Aphrodite schwinden die Sinne bei der Vorstellung, das Bett die kommende Nacht mit diesem Fleischberg zu teilen. Sie fängt sich und folgt gehorsam den anderen in die Villa. Hinter dem Hofeingang öffnet sich ihr ein prachtvoller Garten mit einem großen Springbrunnen. Um den Garten herum führt ein farbenprächtiger Säulengang. Im Halbdunkel sind dahinter viele hohe Türen zu erkennen. Haussklaven nehmen ihnen das Gepäck ab. Alle Sklavinnen werden in die Küche geschickt.“
Aphrodite ist also erst mal angekommen und hat noch einen sehr weiten Weg vor sich, ehe Maria Lindström endlich ihren eigentlichen Auftrag erfüllen kann. Vielleicht wollen Sie Aphrodite-Maria ein Stück weit begleiten? Aber auch die anderen vier Deals dieser Woche versprechen eine spannende bis sehr spannende Lektüre. Viel Spaß beim Lesen, gute Begegnungen mit Männern, Frauen und Kindern und bis demnächst.
EDITION digital wurde 1994 gegründet und gibt neben E-Books (vorwiegend von ehemaligen DDR-Autoren) Kinderbücher, Krimis, historische Romane, Fantasy, Zeitzeugenberichte und Sachbücher (NVA-, DDR-Geschichte) heraus. Ein weiterer Schwerpunkt sind Grafiken und Beschreibungen von historischen Handwerks- und Berufszeichen sowie Belletristik und Sachbücher über Mecklenburg-Vorpommern.
Insgesamt umfasst das Verlagsangebot derzeit fast 900 Titel (Stand Mai 2018)
EDITION digital Pekrul & Sohn GbR
Alte Dorfstraße 2 b
19065 Pinnow
Telefon: +49 (3860) 505788
Telefax: +49 (3860) 505789
http://www.edition-digital.de
Verlagsleiterin
Telefon: +49 (3860) 505788
Fax: +49 (3860) 505789
E-Mail: editiondigital@arcor.de